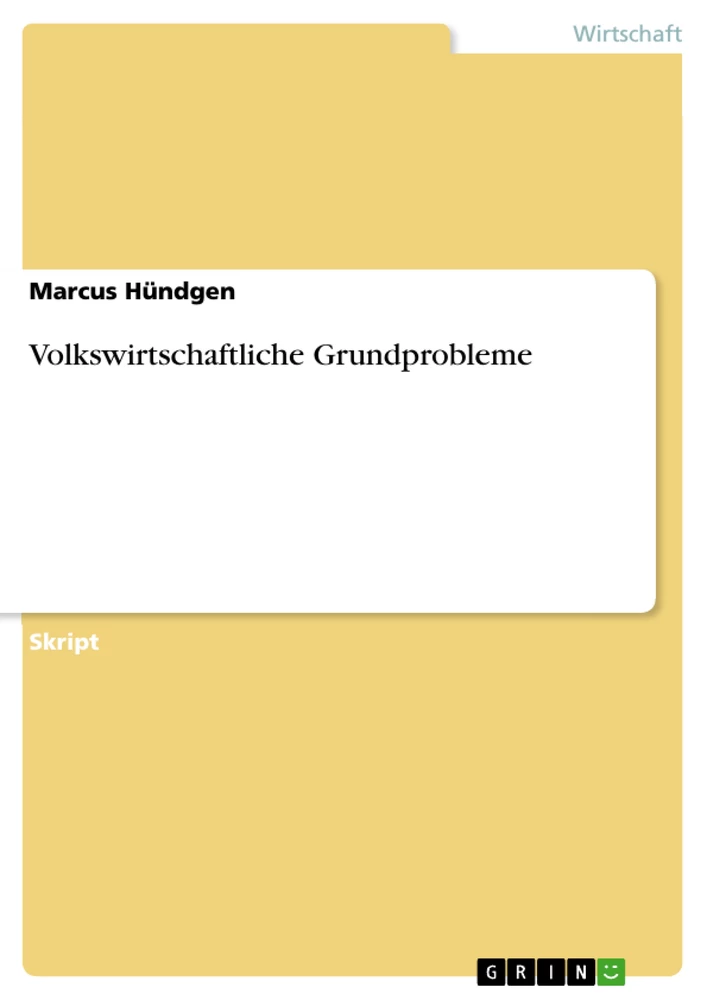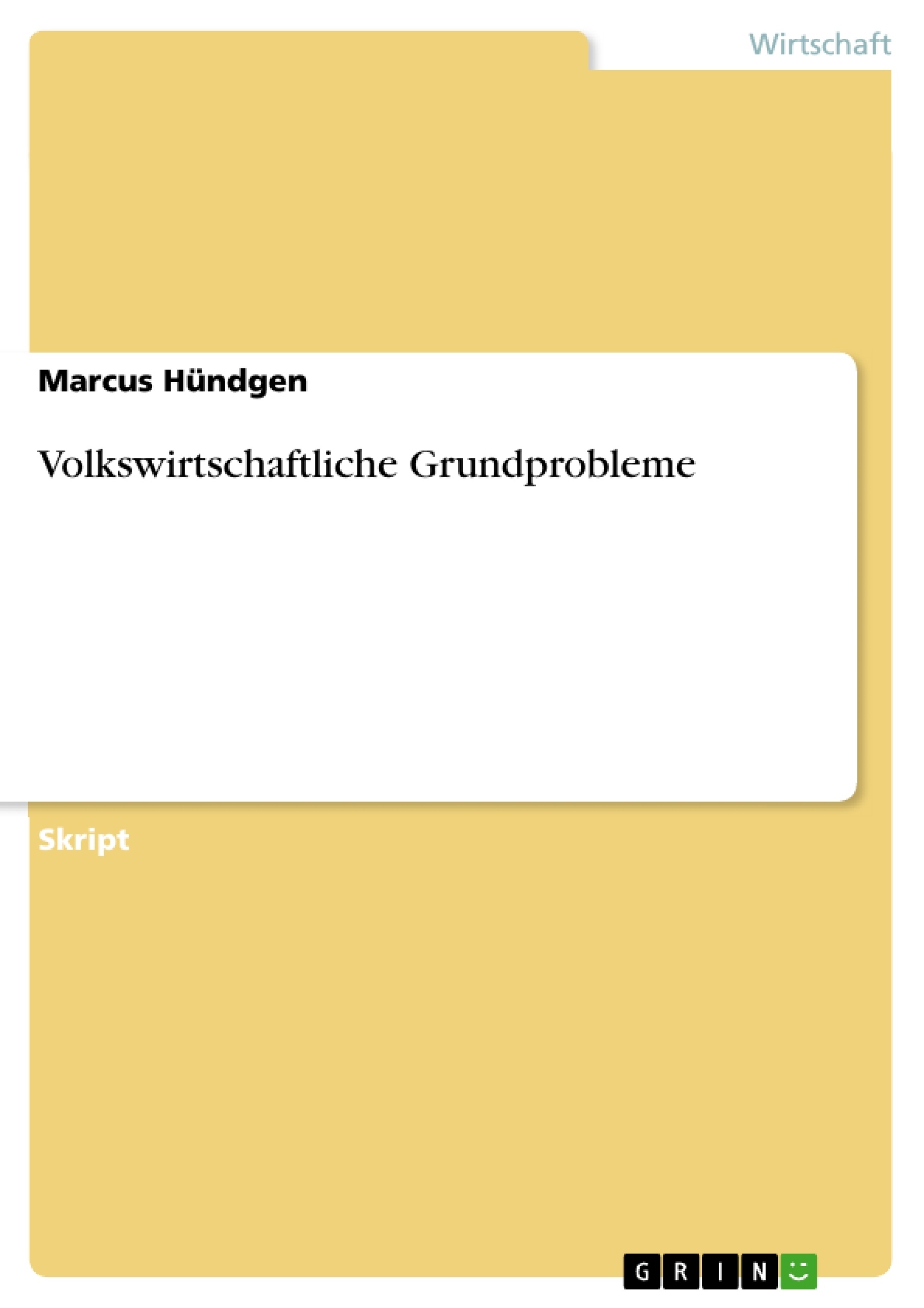Haben Sie sich jemals gefragt, wie Entscheidungen über knappe Ressourcen unser tägliches Leben bestimmen und die Weltwirtschaft formen? Dieses Buch enthüllt die fundamentalen Prinzipien der Volkswirtschaftslehre und führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch die komplexe Welt von Angebot und Nachfrage, Knappheit und Überfluss. Tauchen Sie ein in die Grundbegriffe, die unser Wirtschaftssystem prägen, von den individuellen Bedürfnissen und deren Befriedigung über das ökonomische Prinzip bis hin zu den verschiedenen Wirtschaftseinheiten wie Haushalten, Unternehmen und dem Staat. Ergründen Sie die Mechanismen, die hinter Produktionsprozessen, Arbeitsteilung und Tauschverkehr stehen, und verstehen Sie, wie diese Elemente zusammenspielen, um unseren Wohlstand zu beeinflussen. Anhand klarer Beispiele und verständlicher Erklärungen werden selbst komplizierte Sachverhalte wie Opportunitätskosten, Produktionsfunktionen und das Prinzip der Grenzproduktivität zugänglich gemacht. Dieses Buch ist Ihr unverzichtbarer Leitfaden, um die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen und fundierte Entscheidungen in einer sich ständig verändernden Welt zu treffen. Es bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der VWL, sondern regt auch zum kritischen Denken über wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen an. Egal, ob Sie Student, Unternehmer oder einfach nur an Wirtschaft interessiert sind, dieses Buch wird Ihr Verständnis für die Kräfte, die unsere Welt bewegen, grundlegend verändern und Ihnen helfen, die komplexen Dynamiken von Märkten, Ressourcenallokation und wirtschaftlichem Handeln zu durchdringen. Entdecken Sie die Werkzeuge, mit denen Sie wirtschaftliche Phänomene analysieren und bewerten können, und erlangen Sie ein tieferes Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen individuellen Entscheidungen und dem großen Ganzen der Volkswirtschaft. Bereiten Sie sich darauf vor, die Welt mit neuen Augen zu sehen und die verborgenen Mechanismen zu erkennen, die unseren wirtschaftlichen Alltag bestimmen.
Inhalt
1. Volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Grundprobleme
1.1. Die Wirtschaft
1.1.1. Knappheit und ihre Konsequenzen
1.1.2. Das ökonomische Prinzip
1.1.3. Wirtschaftseinheiten
1.1.4. Grundformen des Wirtschaftens
1.1.5. Das ökonomische System als Teil von Gesellschaftssystemen
1.2. Die Volkswirtschaftslehre
1.2.1. Einordnung in das System der Wissenschaften
1.2.2. Teilgebiete
1.2.2.1. Typische Probleme der Volkswirtschaftslehre
1.2.3. Methodik
1.2.3.1. Wie entstehen Theorien
1.3. Die Ressourcen der wirtschaftlichen Wertschöpfung
1.3.1. Arbeit
1.3.2. Boden
1.3.3. Kapital
1.3.4. Technisches Wissen
1.4. Die Kombination der Produktionsfaktoren
1.4.1. Produktionsbegriff und -funktion
1.4.2. Transformationskurve
1.4.3. Produktivität
1.4.3.1. Arbeitsproduktivität Seite
1. Volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Grundprobleme
1.1 Die Wirtschaft
1.1.1 Knappheit und ihre Konsequenzen
Ein Bedürfnis entsteht aus einem Mangelgefühl und dem Wunsch diesen Mangel zu beseitigen. Bedürfnisse lassen sich in Existenzbedürfnisse (=Lebenserhaltung) und Luxus-/Kulturbedürfnisse (=Lebensgestalltung) einteilen. Sie sind von Person zu Person individuell verschieden und können nicht miteinander verglichen werden (Intersubjektivität). Aus diesem Grund können sie in keiner einheitlichen Maßeinheit gemessen werden. Im Zuge von graphischen Darstellungen bedient man sich sog. Ordinalskalen1. Desweiteren unterscheidet man offene und latente (verborgene) Bedürfnisse, sowie Individual- und Kollektivbedürfnisse.
Um seine Bedürfnisse zu Befriedigen muß eine transitive Rangfolge eingehalten werden. Handelt es sich jedoch um kollektive Entscheidungen so sind diese nicht transitiv.
Als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung werden Güter eingesetzt. Diese Güter werden nach folgenden Kriterien differenziert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter Opportunitätskosten versteht man den Entgangenen Nutzen aus der besten, nicht gewählten Handlung (=Verzichtskosten). Durch das Streben nach Minimierung der Opportunitätskosten und die Güterknappheit wird wirtschaften erforderlich. In diesem
Zusammenhang stellt sich jedoch das Problem wie man das Wirtschaften am effizientesten organisiert.
Wirtschaften heißt somit immer, Entscheidungen über die Verwendung knapper Produktionsmittel (Ressourcen) und Güter zu treffen.3
1. Zielauswahl (I.; II; III; ...)
2. Mittelauswahl
3. Produktion von Gütern (Bereitstellung vorhandener Güter, Herstellung neuer Güter)
4. räumliche, personelle Verteilung
Wirtschaften - um außerökonomische Ziele zu verwirklichen - unter Einsatz von Produktionsfaktoren (Arbeit, Boden, Kapital, Wissen, etc.) ist nur sinnvoll solange der Ertrag größer als der Aufwand ist.
Der Nutzen ist eine subjektive Größe, da er nicht objektiv an den Gütern haftet. Er ist ebenfalls wie das Bedürfnis nicht meßbar.
1.1.2. Das ökonomisches Prinzip
Da es ein Spannungsverhältnis zwischen gewünschten und zur Verfügung stehenden Mitteln gibt (=Knappheit), muß das Ergebnis des Wirtschaftens bzw. des Produktionsprozesses ein Gut hervorbringen, dessen Nutzen größer ist, als der des ursprünglichen Gutes4.
Im ökonomischen Prinzip wird das günstigste Verhältnis angestrebt, wo bei es sich allerdings um ein rein formales, vernünftiges Prinzip handelt, das nichts über Motive und Zielsetzungen aussagt.
Minimalprinzip (Sparprinzip): Bestimmten Ertrag mit geringst-
möglichem Aufwand erzielen.
Maximalprinzip: Mit gegebenem Aufwand maximalen Ertrag erzielen.
Voraussetzung für diese beiden Prinzipien sind Alternativen und Wahlmöglichkeiten,
d.h. keine Determinierung und Berücksichtigung der Opportunitätskosten. Desweiteren muß immer eine Größe (Ertrag oder Aufwand) vorgegeben sein. Aussagen wie zum Beispiel „Mit mininalem Aufwand maximalen Ertrag erzielen“ sind widersprüchlich.
1.1.3. Wirtschaftseinheiten
Wirtschaftssubjekte bzw. Wirtschaftseinheiten sind Personen welche ökonomisch- wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen haben. Ihr wirtschaftliches Verhalten ist immer ein geplantes Verhalten, da es sich nach dem ökonomischen Prinzip richtet bzw. richten sollte.
- private Haushalte
Da die privaten Haushalte konsumieren wollen stellen sie Einkaufspläne und Verkaufspläne auf. Sie stellen Arbeit zur Verfügung, welche aufgrund der Zeitknappheit Opportunitätskosten verursacht. Desweiteren stellen Sie Kapital und Bodennutzung zur Verfügung.
In den Einkaufsplänen werden alle Güter die in einer Periode gekauft werden sollen aufgelistet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einkaufspläne sind abhängig von
- Einkommen (y)
- Bedürfnisstruktur (u)
- Preis des Gutes (pn)
- Preise aller anderen Güter (pi)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beispiel: Alle Komponenten bleiben unverändert lediglich pn wird verändert (=Beschränkung auf Marktprozesse):
_ _ _____________
pn = qnt = f ( y, u, pn, pi (i=1,...,n-1))
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- öffentliche Haushalte
= Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden),
Parafiscus (z.B. Sozialversicherung, IHK, öffentlich rechtliche Rundfunkanstalten) Die öffentlichen Haushalte betätigen sich in folgenden Bereichen:
- Produktion öffentlicher Güter welche nicht verkauft werden, sonder der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.
- „Konsumieren“ , d.h. bezahlen Beamte. (= Keine direkte Zuordnung möglich!)
- Setzt rechtliche und soziale Rahmenbedingungen (Gesetze)
- iniziert Transferzahlungen (Subventionen, Kindergeld, Bafög)
Staat hat Hoheitsrechte !!!
- Unternehmen
Ein Unternehmen ist eine Wirtschaftseinheit, die
- rechtlich selbstständig ist
- eine eigene Bilanz aufstellt (Selbstbilanzierend)
- in eigener Verantwortung wirtschaftliche Planungsentscheidungen trifft
- Sachgüter und Dienstleistungen zur Deckung fremden Bedarfs erstellt
Das Kriterium der Eigenverantwortung ist allerdings am schwächsten ausgeprägt, da viele Unternehmen Glieder eines Konzerns sind und damit in Abhängigkeit stehen.
Output = Verkaufspläne der Unternehmen für das Produkt, daß am Markt verkauft werden soll.
Input = Einkaufspläne beziehen sich auf die Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital der unterschiedlichen Qualitäten.
Der Zusammenhang zwischen Input und Output läßt sich wie folgt darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Produktionsfunktionen sind substituierbar, d.h. die Produktionsfaktoren sind austauschbar (Kapital / Arbeit)
Aus dieser Formel ergibt sich eine meßbare funktionale Abhängigkeit, welche jedoch bei komplexen Zusammenhängen schwierig wird (v1 und v2 oft voneinander abhängig). Desweiteren kann man das Verhältnis von v1 zu v2 festsetzen und so über- bzw. unterproportionale Entwicklungen erkennen.5
Ebenso kann der Output als Konstante festgelegt werden. Dies ist sinnvoll bei der Frage nach der Produktionstechnik (z.B. Schweisser oder Schweißmaschine).6
Prinzip der Grenzproduktivität: Der zusätzlicher Output durch Erhöhung / Veränderung des Inputs oder einzelner Faktoren nennt man Grenzprodukt. Durch die Bewertung der einzelnen Einheit erhält man den Grenzproduktwert.
Wichtig hierbei ist die Betrachtung der Grenzkosten 7, da diese eine Entscheidungshilfe bei ökonomischen Problemen darstellt (=Vergleich von Grenzerlösen und Grenzkosten):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Ausland
Grenzüberschreitende Transaktionen werden gesondert ausgewiesen. Das Ausland ist kein eigenes Wirtschaftssubjekt, es findet lediglich eine Bewertung der betreffenden Transaktionen statt. Die Berücksichtigung dieser Positionen dient der Abgrenzung des Bruttoinlandsproduktes, Nettofaktoreinkommen, etc. Wobei der Wohnsitz ausschlaggebend ist.
1.1.4. Grundformen des Wirtschaftens
W i r t s c h a f t e n
Eine Wirtschaftseinheit erstellt alle Güter, die benötigt werden selbst.
„Robinson Crusoe“ Autarkie (z.B. Autarkie- bestrebung im 3. Reich)
Arbeitsteilung über Grenzen hinweg. Arbeitsteiliges Wirtschaften, Organisation von Tauschverkehr als gesellschaftlicher Vorgang
K o n s e q u e n z e n
kaum machbar Spezialisierung erhöht die Ergiebigkeit aber die Motivation leidet und es entsteht eine größere gegenseitige Abhängigkeit (Macht entsteht und erfordert Kontrolle)
T a u s c h v e r k e h r
Naturaltauschwirtschaft (kein allgemeines Tauschgut)
Geldwirtschaft
(indirekter Tausch über Geld) Informationskosten werden reduziert. Voraussetzung: Geldstabillität
[...]
1 Rangskala. Skala, auf der alternative Ausprägungen neben Verschiedenheit auch eine Rangordnung zum Ausdruck bringen, z.B. Schulnote oder Intelligenzquotient.
2 Güterknappheit resultiert aus der Knappheit von Produktionsfaktoren (=Opportunitätsprinzip)
3 Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Band 1, 6. Auflage
4 Dem ökonomischen Prinzip werden immer substitutive Güter zu Grunde gelegt.
5 = f (a * v 1, v 2)
6 O t = f (v 1, v 2)
Häufig gestellte Fragen
Was sind Bedürfnisse laut diesem Text?
Ein Bedürfnis entsteht aus einem Mangelgefühl und dem Wunsch, diesen Mangel zu beseitigen. Bedürfnisse lassen sich in Existenzbedürfnisse (Lebenserhaltung) und Luxus-/Kulturbedürfnisse (Lebensgestaltung) einteilen.
Was versteht man unter Opportunitätskosten?
Unter Opportunitätskosten versteht man den entgangenen Nutzen aus der besten, nicht gewählten Handlung (=Verzichtskosten). Durch das Streben nach Minimierung der Opportunitätskosten und die Güterknappheit wird Wirtschaften erforderlich.
Was ist das ökonomische Prinzip?
Da es ein Spannungsverhältnis zwischen gewünschten und zur Verfügung stehenden Mitteln gibt (=Knappheit), muss das Ergebnis des Wirtschaftens bzw. des Produktionsprozesses ein Gut hervorbringen, dessen Nutzen größer ist, als der des ursprünglichen Gutes. Das ökonomische Prinzip wird in Minimal- und Maximalprinzip unterteilt.
Was sind Wirtschaftseinheiten (Wirtschaftssubjekte)?
Wirtschaftssubjekte bzw. Wirtschaftseinheiten sind Personen, welche ökonomisch-wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen haben. Dazu gehören private Haushalte, öffentliche Haushalte, Unternehmen und das Ausland (für grenzüberschreitende Transaktionen).
Was sind die Grundformen des Wirtschaftens?
Die Grundformen des Wirtschaftens sind Autarkie (Selbstversorgung) und Arbeitsteilung. Bei der Arbeitsteilung entsteht Tauschverkehr, welcher entweder als Naturaltauschwirtschaft oder als Geldwirtschaft organisiert sein kann.
Was sind Grenzproduktivität und Grenzkosten?
Der zusätzliche Output durch Erhöhung / Veränderung des Inputs oder einzelner Faktoren nennt man Grenzprodukt. Durch die Bewertung der einzelnen Einheit erhält man den Grenzproduktwert. Die Grenzkosten sind die zusätzlichen Kosten für eine zusätzliche Einheit und dienen als Entscheidungshilfe bei ökonomischen Problemen.
Was ist die Rolle des Staates in der Wirtschaft?
Der Staat produziert öffentliche Güter, die nicht verkauft werden, sondern der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, er "konsumiert" (bezahlt Beamte), setzt rechtliche und soziale Rahmenbedingungen (Gesetze) und initiiert Transferzahlungen (Subventionen, Kindergeld, Bafög).
- Quote paper
- Marcus Hündgen (Author), 1996, Volkswirtschaftliche Grundprobleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102237