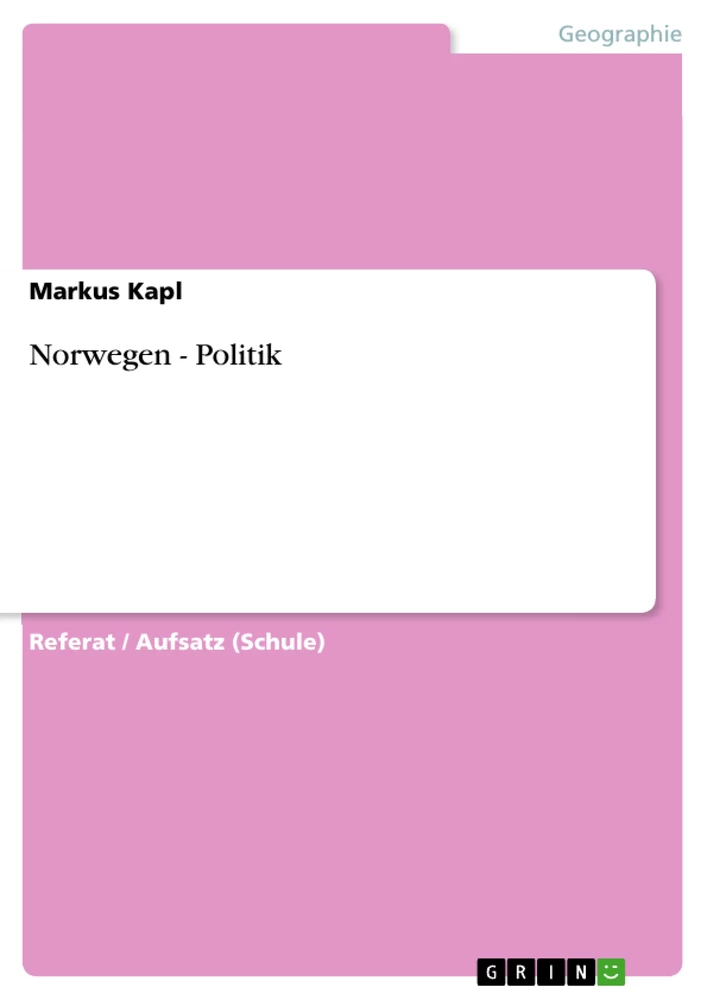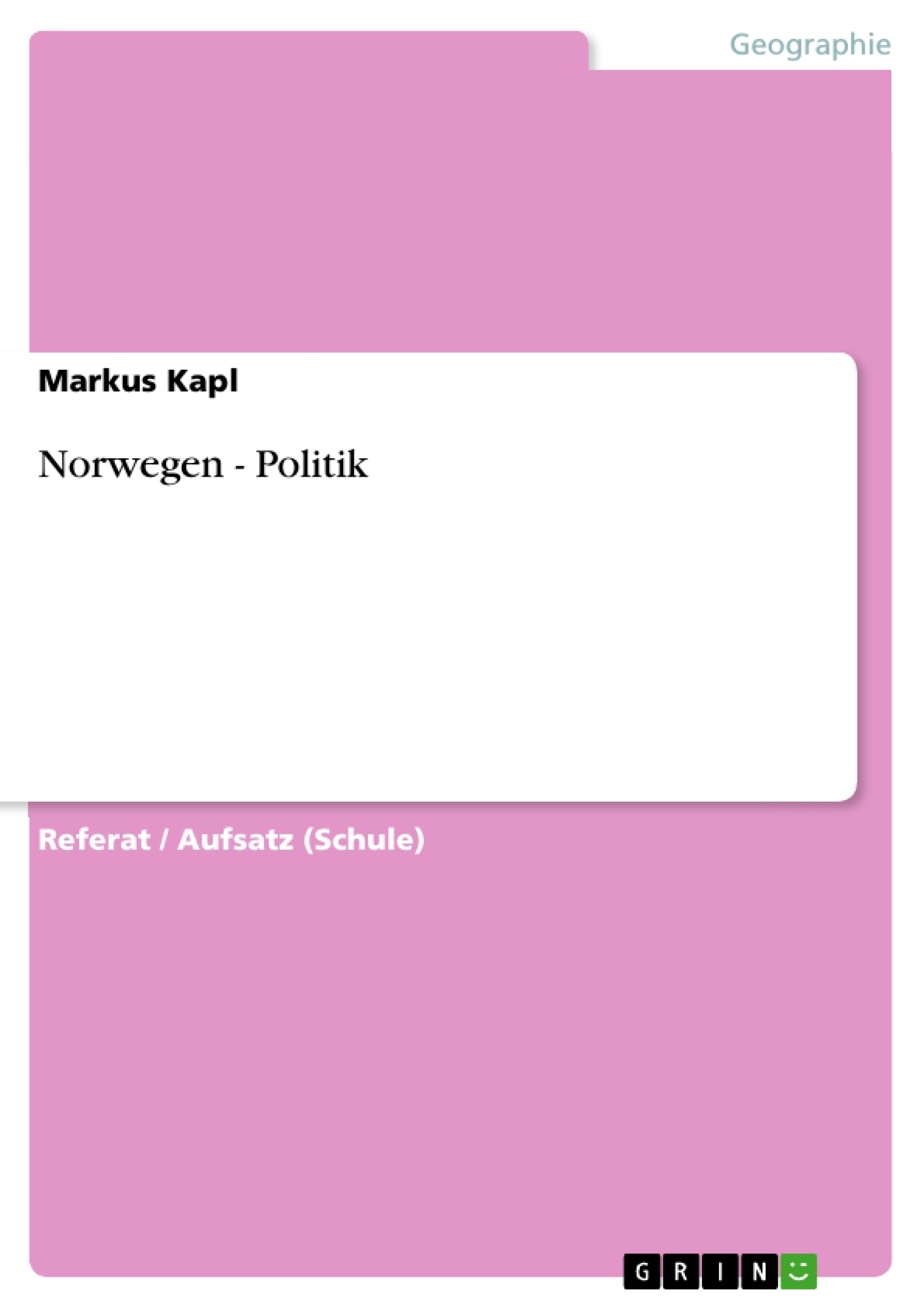NORWEGEN
ßNORWEGEN - politischer Überblick mit Erläuterung der derzeitigen Situation und deren Entstehung ßNORWEGEN - Nein zur Europäischen Union
politischer Überblick
Die rechts gerichtete Fortschrittspartei profitiert von der Unzufriedenheit vieler Wähler mit der Politik der regierenden Sozialdemokraten. Schon bei den letzten Parlamentswahlen vor drei Jahren war die rechte "Fortschrittspartei" mit 15,3 Prozent die zweitgrößte Kraft des Landes. Inzwischen liegt sie mit rund 23 Prozent schon den Sozialdemokraten im Genick. Der kurze Höhenflug der Linken nach der Machtübernahme des populären Sozialdemokraten Jens Stoltenberg im Frühjahr dürfte schon wieder vorbei sein. Damals sprachen sich 38 Prozent der Norweger für die Arbeiterpartei aus, zuletzt aber nur noch 27 Prozent.
Die Unzufriedenen laufen von der Arbeiterpartei zur Fortschrittspartei des Langzeit-Bosses Carl I.
Hagen über, der seine Partei seit 22 Jahren führt - noch nie so erfolgreich wie jetzt. Und Unzufriedene gibt es viele: Daß in dem reichen Ölland die Zustände in den Krankenhäusern elend sind und der Benzinpreis Weltrekordniveau erreicht, während der Staat Hunderte Milliarden in einem Erdölfonds hortet, ist für viele Wähler nicht leicht zu verstehen.
Nach den nächsten Wahlen will seine klassische Oppositionspartei Ministerämter haben, und er selbst ernennt sich zum "Kanzlerkandidaten". Noch hat sich keine andere Partei zum Regieren mit dem Rechtsaußen bereit erklärt. Um seine Truppe auf "Regierungspartei" zu trimmen, hat er ihr einen Stilwechsel verordnet.
Der Chef der Sozialisten, Stoltenberg, sieht die Gefahr, daß sein Land "ein zweites Österreich" wird. Er appelliert daher an die Parteien der bürgerlichen Mitte, Hagen nicht aus dem Abseits zu holen. Bürgerliche Kommentatoren werfen Stoltenberg allerdings vor, daß ihn dabei nicht die Angst vor einer Isolierung NORWEGENs treibe, sondern reine Parteitaktik: Die Mitte-Parteien in sein Lager zu locken, sei die einzige Chance, den angeschlagenen Sozialdemokraten die Macht zu erhalten. Nun versuchen die Sozialdemokraten mit ihrem „Ja zur EU“ das Valk wieder auf ihre Seite zu locken, da sie bei den letzten Kommunal- und Regionalwahlen auf das schlechteste Ergebnis seit 1925 abrutschten.
Mit 28,2 Prozent der Stimmen schnitt die Arbeiterpartei (AP) so schlecht ab wie nie mehr seit 1925. Sie blieb um mehr als drei Prozentpunkte unter dem als Katastrophe bezeichneten Ergebnis vor vier Jahren und um fast sieben Prozentpunkte unter dem Resultat der Parlamentswahlen von 1997, das Parteichef Thorbjörn Jagland damals für so unbefriedigend hielt, daß er als Ministerpräsident zurücktrat.
Nein zur Europäischen Union
Die Norweger haben sich mehrheitlich - 52,5 Prozent - gegen einen Beitritt ihres Landes zu Europäischen Union ausgesprochen. Und dies zum allgemeinen Bedauern der übrigen europäischen Länder. Dazu mischte sich unter den damaligen übrigen Beitrittskandidaten ( Österreich, Schweden und Finnland ) auch die Sorge dadurch mehr zahlen zu müssen. Der damalige Bundeskanzler Vranitzky äußerte sich damals auf diese Frage: "Das wird nicht so sein, aber selbst wenn, wird sich das in überschaubaren und erträglichen Grenzen halten."
Das Nein der Norweger machte auch eine Anpassung der Beitrittsverträge notwendig. So mußte die Stimmgewichtung im EU- Ministerrat neu festgelegt werden - Norwegen hätte drei Stimmen gehabt. Im EU-Parlament fielen die Sitze für die norwegischen Abgeordneten weg, und das für Norwegen in der EU-Kommission reservierte Fischereiressort mußte nun einem anderen Kommissar zugeteilt werden.
In Norwegen selbst feierten die EU-Gegner ihren Sieg, ihre Sprecherin, Anne Enger Lahnstein, erklärte freilich: "Wir sagten Ja zu Europa, aber Nein zur Union. Wir sind Europäer."
Lediglich im Großraum Oslo siegten die Befürworter, in allen übrigen Regionen Norwegens dominierte das Nein. Besonders ausgeprägt war das Nein unter den Frauen, den Bauern und den Fischern. Norwegen hat sich für einen anderen Weg entschieden als das übrige Europa. Denn nicht nur Österreich, Finnland und Schweden, sondern auch die osteuropäischen Länder sehen ihre Zukunft am besten in der Europäischen Union aufgehoben. Nun stellt sich die Frage ob nun Norwegen im Abseits steht.
Das Land hat freilich bereits starke Bindungen an Europa: Norwegen ist Mitglied der NATO, womit seine Sicherheitsinteressen abgedeckt sind, und es gehört dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. Als Polster seiner wirtschaftlichen und finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit verfügt Oslo über reiche Ölvorkommen, die mindestens noch 20 Jahre lang sprudeln werden. Leichter wird die Zukunft für die Norweger freilich nicht werden - die Schweiz, mit der Norwegen nun in gewisser Hinsicht im selben Boot sitzt, darf hier als Modell dienen.
Trotz des unterschiedlichen Ausgangs der Volksabstimmungen sind die Norweger aber in einem Punkt nicht anders als die Schweden, Franzosen oder Schweizer: Die Europa-Idee hat auch in Norwegen die Menschen entzweit und zu einer Entfremdung zwischen der höheren Schicht und den Bürgern geführt.
Die Wahlbeteiligung war in allen Landesteilen außerordentlich hoch.
Norwegen stimmte als letzter der vier Beitrittskandidaten über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ab. Österreich, Finnland und Schweden hatten zuvor bereits ja gesagt. Die Volksabstimmung in Norwegen ist nicht verbindlich, sie hat nur empfehlenden Charakter. Die eigentliche Entscheidung fällt das Parlament, wo eine Dreiviertelmehrheit für einen allfälligen Beitritt zur EU erforderlich ist. Die Befürworter verfügen im Parlament nicht über diese Mehrheit, mehrere Parteien hatten bereits angekündigt, daß sie im Falle eines knappen Ergebnisses der Volksabstimmung im Parlament auf jeden Fall mit Nein stimmen würden.
Repräsentativ ist das Referendum auf jeden Fall: Die Wahlbeteiligung dürfte nach letzten Angaben deutlich über 80 Prozent betragen.
1972 hatten die Norweger in einer Volksabstimmung den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft abgelehnt.
Am Anfang ihrer „Ja zu Europa - Ja zur Union“ Werbekampagne waren Ausdrücke wie Landesverräter noch die mildesten Beschimpfungen mit denen sich die Werbenden beschimpfen lassen mussten. Das größte Problem der Union - Befürworter war und ist, daß die meisten Leute auf der Nein-Seite in ihren Ansichten unerschütterlich sind.
In Norwegen gehen die Uhren im Vergleich zu Schweden oder Finnland anders. Seit 30 Jahren ist die EU ein leidenschaftlich diskutiertes Thema. Seit 1962 gab es keine einzige Meinungsumfrage mehr, in der die Befürworter über eine Mehrheit verfügten.
Beispiel Anne Gimmestad, Beamtin im Gesundheitsministerium und Mutter zweier Kinder:
Sie gehörte zu jenen, die noch unentschlossen waren. Angeblich waren dies 48 Stunden vor der Abstimmung noch immer 15 Prozent der Wähler. In einem längeren Gespräch mit der „Presse“ wurde deutlich, daß sie dem fernen Brüssel mit großer Skepsis gegenübersteht. "Warum sollen wir uns dieser Institution unterordnen, wo wir doch bisher selbst gut gefahren sind? Wir haben keine Angst vor Wirtschaftskrisen.“
In der Tat hat vor allem das Nordseeöl Norwegen in eines der wohlhabendsten Länder der Welt verwandelt. Die Norweger kennen weder eine hohe Arbeitslosigkeit noch wirtschaftliche Krisenszenarien. Aber auch mit dem Sicherheitsargument läßt sich hier - anders als in Finnland oder Österreich - kaum ein Stich machen. Norwegen zählt zu Gründungsmitgliedern der NATO. Oslo ist der einzige Fleck in Norwegen, wo die Befürworter der Union in der Mehrheit sind. Anders die Stimmung mehr als 100 Kilometer nördlich des Polarkreises in Tromsö. Wenn Aktivisten der Ja-Bewegung dem Flugzeug entsteigen, haben sie meist ihre Anstecknadel bereits in einer Tasche verschwinden lassen. Eine beinahe feindliche Stimmung schlägt ihnen in Tromsö entgegen, wo die Solidarität mit den Fischern noch ungebrochen ist. Jon Lauritzen, Sprecher der Fischer, meint unverblümt, daß "wir ganz einfach keine spanischen oder französischen Boote in unseren Gewässern antreffen wollen".
Die Folge: Stadt und Land driften auseinander.
Hier im hohen Norden lebten die Menschen immer auf sich alleingestellt. Aber auch die unglaublich selbstbewußten Bauern etwas weiter im Süden, die in ihrer Geschichte nie einen Grundherrn kannten, wollen nicht einmal von Oslo etwas wissen.
Vor allem das Öl hat die Norweger in ihrem mythischen Glauben bestärkt, daß ihnen wirtschaftlich nichts passieren kann. Sie bezeichnen sich gerne als 'blauäugige Araber'."
Sollte Norwegen einmal den Weg in die EU gehen, würde Oslo eine Brüssel- skeptische Politik verfolgen, die jener der Briten sehr ähnlich ist. 400 Jahre lang war das Land unter dänischer Herrschaft. 100 Jahre lebte man zwangsweise mit Schweden in einer sogenannten Union zusammen, weshalb selbst die Ja-Aktivisten nur ungern von der "Europäischen Union" sprechen. In der Endphase des Wahlkampfes war sich dabei auch die Ministerpräsidentin nicht zu fein, mit grob gestrickten Argumenten zu werben: "Norwegen darf sich nicht auf eine Stufe mit Bulgarien, Rumänien, Tadschikistan und Usbekistan stellen"
Am Ende allerdings siegte der Durchschlagende Slogan „Ja zum Fisch - Nein zur EU“. Längs der Küste zwischen Tronheim und Kirkenes stimmten durchwegs 60 und 70 Prozent der Bevölkerung gegen den Beitritt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über Norwegen?
Dieser Text bietet einen politischen Überblick über Norwegen, einschließlich der aktuellen politischen Situation und ihrer Entstehung. Er konzentriert sich auf Norwegens Ablehnung der Europäischen Union und die Gründe dafür.
Was sind die wichtigsten politischen Kräfte in Norwegen?
Der Text erwähnt die rechtsgerichtete Fortschrittspartei, die von der Unzufriedenheit mit der Politik der regierenden Sozialdemokraten profitiert. Die Arbeiterpartei unter Jens Stoltenberg wird ebenfalls thematisiert, ebenso wie Carl I. Hagen, der langjährige Chef der Fortschrittspartei.
Warum sind viele Wähler in Norwegen unzufrieden?
Die Unzufriedenheit rührt von verschiedenen Faktoren her, darunter der Zustand der Krankenhäuser, hohe Benzinpreise und die Tatsache, dass der Staat große Summen in einem Erdölfonds hortet, während viele Bürger diese Situation als ungerecht empfinden.
Was sind die Positionen der verschiedenen Parteien zur EU?
Die Sozialdemokraten befürworten tendenziell einen Beitritt zur EU ("Ja zur EU"), während die Fortschrittspartei skeptisch ist. Die Mitte-Parteien sind entscheidend für die Machtbalance und die Frage, ob die Sozialdemokraten an der Macht bleiben können.
Warum lehnten die Norweger den Beitritt zur Europäischen Union ab?
Die Mehrheit der Norweger sprach sich gegen einen Beitritt zur EU aus, weil sie ihre Unabhängigkeit bewahren und nicht Teil der EU-Strukturen sein wollten. Insbesondere Frauen, Bauern und Fischer waren gegen den Beitritt.
Welche Folgen hatte das "Nein" der Norweger zur EU?
Das "Nein" erforderte eine Anpassung der Beitrittsverträge der anderen Kandidatenländer (Österreich, Schweden, Finnland). Auch die Stimmgewichtung im EU-Ministerrat und die Sitzverteilung im EU-Parlament mussten angepasst werden.
Welche wirtschaftlichen Vorteile hat Norwegen, die andere Länder nicht haben?
Norwegen verfügt über reiche Ölvorkommen, die es dem Land ermöglichen, wirtschaftlich unabhängig zu sein und eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten. Das Nordseeöl hat Norwegen in eines der wohlhabendsten Länder der Welt verwandelt.
Wie unterscheidet sich die Meinung über die EU in verschiedenen Regionen Norwegens?
Die Befürworter der EU dominierten hauptsächlich im Großraum Oslo, während in allen anderen Regionen Norwegens die Ablehnung überwog. Insbesondere in Küstenregionen und unter Fischern war der Widerstand gegen die EU stark.
Wie wird die Zukunft Norwegens aussehen, da es nicht Mitglied der EU ist?
Norwegen wird wahrscheinlich eine ähnliche Position wie die Schweiz einnehmen, wobei es starke Bindungen an Europa durch die NATO-Mitgliedschaft und den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) aufrechterhält. Es wird erwartet, dass Norwegen eine Brüssel-skeptische Politik verfolgt, ähnlich der Großbritanniens.
Welchen Slogan haben die EU-Gegner benutzt?
Der durchschlagende Slogan der EU-Gegner war „Ja zum Fisch - Nein zur EU“.
- Quote paper
- Markus Kapl (Author), 2001, Norwegen - Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102179