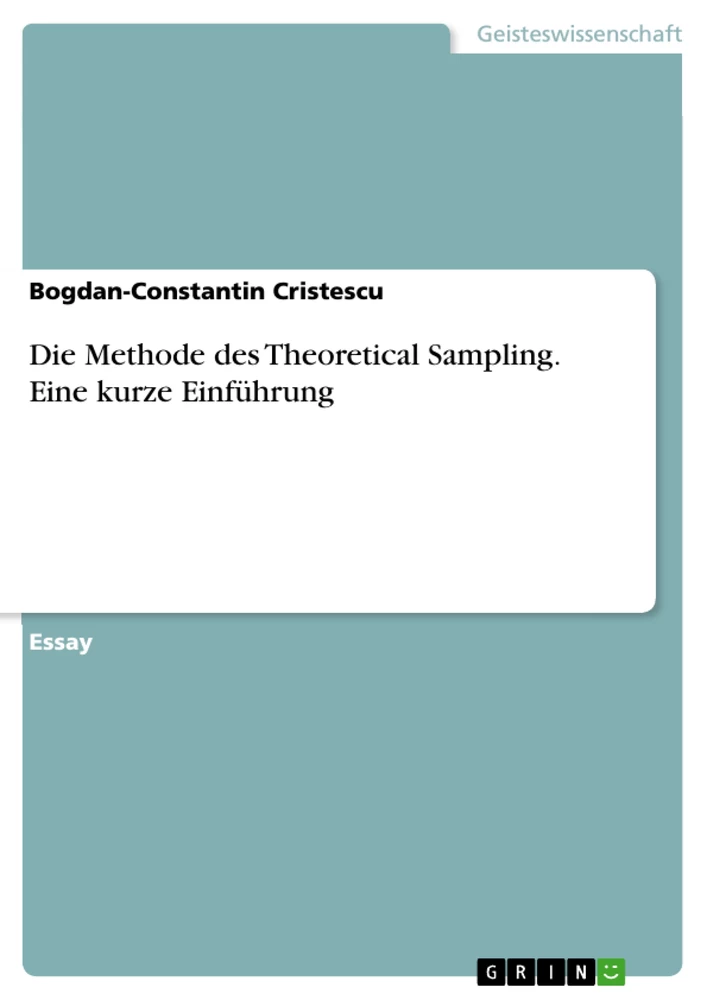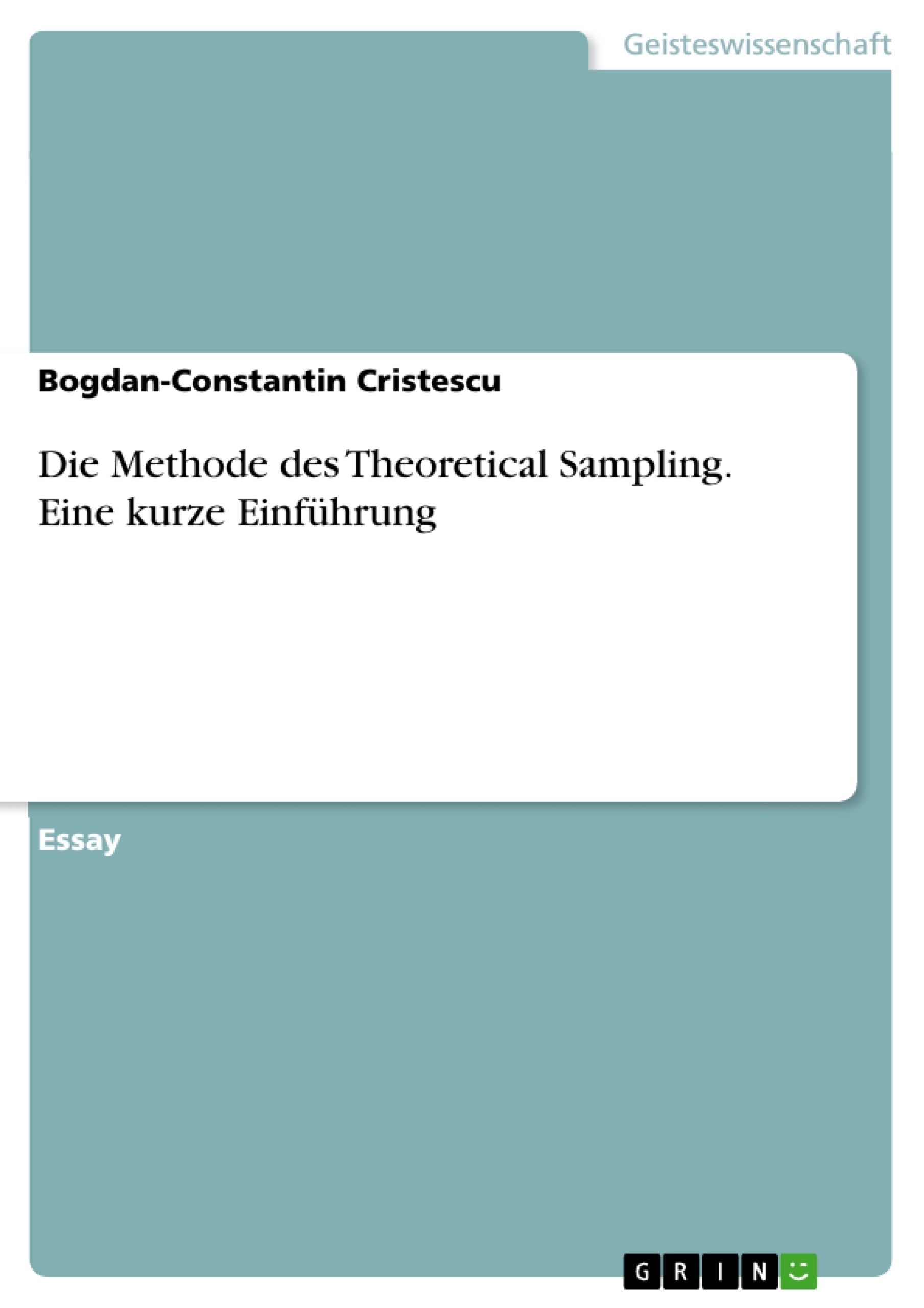Dieser Essay erläutert die Methode des Theoretical Samplings und ist damit gleichermaßen eine Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung. Was versteht man überhaupt unter einer theoretischen Stichprobenziehung? Bei dieser von Glaser und Strauss entwickelten Vorgehensweise für qualitative Studien geht es darum, vom Anfang an den Prozess bewusst so zu steuern, bis sich ein "maximaler theoretischer Erkenntniswert" daraus entwickelt. Je nachdem wie die Studie verläuft, lässt sich entscheiden, ob man eventuell mehrere Fälle untersuchen soll, also mehr Personen, Gruppen oder Institutionen bspw. Die Studie lässt sich (im Idealfall) für beendet erklären, sobald genug Informationen für eine Theoriebildung vorhanden sind (theoretische Sättigung).
Inhaltsverzeichnis
- Was versteht man überhaupt unter einer theoretischen Stichprobenziehung?
- Inwiefern stellt sie (die theoretische Stichprobenziehung) eine induktive bzw. eine „Bottom-up“-Strategie der bewussten Stichprobenziehung dar?
- Lassen sich Ergebnisse, die anhand einer solchen Stichprobe ermittelt wurden, verallgemeinern?
- Diese Methode unterscheidet sich von allen anderen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die theoretische Stichprobenziehung (Theoretical Sampling) im Rahmen qualitativer Forschung. Er beleuchtet die Methode, ihre Anwendung und ihre Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Stichprobenverfahren. Der Fokus liegt auf der induktiven und Bottom-up-Strategie sowie der Frage nach der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse.
- Definition und Entstehung der theoretischen Stichprobenziehung
- Theoretische Stichprobenziehung als induktive und Bottom-up-Strategie
- Prinzipien der maximalen Ähnlichkeit und maximalen Differenz
- Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse (analytische Verallgemeinerung)
- Vor- und Nachteile der theoretischen Stichprobenziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Was versteht man überhaupt unter einer theoretischen Stichprobenziehung?: Der Essay beginnt mit der Definition der theoretischen Stichprobenziehung (Theoretical Sampling) als ein Verfahren zur qualitativen Datengewinnung, entwickelt von Glaser und Strauss im Rahmen der Grounded Theory Methodologie. Im Gegensatz zu Vollerhebungen dient sie der gezielten Auswahl von Fällen, um einen maximalen theoretischen Erkenntniswert zu erzielen. Das Verfahren endet mit der "theoretischen Sättigung", wenn genügend Daten für die Theoriebildung vorliegen. Der Essay hebt die Bedeutung von Stichproben in der Sozialforschung hervor, da sie oft zeit- und kostengünstige Alternativen zu Vollerhebungen darstellen, trotz der Notwendigkeit von Schätzungen und Annahmen.
Inwiefern stellt sie (die theoretische Stichprobenziehung) eine induktive bzw. eine „Bottom-up“-Strategie der bewussten Stichprobenziehung dar?: Dieser Abschnitt erläutert die theoretische Stichprobenziehung als Bottom-up-Strategie der bewussten Stichprobenziehung. Die Kriterien für die Fallauswahl ergeben sich erst im Untersuchungsverlauf. Die Prinzipien der maximalen Ähnlichkeit und maximalen Differenz werden anhand des Beispiels von Glaser und Strauss (Untersuchung der Auswirkungen sterbender Krankenhauspatienten auf das Personal) veranschaulicht. Die Auswahl ähnlicher Fälle (z.B. Patienten, die ihren Zustand nicht kennen) ermöglicht die Identifizierung von Mustern, während die Auswahl unterschiedlicher Fälle (z.B. Patienten, die ihren bevorstehenden Tod wissen) kontrastreiche Daten liefert und neue Aspekte der Interaktion beleuchtet. Die Berücksichtigung weiterer Faktoren wie Krankheitsdauer oder Anwesenheit von Verwandten wird als weiterer Schritt im Prozess betont.
Lassen sich Ergebnisse, die anhand einer solchen Stichprobe ermittelt wurden, verallgemeinern?: Dieser Teil befasst sich mit der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse aus der theoretischen Stichprobenziehung. Der Essay argumentiert für eine analytische Verallgemeinerung, die im Gegensatz zur statistischen Verallgemeinerung in der quantitativen Forschung steht. Die qualitative Forschung zielt auf die Entwicklung von Theorien ab, und die Zusammensetzung der Stichprobe ist wichtiger als deren Größe. Die theoretische Stichprobenziehung wird als ein iterativer Prozess des Sammelns, Kodierens und Analysierens von Daten beschrieben, der zur Theoriegenerierung führt. Die Entdeckung von Kategorien, Subkategorien und deren Interaktionen sind zentrale Aspekte dieser Methode.
Diese Methode unterscheidet sich von allen anderen: Der abschließende Teil des Essays fasst die Unterschiede der theoretischen Stichprobenziehung zu anderen Methoden zusammen und diskutiert deren Vor- und Nachteile. Als Vorteil wird die Eignung für die Generierung und Entwicklung theoretischer Daten hervorgehoben, sowie die Schaffung von Struktur in der qualitativen Forschung. Als Nachteile werden die Komplexität, der hohe Zeitaufwand und der Mangel an klaren Vorgaben genannt. Der Essay schließt mit einem Ausblick auf die Herausforderungen bei der Anwendung, insbesondere die Bedeutung der Gruppendynamik und der Notwendigkeit von Verhandlungen innerhalb des Forschungsteams zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels und der Definition des Sättigungspunkts.
Schlüsselwörter
Theoretische Stichprobenziehung, Theoretical Sampling, Grounded Theory Methodologie, Qualitative Forschung, Bottom-up-Strategie, Induktive Forschung, Maximal Ähnlichkeit, Maximal Differenz, Analytische Verallgemeinerung, Theoriebildung, Datensättigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Theoretischen Stichprobenziehung
Was ist theoretische Stichprobenziehung?
Theoretische Stichprobenziehung (Theoretical Sampling), entwickelt im Rahmen der Grounded Theory Methodologie von Glaser und Strauss, ist ein Verfahren der qualitativen Datengewinnung. Im Gegensatz zu Vollerhebungen dient sie der gezielten Auswahl von Fällen, um maximalen theoretischen Erkenntniswert zu erzielen. Das Verfahren endet mit der "theoretischen Sättigung", wenn genügend Daten für die Theoriebildung vorliegen. Sie ist eine zeit- und kostengünstige Alternative zu Vollerhebungen, erfordert aber Schätzungen und Annahmen.
Wie funktioniert theoretische Stichprobenziehung als induktive und Bottom-up-Strategie?
Theoretische Stichprobenziehung ist eine Bottom-up-Strategie: Die Kriterien für die Fallauswahl ergeben sich erst im Untersuchungsverlauf. Sie nutzt die Prinzipien der maximalen Ähnlichkeit (Identifizierung von Mustern durch Auswahl ähnlicher Fälle) und maximalen Differenz (kontrastreiche Daten und neue Aspekte durch Auswahl unterschiedlicher Fälle). Weitere Faktoren werden iterativ berücksichtigt (z.B. Krankheitsdauer, Anwesenheit von Verwandten bei Glaser und Strauss' Untersuchung sterbender Patienten).
Wie ist die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse bei theoretischer Stichprobenziehung?
Im Gegensatz zur statistischen Verallgemeinerung der quantitativen Forschung, zielt die qualitative Forschung auf die Entwicklung von Theorien ab. Hier steht die Zusammensetzung der Stichprobe über deren Größe. Es findet eine analytische Verallgemeinerung statt, die durch einen iterativen Prozess des Sammelns, Kodierens und Analysierens von Daten zur Theoriegenerierung führt. Zentral sind die Entdeckung von Kategorien, Subkategorien und deren Interaktionen.
Worin unterscheidet sich die theoretische Stichprobenziehung von anderen Methoden?
Die theoretische Stichprobenziehung eignet sich besonders für die Generierung und Entwicklung theoretischer Daten und schafft Struktur in der qualitativen Forschung. Nachteile sind die Komplexität, der hohe Zeitaufwand und der Mangel an klaren Vorgaben. Herausforderungen liegen in der Gruppendynamik und der Notwendigkeit von Verhandlungen im Forschungsteam zur Zielfindung und Definition des Sättigungspunkts.
Welche Schlüsselbegriffe sind mit der theoretischen Stichprobenziehung verbunden?
Schlüsselbegriffe sind: Theoretische Stichprobenziehung, Theoretical Sampling, Grounded Theory Methodologie, Qualitative Forschung, Bottom-up-Strategie, Induktive Forschung, Maximale Ähnlichkeit, Maximale Differenz, Analytische Verallgemeinerung, Theoriebildung, Datensättigung.
- Quote paper
- Bogdan-Constantin Cristescu (Author), 2020, Die Methode des Theoretical Sampling. Eine kurze Einführung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021570