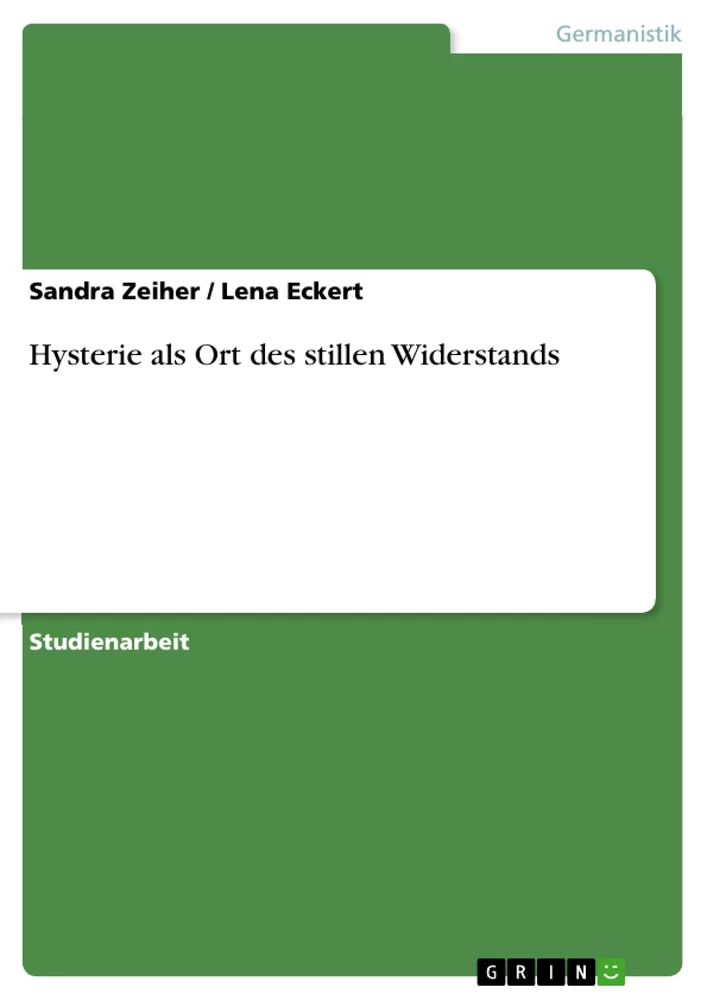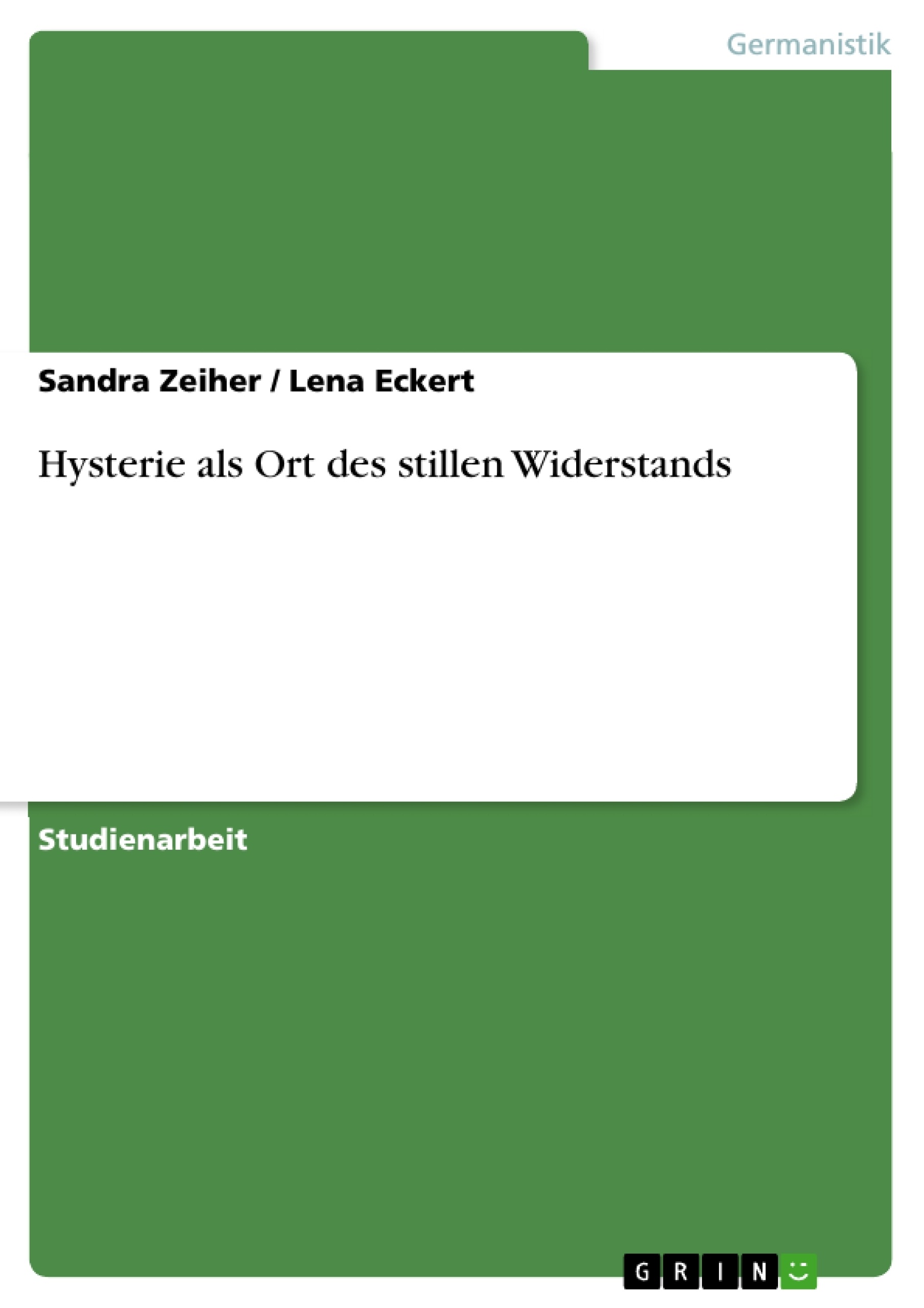Was bedeutet es, in einer Welt gefangen zu sein, in der dein Wert durch dein Geschlecht definiert wird? Irmgard Keuns Roman "Kind aller Länder" entfaltet ein fesselndes Panorama familiärer Verstrickungen im Exil der 1930er Jahre, in dem die junge Kully zwischen den starren Rollenbildern ihrer Eltern navigiert. Der Vater, ein rastloser Schriftsteller, verkörpert die patriarchale Ordnung, während die Mutter, Anni, in der ihr zugewiesenen Passivität gefangen ist. Doch hinter der Fassade der häuslichen Idylle brodelt ein subtiler Kampf um Selbstbestimmung. Diese tiefgründige Analyse beleuchtet, wie feministische Literaturtheorie und Psychoanalyse uns helfen, die verborgenen Dynamiken von Macht, Geschlecht und Widerstand in Keuns Werk zu entschlüsseln. Entdecken Sie, wie Annis Hysterie als ein stummer Schrei nach Autonomie interpretiert werden kann, ein Aufbegehren gegen die erdrückende Last der Weiblichkeit. Tauchen Sie ein in die Welt von Kully, die sich den Konventionen widersetzt und ihren eigenen Weg sucht, ein Symbol der Hoffnung in einer von Ungleichheit geprägten Welt. Diese Arbeit untersucht die Konstruktion von Geschlechterrollen und die Auswirkungen auf die weibliche Identität, indem sie Freuds Hysteriebegriff kritisch hinterfragt und feministische Perspektiven aufzeigt. Untersucht werden die starren Dichotomien von männlich und weiblich, öffentlich und privat, aktiv und passiv, und wie diese die Figuren in ihrem Handeln einschränken. Im Zentrum steht die Frage, wie sich gesellschaftliche Normen in der Literatur widerspiegeln und welche Möglichkeiten des Widerstands den Protagonistinnen zur Verfügung stehen. Eine provokante und erhellende Lektüre für alle, die sich für Feminismus, Psychoanalyse und die Bedeutung von Literatur als Spiegelbild unserer Gesellschaft interessieren. Die Analyse der Figurenkonstellation, insbesondere der Vater- und Mutterfiguren, offenbart die tiefgreifenden Auswirkungen patriarchaler Strukturen. Es wird gezeigt, wie die Hysterie der Mutterfigur als Ausdruck von Widerstand gegen die ihr zugewiesene Rolle gelesen werden kann, während die Tochterfigur, Kully, eine Synthese zwischen den elterlichen Polen darstellt und sich aktiv den gesellschaftlichen Erwartungen widersetzt. Dieses Buch bietet eine neue Perspektive auf Irmgard Keuns Werk und regt zum Nachdenken über die Rolle der Frau in der Gesellschaft an.
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. DIE VERKNÜPFUNG VON FEMINISMUS , PSYCHOANALYSE UND LITERATURWISSENSCHAFT
3. DIE FIGURENKONSTELLATION IN IRMGARD KEUNS „KIND ALLER LÄNDER“
3.1 DER VATER ALS REPRÄSENTANT DER PATRIARCHALISCHEN ORDNUNG
3.2 DIE MUTTER ALS REPRÄSENTANTIN DER UNTERGEORDNETEN WEIBLICHEN ROLLE - EINE FIGUR MIT BRÜCHEN
3.3 DICHOTOMIEN SO WEIT DAS AUGE REICHT...
4. FREUD UND DIE HYSTERIE
4.1 KRANKHEIT ALS „UNORDENTLICHER AUSBRUCH“
4.2 SYMPTOME UND SYMPTOMATIK
4.3 ...AM BEISPIEL ANNI
5. VERSCHIEDENEN POSITIONEN ZUR HYSTERIKERIN
5.1 DIE THEORIEN VON FREUD UND BREUER
5.2 FEMINISTISCHE POSITIONEN ZUR HYSTERIKERIN
6. KULLY ALS „SYNTHESE“ ZWISCHEN VATER UND MUTTER
7. SCHLUSS
8. ANHANG
TABELLE 1 CHARAKTERISTIK DER MUTTERFIGUR
TABELLE 2 CHARAKTERISTIK DER VATERFIGUR
TABELLE 3 GEGENÜBERSTELLUNG VON VATER- UND MUTTERFIGUR
9. BIBLIOGRAPHIE
1. Einleitung
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Roman „Kind aller Länder1 “ von Irmgard Keun, erschienen 1938. Durch eine Charakteristik der drei ProtagonistInnen soll deren Verhalten innerhalb und außerhalb der jeweils geschlechtsspezifischen Rollennormen analysiert und auf Brüche untersucht werden. Die Grundlage hierfür stellt die soziokulturell hergestellte patriarchale Gesellschaftsordnung. Feministische Theorie und feministische Forschung haben es sich zum Ziel gemacht, die Diskriminierung von Frauen in den Gesellschaften zu untersuchen. Es geht darum, Unterdrückungsmechanismen und soziokulturelle Konstruktionen von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ aufzudecken. Gerade dieser Roman eignet sich dafür besonders, da die verschieden Rollenzuweisungen nicht ganz ohne Brüche funktionieren und gerade bei den Frauenfiguren „typische weibliche“ Widerstandsmechanismen zu erkennen sind.
Die „weibliche“ AutorInnenschaft soll bei dieser Arbeit keine Rolle spielen, da der Text als solches behandelt wird und nicht die vermeintliche Intention der Autorin vermutet werden soll.
In Anlehnung an M. Foucault2 kann festgestellt werden, dass sich kein Subjekt außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung bewegen kann und somit die Geschlechtszuschreibungen bei männlichen sowie bei weiblichen AutorInnen verinnerlicht sind. Die folgende feministische Lesart soll sich anhand der Psychoanalyse mit Anpassung und Widerstand an die weiblichen Rollennormen befassen und diese aufdecken.
Die vorliegende Arbeit erhebt keinen expliziten dekonstruktivistischen Anspruch, im Sinne Lacans oder Derridas. Allerdings wird ein konstruktivistisches Verständnis von Geschlecht vorausgesetzt. Der Einfachheit und des Verständnisses wegen werden Begriffe wie Mann, Frau, weiblich, männlich, Vater, Mutter innerhalb des Textflusses verwendet. Die Begriffe männlich und weiblich werden immer in Bezug auf die Rollenverteilung gebraucht, und müssen im Hinblick auf soziokulturelle Konstruktion, abgespalten von biologistischer, und essentialistische Sichtweise auf Körper gelesen werden. In dieser Arbeit soll auf gender eingegangen werden, nicht auf sex (wobei die Konstruiertheit dieser Kategorien hier nicht erläutert werden soll).
2. Die Verknüpfung von F eminismus, Psychoanalyse und Literaturwissenschaft
Innerhalb der feministischen Literaturtheorie gibt es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Herangehensweisen.
Da hier Literaturwissenschaft, Feminismus und Psychoanalyse verknüpft werden sollen, wird auf andere Verfahren nicht explizit eingegangen, sondern nur ansatzweise auf die soziokulturelle Konstruktion von Machtmechanismen und Hierarchien eingegangen.
Die Verknüpfung von Literaturwissenschaft und Psychoanalyse hat eine lange Tradition:
„Der eigentlich jüngste, dabei aber grundlegendste Ansatz kann als kulturkritisch auf psychologischer Grundlage bezeichnet werden. Hier wird in einem tiefenhermeneutischen Vorgehen die bestehende Geschlechterdifferenz mit ihrer Abwertung, Benachteiligung und Marginalisierung des Weiblichen als Folge (...) einer patriarchal strukturierten Gesellschaft und deren Niederschlag in der Literatur untersucht...3.
Die Untersuchung sogenannter Frauenbilder ist ein zentraler Untersuchungs- gegenstand feministischer Textinterpretation. Frauenbilder, die in einer patriarchalen Gesellschaft entstehen und geschaffen werden, sind zwangsweise deformiert, da sie auf Ungleichheit beruhen, auf „Andersartigkeit“4 und nicht aus sich selbst heraus entste hen können.
Bei vielen Frauenfiguren der Literatur ist ein Aufbegehren gegenüber gesellschaftlichen Hierarchien deutlich zu erkennen, die meist erst durch ein „zweites“, feministisches Lesen entcodiert werden können. Bei Irmgard Keuns Figur Anni ist dieses Aufbegehren eine Art Widerstand, der sich ausschließlich in „krank sein“ ausdrückt. Die hierbei auftretenden Symptome können nach Freuds Modell der Hysterikerin identifiziert werden, wobei Grund und Ursache nicht nach Freud in der sexuellen Verdrängung zu finden sind, sondern nach feministischen Deutungsmustern beurteilt werden.
3. Die Figurenkonstellation in Irmgard Keuns „Kind aller Länder“
In Irmgard Keuns Roman „Kind aller Länder“ werden die Hauptfiguren Vater und Mutter mit ganz klaren Ro llen belegt, die deutlich die bipolare Geschlechterordnung widerspiegeln. Die Figur des Vaters repräsentiert die patriarchale Gesellschaftsordnung, während die Figur der Mutter für das Private, das untergeordnete „Weibliche“ steht. Beide Figuren sind in ihren Rollen so festgeschrieben, dass ein Verlassen dieser unmöglich scheint. Im folgenden sollen die Figuren charakterisiert, in Bezug zueinander gesetzt und innerhalb der symbolischen Ordnung analysiert werden.
Innerhalb dieser dichotomen Konstellation kann die Position der Figur der 10-jährigen Kully als außerhalb dieser Ordnung gelesen werden. Ihre „außerordentliche“ Positionierung soll im Späteren aufgezeigt werden.
3.1 Der Vater als Repräsentant der patriarchalischen Ordnung
Die Figur des Vater ist innerhalb der symbolischen Ordnung als hierarchisch höher stehend eindeutig verortet. Dies wird durch die männlich konnotierten Verhaltensweisen deutlich, die Macht, Kultur und Öffentlichkeit miteinander vereinen. Der Vater wird als Schriftsteller innerhalb der Exilsituation, als Mensch des öffentlichen Lebens gezeichnet, in dieser Funktion kann er als Kulturträger gesehen werden, er beteiligt sich aktiv am politischen Geschehen. Er ist ein Teil der Öffentlichkeit, hat viele Freunde und Bekannte, die ihn in seiner Rolle stabilisieren und bestätigen.
Er wird unter anderem als „Meister“ betitelt, ständig in seiner Bedeutung bestärkt, denn „... so ein künstlerischer Geist muss durch die Ferne schweifen, Familienbande dürfen ihn nicht hemmen.“5
Seine Figur verfügt über eine uneingeschränkte Flexibilität und Beweglichkeit. Er wirkt kosmopolitisch, reist freiwillig von einem Land ins andere. „...er will immer fort.“6 Er wirkt heimatlos glücklich, er scheint seine Wurzel nicht geographisch verorten zu müssen, sondern sein Heimatbegriff ist emotional gebunden an seine Familie und geistig gebunden an sein künstlerisches Schaffen.
Er kann unter anderem so flexibel sein, da er finanziell unabhängig und allein für das finanzielle Wohlergehen der Familie zuständig ist. Hier kristallisiert sich deutlich das männlich konnotierte Ernährermodell heraus. Er benutzt dieses Modell um immer wieder seine familiäre und gesellschaftliche Machtposition zu stabilisieren und als Legitimation für seinen Freiheitsdrang. Dies funktioniert aber nur über die Abhängigkeit seiner Frau, die er immer wieder zurück in die passive Rolle drängt. Er ist der Meinung:
„Wenn man mit einer Frau lebt, soll man sie nicht für sich arbeiten lassen. Sie glaubt ja doch immer, sie bringe ein Opfer. Dann darf man nicht nervös werden, sichüber Fehlerärgern oder auch nur sachlich sein, sondern muss dankbar und gerührt tun, dazu habe ich keine Lust. Es ist mir schon lästig, wenn du mir einen Knopf annähst, Annchen, lieber lasse ich das vom Zimmermädchen machen.7
Aus Egoismus oder Abhängigkeitsangst hält er seine Frau in absoluter Untätigkeit, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, ihr danken zu müssen. Die Chance auf Unabhängigkeit eröffnet sich ihr erst gar nicht.
Im Gegensatz zu der autoritären Position, die er seiner Frau gegenüber einnimmt, repräsentiert er im öffentlichen Leben einen großzügigen und generösen Menschen. Er ist sehr auf Prestige und einen scheinbar luxuriösen Lebenswandel bedacht, er will „... besonderen Kaviar essen, eine besondere Flasche Champagner trinken...“8 Gerade in seiner instabilen finanziellen Situation, ist es unverständlich wie er hemmungslos seiner Genusssucht nachgeht. Dies wird auch deutlich in der Wahl teuerer Hotels und der ständigen Inanspruchnahme unnötiger Dienstleistungen.
„(...) aber mein Vater will immer ein richtiges Hotel, (...) wo Portiers sind, die ihm Briefe schreiben und befördern, (...)“9
Während er in der Öffentlichkeit den Lebemann, den Boheme mimt, können Frau und Kind sich oft täglich nur eine Mahlzeit leisten. Es gelingt ihm nicht ein Stück finanzielle Sicherheit für Frau und Kind zu schaffen. Natürlich darf hier die verschärfte Situation des Exils nicht ganz vergessen werden, die ihm nur einen bestimmten, abgesteckten Handlungsspielraum lässt. Trotzdem kann und will er nicht mit den wenigen finanziellen Mitteln wirtschaften, es macht den Eindruck, als ob er für den Moment lebt, ohne erreichbare Zukunft.
Durch die Charakteristik des Verhaltens der Vaterfigur wird sein Subjektstatus deutlich, besonders auch im Verhältnis zu seiner Frau, die er wie selbstverständlich zu seinem Besitz degradiert. Immer wieder verfügt er über Kind und Frau und setzt sie fast schmeichelnd mit Gegenständen gleich, Kully zitiert ihn:
„Wir bleiben als Pfand zurück, und mein Vater sagt: Wir hätten einen höhern Versatzwert als Diamanten und Pelze.“
Siehe Tabelle 1 im Anhang.
3.2 Die Mutter als Repräsentantin der untergeordneten weiblichen Rolle
- eine Figur mit Brüchen
Ebenso wie die Figur des Vaters, ist die Mutterfigur starr in ihre traditionelle Rolle gedrängt.
Die Assoziation von „Weiblichkeit“ mit Natur steht der Assoziation von „Männlichkeit“ mit Kultur gegenüber. In dem Roman „Kind aller Länder“ wird die Mutterfigur Anni immer wieder in Naturmetaphern eingebettet. Begriffe wie Sonne, Strand, Wasser Blumen, Vögel treten hauptsächlich in Zusammenhang mit Frauenfiguren auf, besonders deutlich wird dies bei der Protagonistin Anni, die lange Strandspaziergänge liebt und „(...) immer alle Blumen ansehen.“10 will. Selbst ihr Äußeres und ihre Persönlichkeit werden durch solche Metaphern beschrieben, sie „(...) zwitschert glücklich wie ein Vogel.“11, ihre Hand „(...) zittert leicht wie die Flossen von den kleinen Fischen.“12. Gerade auch diese Metaphern stärken das Bild einer instabilen Persönlichkeit.
In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder ihre Genügsamkeit deutlich, während ihr Mann auf Kaviar und Champagner besteht, reicht es ihr „frische Luft ein (zu) atmen“, sie meint ,„das sei fast so gesund wie Essen.“13 Im Gegensatz zu der männlichen, öffentlichen Figur repräsentiert sie das weiblich konnotierte Private. Sie lebt zurückgezogen, hat weder Freunde, noch Bekannte Die fast ausnahmslose Gesprächspartnerin hat sie in ihrer Tochter, einem zehnjährigen Kind. Nur einmal äußert sie den Wunsch, „auch unbedingt mal wieder mit einem erwachsenen Schriftsteller (zu) sprechen.“14 Gegenüber der Öffentlichkeit, die sich beim Vater unter anderem in der Bevorzugung großer Hotels äußert, bevorzugt sie das Private der „ kleinen Pension(en)“15 . Die einzige gesellschaftliche Anerkennung erhält sie über die Mutterrolle.
Anni kann nach der Beschreibung ihrer Tochter „sehr viel Wichtiges“16 , sie hat einige praktische Fähigkeiten, die den Haushalt betreffen, und die sie auch gerne tut, oder eher gerne tun würde, aber sie muss es vor ihrem Mann geheim halten, „der will sowas nicht“ 17. Kullys Vater hält also seine Frau in totaler Passivität, nicht die kleinsten Arbeiten darf sie verrichte n, sie erfährt keine Bestätigung ihrer Fähigkeiten, und schon gar keine Erfolgserlebnisse. Jegliche Bemühung Annis, an eine Arbeit zu kommen, wird von ihrem Mann verhindert, obwohl Anni „immer für ihn tippen will “18, was eigentlich eine Einsparung von Ausgaben wäre, lässt ihr Mann sie nicht, seine Meinung zu ihren Wünschen ist eindeutig, wie bereits oben gezeigt. Die Passivität und Schicksalsergebenheit von Anni wird immer wieder deutlich: Die erzwungene Passivität von Kullys Mutter betrifft nicht nur die Arbeit, sondern auch die Beziehung zu ihrem Mann, über den Kully bemerkt:
„Mein Vater hat manchmal Liebe für uns und manchmal hat er keine Liebe für uns. Da können wir gar nichts machen, meine Mutter und ich. Wenn er uns nicht lieb hat, nützt gar nichts. Wir dürfen dann nicht weinen bei ihm und nicht lachen, wir dürfen ihm nichts schenken aber auch nicht fortnehmen. (...) Wir müssen nur still sein und warten, dann ist alles gut. Uns bleibt auch nichts anderesübrig.“19 Es kommen mehrere Situationen vor, in denen Kullys Vater nur kurz etwas erledigen will und Stunden später erst zurückkommt, seine Ignoranz wird als selbstverständlich toleriert, er kommt betrunken und fröhlich zurück, nachdem Kully und ihre Mutter „am Fenster traurig eingeschlafen“20 waren.
Die Figur Anni wirkt durchgängig unsicher und instabil in ihrer Persönlichkeit, um sich sicherer zu fühlen muss sie sich schön fühlen, auch hier unterwirft sie sich, und zwar unter den herrschenden Schönheitsdiskurs.
„Vor dem Spiegel brennt sich meine Mutter die Haare, sie will links und rechts am Gesicht eine runde Locke haben, dann sieht sie schön aus. Wenn sie schön aussieht, hat sie mehr Mut durch die Hotelhalle zu gehen, mit anderen Leuten zu sprechen, (...)“21
Ihre Unsicherheit und emotionale Abhängigkeit manifestiert sich auch in der Konkurrenz im Umgang mit anderen Frauenfiguren.
„Meine Mutter wollte nicht, dass mein Vater Manja rostige Nägel schenkt, sie hat ihm gesagt, er solle seine drei rostigen Nägel fortwerfen.“22
Annis Eifersucht ist eng verknüpft mit der existentiellen Abhängigkeit von ihrem Mann. Eine Flucht aus dieser Situation scheint unmöglich.
Anni ist der Willkür ihres Mannes vollkommen ausgeliefert, entweder er liebt sie gerade, oder er tut es nicht, die Beziehung zwischen den beiden ist nicht auf Gleichheit und Gleichberechtigung aufgebaut, alles was Kullys Mutter tun kann oder tun darf, unterscheidet sich in keiner Weise von dem, was Kully als Kind tun kann. In vielen unterschiedlichen Situationen findet eine Gleichstellung von Frau und Kind statt. Anni wird von ihrem Mann zurecht gewiesen: „Ruhe, Kinder, Ruhe“ 23, er spricht sie durchgängig mit der Verniedlichungsform ihres Namens an, lässt sie nicht an grundlegenden Entscheidungen teilnehmen: „Wollte euchüberraschen Kinder“24 , er beleidigt und erniedrigt sie: „Wenn du nur nicht so hoffnungslos blöd wärst, Annchen“, setzt ihr eindeutig Grenzen und erklärt sie zu seinem Besitz: „Du weißt doch, dass du mir gehörst und niemanden sonst.“25 Anhand der Behandlung durch ihren Mann und der gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit dieses Zustands bleibt sie im Objektstatus gefangen.
3.3 Dichotomien so weit das Auge reicht...
Bei der Gegenüberstellung der beiden Charaktere ist ein deutlich dichotomes Muster zu erkennen. Innerhalb der symbolischen Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit sind sie in einem bipolaren System gefangen. Die Aktivität des Mannes steht der Passivität der Frau gegenüber, ebenso die Öffentlichkeit dem Privatem, die Kultur der Natur, die Macht der Ohnmacht und endet zwangsweise im Subjektstatus des Mannes und Objektstatus der Frau. Diese Reihe lässt sich beliebig fortführen schwarz - weiß, Mann - Frau, Tag - Nacht um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Dichotomien sind Grundlage der Zweigeschlechtlichkeit und produzieren und stabilisieren die symbolische Ordnung. Ohne sie wären Machtverhältnisse generell nicht denkbar, besonders deutlich wird dies in der Hierarchie der Geschlechterordnung.
4. Freud und die Hysterie
4.1 Krankheit als „unordentlicher AusBruch“
Die Figur des Vaters ist durchgängig ungebrochen und stabil, während die Figur der Mutter Brüche aufweist. Diese Brüche können auch als Ausbruch aus ihrer untergeordneten Rolle und als Widerstand gegenüber der ständigen Fremdbestimmung ihres Seins gelesen werden.
Auf Seite 91 leitet Kully die Beschreibung des Verhaltens ihrer Mutter mit „Etwas Schreckliches ist passiert“ ein, es folgt die Beschreibung eines Ausbruches der Mutter, der vollkommen abweicht von ihrem sonstigen Verhalten. Dieser Ausbruch kann anhand des Modells der Hysterikerin von Freud und Breuer interpretiert werden, was im Folgenden gezeigt werden soll.
4.2 Symptome und Symptomatik
In „Studien zur Hysterie“26 beschrieben Breuer und Freud die Dauersymptome der Hysterie und hysterische Anfälle. Dazu verwendeten sie „eine von Charcot gegebene schematische Beschreibung des „großen“ hysterischen Anfalles, welcher zufolge ein vollständiger Anfall vier Phasen erkennen lässt: 1. die epileptoide, 2. die der großen Bewegungen, 3. die der attitudes passionelles (die halluzinatorische Phase), 4. die des abschließenden Deliriums.“27
Die erste Phase bezeichnete Charcot als die der epileptoiden Zuckungen, die unter Bewusstseinsverlust mit tetanischer Unbeweglichkeit (Stockung der Atmung, Muskelkrämpfen) begannen und langsam in große Gliederbewegungen übergingen. In der zweiten Phase wechselten die „grands mouvements“ (großen Bewegungen) mit einer eigentümlichen Starrheit. Die Phase der großen Bewegungen war insgesamt durch die absonderlichsten Körperverrenkungen und durch das Herumschleudern einzelner Glieder wie des ganzen Körpers charakterisiert. Dabei gestikulierten, schrien und schimpften, wälzten und schlugen sich die Kranken,entblößten sich bisweilen und führten Grußbewegungen aus.Die dritte Phase die der „attitudes passionelles“ (der leidenschaftlichen Gebärden), umfasste die visionären Halluzinationen. Auch bekundete die Kranke in dieser Periode Gesten der Drohung, des Anrufs, heftigster Abneigung und des Spottes. In der letzten Phase der des Deliriums halluzinierte die Hysterikerin zeitweise auch imaginäre Tiergestalten wie Schlangen, Mäuse und Kröten, um im Anschluss daran in tiefe Erschöpfung und Schlaf zu fallen.28
4.3 ...am Beispiel Anni
Im Roman wird bereits auf Seite 23 eine Szene beschrieben, die mit der ersten Phase, die der epileptoiden Zuckungen verglichen werden kann.
Die Mutter wird von Kully beschrieben, „als habe sie lange im Regen gesessen: Ihre traurigen Augen waren starr. Sie hob langsam die Hand hoch und wollte die Luft anfassen, doch die Hand fiel ihr wieder schwer in den Schoß“29. Kully will Kontakt mit ihr aufnehmen, aber ihre Mutter „hat es nicht bemerkt“30.
Bewusstseinsverlust und Unbeweglichkeit werden in dieser Szene deutlich, auch Muskelkrämpfe, die langsam in große Gliederbewegungen übergehen sind hier zu finden, wie Annis Hand, die in die Luft geht, scheinbar ohne Motivation. Breuer schreibt: „ Es gibt aber auch Anfälle die anscheinend nur aus motorischen Phänomenen bestehen, denen eine phase passionelle fehlt“.
Die Szene die Kully auf Seite 23 beschreibt kann als ein solcher Anfall gelesen werden, er kann aber auch Vorbote für den kommenden Anfall der sich in seiner ganzen Dimension auf Seite 91 zeigt, gedeutet werden.
Der Beginn dieses Anfalls weist deutliche Parallelen zur zweiten Phase auf, Kully beschreibt die Situation wie folgt: „Sie sprach ganz schnell und heißund wild (...) Sie flog an die Wand zum Telephon,...“ Die Symptome der zweiten Phase werden hier vollständig aufgezeigt. Angefangen von absonderlichsten Körperverrenkungen über das Herumschleudern einzelner Glieder usw.
Die darauf folgende Szene kann mit der dritten Phase verglichen werden, in der Zornesausbrüche und Drohungen, Gesten der Abneigung und des Spottes
vorkommen, „..sie telefonierte mit allen Leuten, die wir kennen, und war böse zu ihnen, ihre Augen wurden immer größer und schwärzer Sie hat auf alle Klingelknöpfe im Zimmer gedrückt, das Zimmermädchen angeschrien, auch den Kellner.“(...)„Sie wollte sterben, dann hat sie wieder telefoniert und geschrien“(...)„Ihre Lippen zitterten, ihre Augen wurden immer wütender.“
Hinzu kommt hier ein weiteres Kriterium eines Hysterieanfalls, nämlich die Publikums-Abhängigkeit31. Anni bezieht die Aussenwelt ein, indem sie mit allen Leuten telefoniert oder auch das Personal anschreit, was für ihr sonstiges Verhalten absolut untypisch erscheint.
In der letzten Phase des Deliriums werden Halluzinationen von imaginären Tiergestalten, wie Schlangen, Mäusen und Kröten beschrieben: „Sie dachte, meine Meerschweinchen seien Ratten, erklären ließsie sich nichts.“, um danach in tiefen Schlaf zu fallen, danach „fiel (sie) auf das Bett und schlief sofort ein“. Die klassischen Symptome eines hysterischen Anfalls werden von der Figur Anni aufgezeigt. Auch sonst lassen sich einige Parallelen zu der wohl berühmtesten Hysteriepatientin Anna O. die maßgeblich an den „Studien zur Hysterie“ beteiligt war, ziehen. Abgesehen von der Namensgleichheit, die eher zufällig aber in diesem Zusammenhang fast grotesk wirkt, verfügt die Figur Anni wie auch Anna O. über „ein(en) kräftigen Intellekt, der auch solide geistige Nahrung verdaut hätte und sie brauchte, nach Verlassen der Schule aber nicht erhielt“.32 Auch verweigern beide Frauenfiguren eine normale, gesunde Nahrungszufuhr. Während Anna O. zeitweise vollständig die Nahrung verweigerte, finden wir einen ähnlichen Umgang auch bei Anni. Sie verzichtet auch oft zugunsten i hrer Tochter Kully, wobei dieser Verzicht auch als Verweigerung gelesen werden kann.
Die „Ausbrüche“ Annis stehen isoliert zu ihrem sonstigen Leben. Freud schreibt:
„Anfall und normales Leben gehen nebeneinander her, ohne einander zu beeinflussen“.33 Diese Erkenntnis scheint auch auf die Figur Anni zu zutreffen, Kully beschreibt die Situation nach dem „Anfall“ wie folgt: „Als meine Mutter aufwachte, war sie gesund. Ihre Augen waren wieder weich und blau, ihre Stimme flog wie ein weicher leiser Wind durch das Zimmer“.34
Während die ersten beiden „Ausbrüche“ Annis in Bezug auf ihre Rolle und auf das Geschehen erfolg - und konsequenzlos bleiben, gelingt es ihr beim dritten und letzten wirklich „auszubrechen“. Auslöser hierfür ist die bevorstehende Reise nach Amerika.
Nachdem sie das erste Mal ihre Sehnsüchte und Wünsche erfüllt gesehen hat in einer eigenen Wohnung und einem eigenem Herd, was gleichbedeutend für sie mit Heimat und einer Chance auf Selbstbestimmung gelesen werden kann, Kully hatte „sie noch nie so glücklich gesehen “35, wird ihr diese Hoffnung von ihrem Mann sofort wieder zerstört. Er bestimmt nach Amerika zu reisen, das lang Ersehnte aufzugeben, obwohl Anni Amerika hasste und „überhaupt keine Lust (hatte) hinzufahren.“36 Ihr Widerstand beginnt mit körperlichen Reaktionen wie Müdigkeit, Brechreiz und Kraftlosigkeit. „Mein Vater brachte meine Mutter in ein Hotel am Bahnhof und legte sie in ein Bett und deckte sie zu“37. Anni vollzieht an dieser Stelle den endgültigen hysterischen Ausbruch, entgegen ihres sonstigen Verantwortungsgefühls ihrer Tochter gegenüber, sie verschläft die Verabredung und entzieht sich damit für diesen Moment der Fremdbestimmung. Da „Verschlafen“ als aktive Handlung gesehen werden kann, handelt sie in dieser Situation das erstemal selbstbestimmt.
„Das griechische Wort hystero heißt ich komme zu spät, ich säume, ich erreiche nicht, ich lasse vorbei. Damit ist der Mechanismus der hysterischen Verweigerung plastisch umschrieben, wie auch ihre Funktion“38
5. Verschiedene Positionen zur Hysterikerin
5.1 Die Theorien von Freud und Breuer
Den Ursprung einer hysterischen Erkrankung bildet nach Freud / Breuer eine heftige emotionale Erschütterung, ein psychisches Trauma. Die Hysterikerin wird von quälenden Erinnerungen geplagt, die ihr nicht mehr präsent sind, sondern die sie verdrängt. Zur hysterischen Symptombildung kommt es dann, wenn ein Erlebnis eine starke Gefühlregung hervorruft, die das Ich nicht zulassen kann, Grund dafür ist ein innerer Widerspruch, der das Ich Einspruch erheben lässt, gegen die eigenen Gefühle.
Diese Gefühle sind für Breuer / Freud fast ausschließlich sexueller Natur, ihrer Meinung nach verschafft sich die Hysterikerin durch einen Anfall die Möglichkeit, sexuelle Wünsche, Machtphantasien und Aggressionen auszuleben, die in einer „normalen“ weiblichen Existenz tabu sind.
Die besondere Affinität der Hysterie zur Weiblichkeit, die Freud zunächst auf einen schwächeren weiblichen Sexualtrieb oder eine spezifisch weibliche Bevorzugung der passiven Rolle bezogen hatte, wurde von ihm später geradezu von deren Gegenteil: Aggression und Aktivität, abgeleitet, die allerdings als Kennzeichen einer männlichen Triebkonstellation verstanden werden39
Die Hysterie wird konstruiert als ein unpraktischer Rückfall in ein Zeitalter, in dem das kleine Mädchen ein „kleiner Mann“ gewesen sei. Dies wird auf die Sexualbetätigung des Knaben zurückgeführt, die als aktiv und phallisch gekennzeichnet ist. Unter dem Alibi der Krankheit kann sich die Frau zu dem machen und das ausleben, was ihr aufgrund ihrer „Weiblichkeit“ versagt bleibt. Bei Freud / Breuer wird die gesellschaftliche Rechtfertigung dieser Unterdrückung qua Geschlecht nicht in Frage gestellt.
5.2 Feministische Positionen zur Hysterikerin
Die feministische Wissenschaftlerin Gabriele Sobiech sieht in der Krankheit Hysterie einen Kampf, einen Aufstand, einen Widerstand. Sie konstatiert: „ Die Mutterschaft als Inbegriff einer auf Fortpflanzung ausgerichteten Sexualität wird den Frauen als Selbstverwirklichung nicht nur angeboten, sondern als Normalität aufgezwungen. Genau gegen diese Form der Sexualität begehrt die Hysterikerin auf, sie kämpft gegen eine Verwechslung von„weiblichem“Begehren mit der mütterlichen Funktion.“40
Sobiech identifiziert die Hysterikerin mit einer Kämpferin, die gegen die Vernichtung der Frau als Sexualwesen vorgeht. Das Symptom der Hysterie ist ein Widerstand gegen die Gleichsetzung der „weiblichen“ Sexualität mit Fortpflanzung Harriet G. Lerner ist „ der Meinung, dass die Theorien der Libidoentwicklung für die (Erklärung der Geschlechtsunterschiede in bezug auf die) Hysterie nicht ausreichen und dass soziale und kulturelle Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Die Bedeutung dieser extrapsychologischen Faktoren wurde weder wirklich anerkannt noch völlig ignoriert“ 41 In ihrem Buch will Lerner „zeigen, dass die Einschränkungen der Ich-Entwicklung, die mit dem weiblichen Sozialisationsprozeßeinhergehen, allzu leicht mit den Folgen massiver Verdrängung (in bezug auf Sexualität) verwechselt werden“ 42, jedoch nimmt sie auch Bezug auf die genannte Verdrängung, allerdings zu Gunsten der folgende Argumentationsstruktur, sie konstatiert, „dass die weibliche Sozialisation zu einem Wahrnehmungs- und Persönlichkeitsstil führt, dessen beobachtbare Folgen sich wenig von den Folgen der Verdrängung unterscheiden.“ 43
Die Ursachen der Hysterie liegen für feministische WissenschaftlerInnen in der gesellschaftlichen Ordnung, die Frauen unterdrückt.
Nach Lindhoff entspringt das hysterische Leiden einer Unfähigkeit, sich in die weibliche Rolle einzufügen und ist zugleich eine Übererfüllung dieser Rolle.44
Feministinnen können die weibliche Rollenzuweisung nur als Unterdrückungsmechanismus erkennen und sehen somit in der hysterischen Erscheinung einen Widerstand. Die Hysterie „ ist eine unfreiwillige Parodie, eine Karikatur der„normalen“weiblichen Existenz. Sie lässt das Künstliche, Gewaltsame, Krankhafte der weiblichen Rollenzuweisung sichtbar werden, das die patriarchalische Ordnung hinter dem Anschein von Natur zu verbergen trachtet“.45
Die Sprache der Hysterie kann als die berühmteste Artikulation des weiblichen Unbehagens an der patriarchalen Kultur gelesen werden, diese These findet sich in der Lektüre unterschiedlichster feministischer Literatur zur Hysterie wieder. Im Gegensatz zu Freud, der die weibliche Hysterie nur auf das (verdrängte) Sexuelle der Frau zurückführt, sehen Feministinnen dieses Phänomen als Ausdruck der soziokulturell erzeugten patriarchalen Ordnung, die Frauen unterdrückt. Nicht nur konstruktivistische Ansätze, sondern auch essentialistische gehen von einem Aufbegehren gegen Verletzungen, Unterdrückungen und Diskriminierungen aus. Hier kann die Figur der Anni angesiedelt werden. Sie schafft es nicht, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu artikulieren. Ihr Aufbegehren richtet sich gegen die Fremdbestimmung, als es ihr nur kurz gewährt wird, glücklich wie nie zuvor... zu sein. Dinge, die für sie sehr großen Wert zu haben scheinen, wie ein Stück Heimat, das sich in der eigenen kleinen Wohnung spiegelt oder auch die Möglichkeit einer Erweiterung ihrer Rolle, werden von ihrem Mann rücksichtslos zerstört und ignoriert.
Als er ihre Traurigkeit darüber spürt, setzt er sie sogar noch zusätzlich unter moralischen Druck indem er an ihr Gewissen appelliert:
„Annchen, du wirst mir doch nicht einen der wenigen glücklichen Abende meines Lebens verderben wollen! Komm, küßmich Kully, freust du dich auf Amerika?“46
Hysterie wird von Literaturwissenschaftlerin Lilo Weber als „verschobene Sprache“ des Körpers derer gedeutet, die zum Verstummen gebracht werden sollten, des weiteren untersucht sie Diskurse der „Hysterie als Revolte, Hysterie als kulturelles Deutungsmuster, Aufbegehren im kulturellen Deutungsmuster“, wodurch sie Frauenfiguren der Literatur in Angepasste, die sich raffiniert mit den Verhältnissen arrangieren und solche unterteilt, die verzweifelte Versuche unternehmen sich gegen männliche Bilder aufzulehnen, um zu ihrer eigenen Identität zu finden. Anni ist eine der literarischen Figuren, die versucht, sich angepasst an ihre Rollenzuweisung zu verhalten, sie versucht, die ihr zugewiesenen Passivität zu akzeptieren, und ihre einzige Aufgabe, die Fürsorge für ihr Kind zu erfüllen. Anni hat keine Chance, außer über ihre Mutterrolle, eine Identifikation zu vollziehen, ihre einzige Möglichkeit, eine Subjektwerdung zu bilden, ist die Sorge für Kully, deren Selbständigkeit eigentlich die der Mutter übertrifft, was ja eigentlich heißt, dass nicht einmal diese Aufgabe wirklich eine Herausforderung für sie darstellt. Breuer hatte ja bereits schon an seinen Patientinnen feststellen können, dass eine Neigung zur Hysterie gerade bei solchen Frauen ausgeprägt zu sein scheint, deren Intellekt „ auch solide geistige Nahrung verdaut hätte und sie brauchte, nach Verlassen der Schule aber nicht erhielt “.47 Anni hat nicht einmal die gängige Grundschulausbildung genießen können, denn, „als sie zur Schule kam, war Krieg. Da haben die Kinder hauptsächlich gelernt, bei Fliegergefahr in geschlossenem Zug in den Keller zu gehen und Feldpostpakete zu packen und für Kriegsopfer zu sammeln. Sonst hatten sie fast immer frei, weil ein Sieg war, oder weil es keine Kohlen gab, oder weil alle Leute Grippe hatten.“ 48
Anni, ein Mensch, der Talente, Fähigkeiten und Interessen hat, dem aber nie die Möglichkeit gegeben wurde, sich zu bilden, wird zur Untätigkeit und zur geistigen Resignation gezwungen. Ihre „Daseinsberechtigung“ wird schlichtweg auf ihre Mutterrolle und auf die Rolle der wartenden Ehefrau reduziert.
Ein verheerender Umstand für ein Ich, für die Bildung und Entwicklung einer Persönlichkeit. Anni kann Identität nur über diese Funktionen ihrer Person definieren, damit dies aber ohne Brüche vonstatten gehen kann, müsste sie sich mit ihrer Mutterrolle und der damit verbundenen „weiblichen“ Passivität widerstandslos identifizieren.
Da Identifikation mit und Einfügen in bestimmte Rollennormen für die Subjektbildung und Ich-Werdung eine zentrale Rolle spielen, wird das also zum Problem der Hysterikerin und somit auch zum Problem der Figur Anni.
Christina von Braun beschreibt die Hysterie als die „Krankheit der Ichlosigkeit“, sowie auch Lena Lindhoff, die die Ursache der Hysterie hauptsächlich im Objektstatus ansiedelt.
„Die hysterische Mimeseis bezeugt den unentwegten Versuch, Ich zu werden, Eigenschaften zu haben.“49
„Auf diese Weise kämpft die Hysterikerin nicht nur für das Geschlechtswesen„Frau“, sondern verwirrt Normen und Gesetze, bringt Unordnung in die herkömmliche Rollenteilung von‚männlichem’Individuum und‚weiblichem’Gattungswesen und den diesen Konzepten unterlegten Subjekt- und Objektformierungen. Statt schwach, passiv und abhängig zu sein, manipulieren die Hysterikerinnen ihre Umwelt selbst und‚verwandeln ihre eigene Ohnmacht in die Ohnmacht der anderen’“.50
Das Thema Hysterie beschäftig Feministinnen schon lange, da gerade dieses Thema immer wieder benutzt wurde, um Protest von Frauen zu diskreditieren, dieser Protest kann ein politischer ebenso wie privater sein. Nach Freuds Muster, wird jede Form weiblicher Frustration sexuell gedeutet, der Erfahrungsaustausch von Frauen als „hysterisches Geständnis“ gebrandmarkt.
Seit 1970 wird die Hysterie von Feministinnen allerdings zu eigenen Zwecken gebraucht. „Zum Teil halten sie (Feministinnen) Hysterie sogar für den allerersten Schritt auf dem Weg zum Feminismus, für ein Zeichen weiblichen Protestes gegen das Patriarchat. Damitübernahm die Hysterie‚die Rolle eines Art rudimentären Feminismus und Feminismus die Rolle einer Art beredter Hysterie’.Aber wenn die epidemische Hysterie ein Extrem des Feminismus darstellt, eine Körpersprache des weiblichen Aufbegehrens gegen die patriarchalische Unterdrückung, ist ihre Form doch verzweifelt und letzten Endes selbstzerstörerisch.51
6. Kully als „Synthese“ zwischen Vater und Mutter
Die Figur Kully nimmt in dem Roman: „Kind aller Länder“ eine ganz spezielle Rolle ein, die zum einen durch die Perspektive der Ich-Erzählerin und zum anderen durch ihren Kindstatus produziert wird. Diese besondere Erzählperspektive ermöglicht es ihr sich innerhalb, sowie außerhalb des Geschehens zu positionieren. Sie wirkt innerhalb des Beziehungsgeflechts ebenso involviert wie distanziert. In Bezug auf die bisher diskutierte Metaebene der Geschlechterhierarchien lässt sich die Figur Kully nicht eindeutig verorten und kann somit außerhalb der gesellschaftlich festgelegten Geschlechterrollen angesiedelt werden. Sie ist aufgrund ihres Kindseins bestimmten Machtmechanismen unterworfen, allerdings findet keinerlei Einschränkung aufgrund ihrer „Weiblichkeit“ statt.
Im folgenden soll die bereits oben angewandte Folie zur Charakteristik verwendet werden, um die Figur Kully dem Raster der weiblich, sowie männlich konnotierten Rollenaufteilung gegenüber zu stellen.
Während sich Vater und Mutter in eindeutig dichotomen Mustern bewegen, ist die Figur Kully so angelegt, dass sie die passiv konnotiert weibliche Rolle ebenso negiert wie die hierarchisch höher stehende männliche Rolle, feministisch gelesen ist sie die einzige Figur die sich den gesellschaftlichen Zwängen nicht unhinterfragt unterwirft und versucht ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Kully kann leicht auf Fremde zugehen, genießt aber auch das familiäre Zusammenleben, es gelingt ihr, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Privatem und Öffentlichkeit herzustellen.
Sie versucht aktiv am Geschehen teilzunehmen, ist verantwortungsbewusst sich selbst und anderen gegenüber. Dies wird deutlich, dadurch das sie sich ständig existentielle Gedanken über das finanzielle Auskommen der Familie macht.
„Ich habe mirüberlegt, dass ich vielleicht aus Zigarettenschachteln Lesezeichen kleben und auf der Straße verkaufen kann.“52
Sogar ihre Meerschweinchen werden in ihre Gedanken um finanzielle Sicherheit eingebaut:
„Dann habe ich eines Tages hundert Meerschweinchen, davon kann ich welche verkaufen. Wir werden endlich Geld haben.“53
Hier findet eine eindeutige Identifikation mit dem „männlichen“ Ernährermodell statt, im Gegensatz zu der Identifikation mit der gesellschaftlich anerkannten weiblichen Abhängigkeit.
Die Figur hat ein sicheres Auftreten, argumentiert, diskutiert, sie wehrt sich, wenn ihre Grenzen nicht eingehalten werden. Auf das Angebot des Vogelnestes:
„Geben Sie sie mir, und ich werde aus dem wilden kleinen Knösplein die schönste Mädchenblüte entwickeln“, a ntwortet Kully: „Ich will aber(...) nicht entwickelt werden.“54
Sie wehrt sich ebenso dagegen, in die weibliche Rolle gedrängt zu werden, wie gegen eine Fremdbestimmung, sie entdeckt und entwickelt eigenständig ihre Persönlichkeit.
Kully registriert sofort, wenn ihre Grenzen nicht eingehalten werden und geht im Gegensatz zu ihrer Mutter vehement dagegen vor: „Meine Mutter hat geweint, ich habe geschrien.“55
Durch die klare Definition ihrer Grenzen und die Äußerung ihre Bedürfnisse stabilisiert sie ihre Persönlichkeit. Kullys Selbst- und Gerechtigkeitsbewusstsein macht keinen Halt vor Machtmechanismen, weder in Bezug auf Geschlechterhierarchien, noch in Bezug auf die schwer antastbare Kind- Erwachsenen Hierarchie, was im folgenden Textbeispiel besonders deutlich wird.
„die Kinder (...) haben an meinen Haaren gerissen. Ich habe ganz ruhig gesagt, wenn sie es noch einmal tun würden, müsste ich mein großes Taschenmesser nehmen und sie totstechen. Die Kinder zogen mich nicht mehr an den Haaren, darum habe ich sie leben lassen. Später wollte ihr Vater mich schlagen, da habe ich gesagt, er solle es nicht tun, sonst würde ich ihn auch totstechen“56 Das Ergebnis der Charakteranalyse der Figur Kully zeigt, dass sich diese nicht in die gesellschaftliche Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit und nicht in deren inhärente Hierarchien drängen lässt.
Im Gegensatz zu ihrer Mutter muss Kully sich nicht in eine „Krankheit“ flüchten, um sich gegen den weiblichen Objektstatus zu wehren, ihr Aufbegehren gegen die patriarchale Unterdrückung muss bei ihr nicht selbstzerstörerisch sein, da ihre gesamte Entwicklung eindeutig auf ein selbstbestimmtes Sein hinweist
7. Schluss
Die Arbeit zeigt deutlich wie sich das gesellschaftlich konstruierte Geschlechter- verhältnis in der Literatur niederschlägt. Die Thematik der außerordentlichen Exilsituation in dem Roman „Kind aller Länder“ überdeckt scheinbar familiäre Machtverhältnisse, die auf gesellschaftlichen bipolaren Rollenzuweisungen beruhen. Nur durch eine feministische Lesart ist eine Entcodierung dieser Rollenbilder möglich. Die Einordnung der weiblichen Protagonistinnen in dieses System verläuft nicht bruchlos, wobei die beiden besprochenen Frauenfiguren unterschiedliche Wege wählen. Während sich die Mutterfigur in die Hysterie flüchtet, schafft es die Tochterfigur sich aktiv der weiblich konnotierte Rolle zu widersetzen. Auch hier scheint dies begünstigt durch die extreme Exilsituation, die ihr ermöglicht sich auf ihre eigenen Stärken zu besinnen und eine eigene Persönlichkeit aufzubauen.
8. Anhang
Die ersten beiden Tabellen zeigen noch einmal in komprimierter Form die Charaktereigenschaften der zwei ProtagonistInnen.
Tabelle 1 Charakteristik der Mutterfigur:
Verhalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2 Charakteristik der Vaterfigur
Verhalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3 Gegenüberstellung von Vater- und Mutterfigur
Durch die systematische Darstellung wird das dichotome Muster der Elternfiguren deutlich, ebenso ihre gesellschaftliche Positionierung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9. Bibliographie
1 Beauvoir, Simone de. Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Reinbek bei Hamburg.1968
Freud, Sigmund. Studien über Hysterie. GW. Bd.1, 1895. S.75-312
Freud, Sigmund. Bruchstücke einer Hysterieanalyse. GW. Bd.13, 1905. S.1-69
Keun, Irmgard. Kind aller Länder. claasen Verlag GmbH, Düsseldorf 1981 Erstveröffentlichung 1938
Koch-Klenske. Weibsgedanken. Bielefeld 1989 S.41
Lerner, Harriet G. Das mißdeutete Geschlecht. Falsche Bilder der Weiblichkeit in Psychoanalyse und Therapie. Frankfurt am Main 1993
Lindhoff, Lena. Einführung in die feministische Literaturtheorie. Stuttgart 1995
Osinski, Jutta. Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. Berlin 1998
Schaps, Regina. Hysterie und Weiblichkeit: Wissenschaftsmythen über die Frau. Frankfurt am Main 1982
Schlesier, Renate. Mythos und Weiblichkeit bei Freud. Frankfurt am Main 1990
Sobiech, Gabriele. Grenzüberschreitungen. Körperstrategien von Frauen in modernen Gesellschaften. Opladen 1994 S. 32-48
Showalter, Elaine. Hysterische Epedemien im Zeitalter der Medien, Berlin 1999
[...]
1 Keun, Irmgard. Kind aller Länder.
2 Foucault, Michel. Sexualität und Wahrheit.
3 Nünning S.139
4 Beauvoir, Simone de. Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. 4
5 KaL. S.42
6 Ebd. S.80
7 KaL S.22
8 ebd. S.13
9 ebd. S.21
10 KaL S.34
11 ebd. S.110
12 ebd. S.102
13 ebd S.34
14 ebd. S.44
15 ebd. S.21
16 ebd S.34
17 ebd. S.34
18 KaL S. 21
19 ebd. S.24
20 ebd. S.29
21 ebd.S.45
22 ebd. S.80
23 KaL. S.100
24 ebd. S.161
25 ebd. S.112
26 Studien zur Hysterie: Freud/Breuer
27 ebd. S.37
28 aus Schaps S.58,59
29 KAL, S.23
30 ebd.
31 ebd. S.64
32 Studien zur Hysterie: Freud/Breuer S.42
33 ebd. S.94
34 KaL S.94
35 KAL S.160
36 KAL S.164
37 KaL S.164
38 Koch-Klenske. Weibsgedanken. S.41
39 Schlesier, Renate. Mythos und Weiblichkeit bei Freud. S.67
40 Sobiech. S. 44
41 Lerner, Harriet G. Das mißdeutete Geschlecht. S.69
42 ebd. S.70
43 ebd. S.77
44 Lindhoff, Lena. Einführung in die feministische Literaturtheorie. S.154
45 ebd. S.154
46 KaL S.163
47 Schlesier. S. 46
48 KaL S. 33
49 Lindhoff, Lena. Einführung in die feministische Literaturtheorie. S. 155
50 Sobiech, Gabriele. Grenzüberschreitungen. Körperstrategien von Frauen in modernen Gesellschaften zitiert nach Christina v. Braun S.45
51 Showalter, Elaine. Hysterische Epedemien im Zeitalter der Medien.
52 KaL S.106
53 KaL S.90
54 KaL S.41
55 ebd. S.32
Häufig gestellte Fragen zu "Kind aller Länder"
Worum geht es in der Arbeit zu "Kind aller Länder"?
Die Arbeit beschäftigt sich mit Irmgard Keuns Roman „Kind aller Länder“ (1938). Sie analysiert das Verhalten der drei Protagonisten (Vater, Mutter, Tochter Kully) innerhalb und außerhalb geschlechtsspezifischer Rollenbilder, basierend auf der patriarchalen Gesellschaftsordnung. Feministische Theorie und Psychoanalyse dienen als Grundlage zur Aufdeckung von Unterdrückungsmechanismen und Rollenzuweisungen.
Welche Rolle spielt der Feminismus in der Analyse?
Feministische Theorie wird genutzt, um die Diskriminierung von Frauen zu untersuchen und soziokulturelle Konstruktionen von Weiblichkeit und Männlichkeit aufzudecken. Der Roman wird daraufhin untersucht, inwiefern Rollenzuweisungen Brüche aufweisen und insbesondere Frauenfiguren Widerstand leisten.
Wie wird die Psychoanalyse in die Analyse integriert?
Die Arbeit verknüpft Literaturwissenschaft mit Psychoanalyse, um die Anpassung und den Widerstand gegen weibliche Rollennormen aufzudecken. Die Symptome der Mutterfigur (Anni) werden anhand von Freuds Modell der Hysterikerin interpretiert, wobei die Ursachen nicht in sexueller Verdrängung, sondern in feministischen Deutungsmustern gesehen werden.
Welche Rollen nehmen Vater und Mutter in dem Roman ein?
Der Vater repräsentiert die patriarchale Gesellschaftsordnung mit männlich konnotierten Verhaltensweisen wie Macht, Kultur und Öffentlichkeit. Die Mutter steht für das Private und die untergeordnete "weibliche" Rolle. Beide Figuren sind zunächst starr in ihren Rollen verankert.
Wie wird die Figur der Mutter (Anni) charakterisiert?
Die Mutterfigur ist in ihrer traditionellen Rolle gefangen, die mit Natur assoziiert wird. Sie lebt zurückgezogen, ist finanziell abhängig und wird von ihrem Mann in Passivität gehalten. Sie zeigt Symptome, die an Hysterie erinnern.
Was sind die Symptome der Hysterie, die bei Anni beobachtet werden?
Anni zeigt Anzeichen von epileptoiden Zuckungen, Bewusstseinsverlust, Unbeweglichkeit, Muskelkrämpfen, absonderlichen Körperverrenkungen, Wutausbrüchen, Drohungen und Halluzinationen von Tiergestalten.
Wie wird die Hysterie in dieser Arbeit interpretiert?
Im Gegensatz zu Freuds Interpretation, die Hysterie auf sexuelle Verdrängung zurückführt, sehen feministische Ansätze sie als Widerstand gegen gesellschaftliche Unterdrückung und die Vernichtung der Frau als Sexualwesen.
Welche Rolle spielt die Figur Kully?
Kully nimmt eine Sonderstellung ein, da sie als Ich-Erzählerin und Kind sowohl involviert als auch distanziert ist. Sie steht außerhalb der gesellschaftlich festgelegten Geschlechterrollen und ist aufgrund ihres Kindseins zwar bestimmten Machtmechanismen unterworfen, erfährt aber keine Einschränkung aufgrund ihrer "Weiblichkeit".
Wie wird Kully im Vergleich zu ihren Eltern charakterisiert?
Im Gegensatz zu den dichotomen Mustern von Vater und Mutter negiert Kully sowohl die passiv konnotiert weibliche als auch die hierarchisch höher stehende männliche Rolle. Sie unterwirft sich nicht unhinterfragt den gesellschaftlichen Zwängen und versucht, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Wie wird die Schlussfolgerung der Arbeit formuliert?
Die Arbeit zeigt, wie sich das gesellschaftlich konstruierte Geschlechterverhältnis in der Literatur widerspiegelt. Die Protagonistinnen wählen unterschiedliche Wege: Die Mutter flüchtet sich in die Hysterie, während die Tochter sich aktiv der weiblich konnotierten Rolle widersetzt. Die extreme Exilsituation begünstigt, dass Kully sich auf ihre eigenen Stärken besinnt und eine eigene Persönlichkeit aufbaut.
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die Hauptthemen der Arbeit sind Geschlechterrollen, Feminismus, Psychoanalyse, Hysterie, Machtverhältnisse, Gesellschaftsordnung und Widerstand.
Was ist das Ziel der feministischen Lesart?
Das Ziel der feministischen Lesart ist es, die Diskriminierung von Frauen aufzudecken und die Mechanismen zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern beitragen. Es geht darum, die sozialen und kulturellen Konstruktionen von "Weiblichkeit" und "Männlichkeit" zu hinterfragen und aufzudecken.
- Citar trabajo
- Sandra Zeiher (Autor), Lena Eckert (Autor), 2000, Hysterie als Ort des stillen Widerstands, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102137