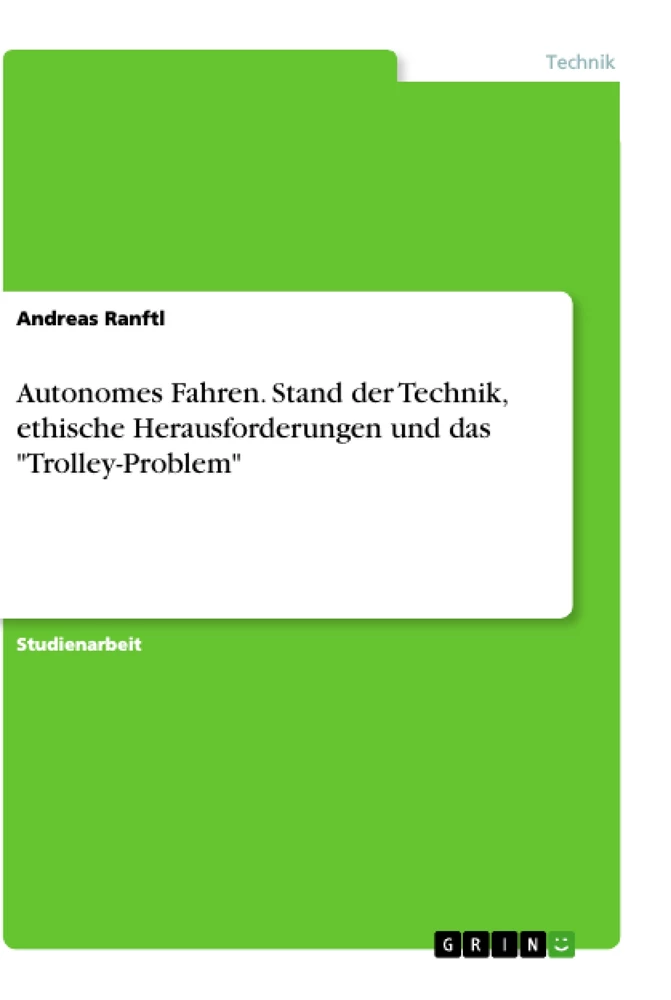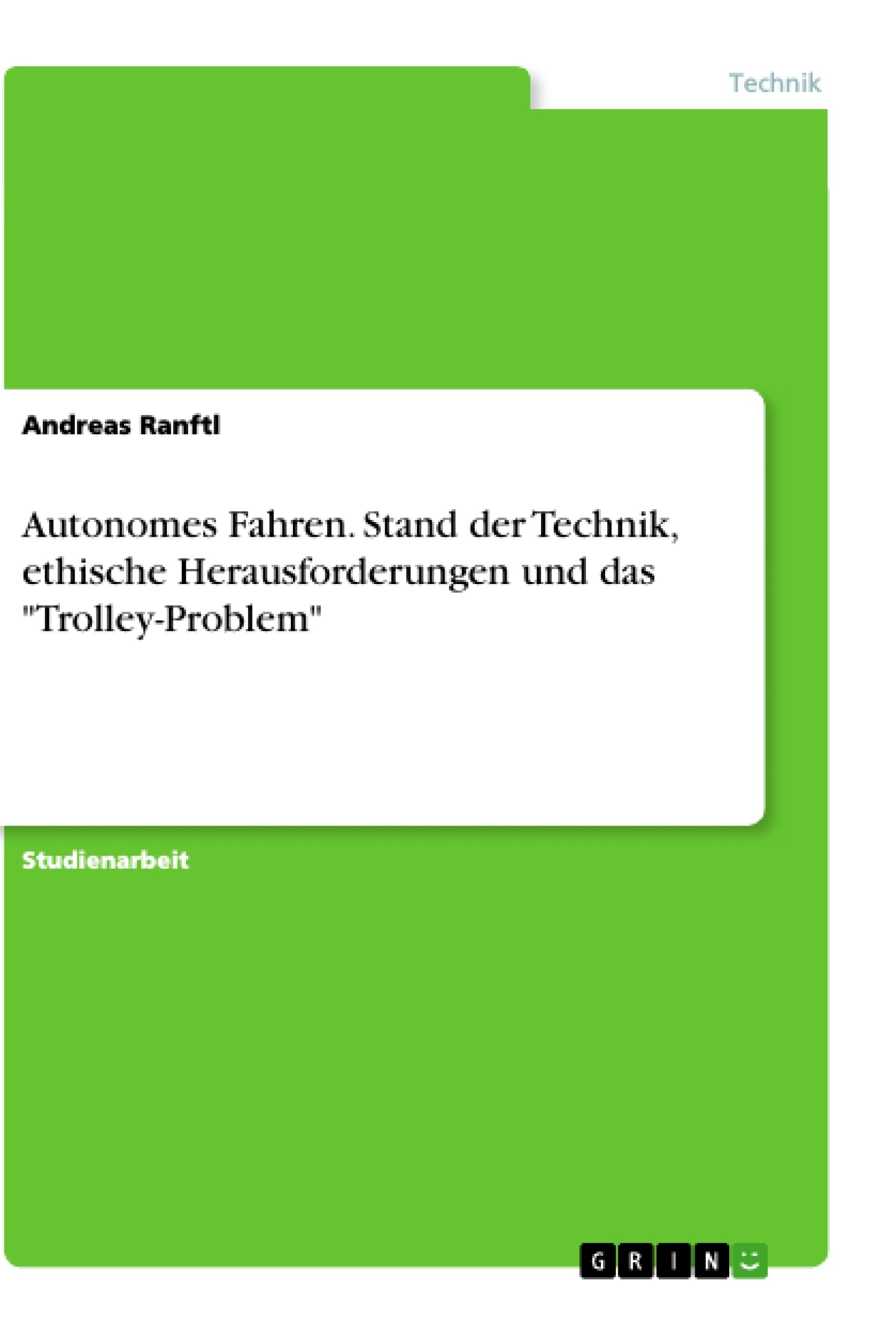Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema autonomes Fahren. Der Gedanke vom autonomen Fahren besteht schon über einen längeren Zeitraum und ein Großteil der Menschen kann sich unter diesem Begriff bereits etwas vorstellen. Mehrfach berichten Medien über Subventionen des Staates an die großen Automobilkonzerne und dessen Erfolge in der Forschung mit zahlreichen Versprechen naheliegender Markteinführungen, über das entstandene Wettrüsten der Automobilbranchen und deren neuen Konkurrenz, die Softwareunternehmen.
Dieses Thema lockt in der Gesellschaft viele optimistische Gedanken hervor. Sei es ein unfallfreies Fahren, das entspannte Zurücklehnen während einer Autofahrt, uneingeschränktes Telefonieren und Surfen im Internet, die eine schnellere und angenehmere Art der Vorbereitung für anstehende Termine zur Folge hätten, anstatt die kostbare Energie für Stau, schlechten Verkehr oder Ähnlichem zu verschwenden.
Des Weiteren soll für ältere, eingeschränkte oder kranke Menschen somit langfristig eine individuelle, erhöhte und sichere Mobilität ermöglicht und gewährleistet werden. Auch für eine effizientere Nutzung der Ressourcen soll autonomes Fahren einen großen Beitrag leisten: Eine weitere Alternative bieten Car-Sharing-Angebote, welche die Fahrzeuge autonom zum Kunden fahren lassen und sich dort eigenständig mit Energie versorgen.
Zuletzt könnte auch die Fahrt an sich unter Berücksichtigung des Verkehrsflusses und des gesamten Streckenverlaufs eine Optimierung aus energetischer Sicht zur Folge haben. Jedoch werfen die oben genannten Aspekte auch viele Fragen auf: Ist Autonomes Fahren die Zukunft oder doch nur eine Wunschvorstellung? Wie weit ist die Technik in der Automatisierung schon fortgeschritten oder ist sie bereits unmittelbar vor der Markteinführung?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 „Autonomes Fahren“
- 2.1 Definition
- 2.2 Automatisierungsgrade
- 2.3 Wettbewerber
- 2.3.1 Deutsche Hersteller machen gemeinsame Sache
- 2.3.2 Neue Marktteilnehmer
- 3 Die Technik und die zugehörigen Bauteile
- 3.1 Sensortechnik
- 3.2 Die einzelnen Sensoren
- 3.2.1 Ultraschall
- 3.2.2 Kamera
- 3.2.3 Radar
- 3.2.4 Lidar
- 3.2.5 Multisensoren
- 3.3 Car-2-X-Technik
- 3.3.1 Definition „Car-2-X-Technik“
- 3.3.2 Datenschutzproblematik
- 3.4 Das MEC-View-Projekt
- 4 Ethische Herausforderungen
- 4.1 Ethische Fragen
- 4.2 Die Ethik-Kommission
- 4.3 Akzeptanz in der Gesellschaft
- 5 Das „Trolley-Problem“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Autonomes Fahren“ und untersucht dessen technischen Fortschritt, ethische Implikationen und wirtschaftliche Aspekte. Ziel ist es, einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik, die Herausforderungen und das Potential des autonomen Fahrens zu geben.
- Technischer Fortschritt und Automatisierungsgrade
- Ethische Fragen und gesellschaftliche Akzeptanz
- Wettbewerb unter Automobilherstellern und neuen Marktteilnehmern
- Notwendige Sensorik und Car-2-X-Kommunikation
- Herausforderungen im realen Straßenverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt den Begriff des autonomen Fahrens vor und skizziert dessen vielversprechende Aspekte, wie erhöhte Sicherheit, Komfort und Effizienz. Zugleich werden kritische Fragen aufgeworfen, die die Machbarkeit und die gesellschaftlichen Auswirkungen betreffen. Der Text verweist auf die positiven Erwartungen der Gesellschaft und die damit verbundenen technischen und ethischen Herausforderungen.
2 „Autonomes Fahren“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Autonomes Fahren“ und beschreibt die verschiedenen Automatisierungsgrade nach SAE-Standard. Es werden die fünf Stufen (assistierte, teilautomatisierte, hochautomatisierte, vollautomatisierte und autonomes Fahren) detailliert erklärt, wobei der Fokus auf den jeweiligen Fähigkeiten und den Anforderungen an den Fahrer liegt. Die Darstellung der Stufen wird durch eine Abbildung veranschaulicht.
3 Die Technik und die zugehörigen Bauteile: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die technische Seite des autonomen Fahrens. Es beschreibt die verschiedenen Sensoren (Ultraschall, Kamera, Radar, Lidar, Multisensoren), die für die Erfassung der Umgebung unerlässlich sind, und erläutert deren Funktionsweise. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Car-2-X-Technik und deren Bedeutung für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur, sowie die damit verbundene Datenschutzproblematik. Das Kapitel beinhaltet auch eine Beschreibung des MEC-View-Projekts.
4 Ethische Herausforderungen: Das Kapitel befasst sich mit den ethischen Fragen, die sich aus dem autonomen Fahren ergeben. Es diskutiert die Herausforderungen im Umgang mit unvorhergesehenen Situationen und die Notwendigkeit von ethischen Richtlinien. Die Rolle einer Ethik-Kommission und die Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz werden ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Autonomes Fahren, Automatisierungsgrade, Sensortechnik, Car-2-X-Technik, Ethische Herausforderungen, SAE-Stufen, Wettbewerbslandschaft, Datenschutz, künstliche Intelligenz, Verkehrssicherheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Autonomes Fahren
Was ist der Inhalt des Dokuments "Autonomes Fahren"?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Autonomes Fahren. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem technischen Fortschritt, den ethischen Implikationen und den wirtschaftlichen Aspekten des autonomen Fahrens.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, „Autonomes Fahren“ (mit Definition, Automatisierungsgraden und Wettbewerbsanalyse), Die Technik und die zugehörigen Bauteile (Sensortechnik, Car-2-X-Technik, MEC-View-Projekt), Ethische Herausforderungen (ethische Fragen, Ethik-Kommission, gesellschaftliche Akzeptanz) und Das „Trolley-Problem“.
Was wird unter "Autonomes Fahren" definiert und welche Automatisierungsgrade werden beschrieben?
Das Dokument definiert "Autonomes Fahren" und beschreibt die verschiedenen Automatisierungsgrade nach SAE-Standard. Es werden die fünf Stufen (assistierte, teilautomatisierte, hochautomatisierte, vollautomatisierte und autonomes Fahren) detailliert erklärt, wobei der Fokus auf den jeweiligen Fähigkeiten und den Anforderungen an den Fahrer liegt.
Welche Sensortechnologien werden im Dokument behandelt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Sensortechnologien, die für autonomes Fahren unerlässlich sind, darunter Ultraschall, Kamera, Radar, Lidar und Multisensoren. Die Funktionsweise dieser Sensoren wird erläutert.
Welche Rolle spielt die Car-2-X-Technik?
Die Car-2-X-Technik und ihre Bedeutung für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur wird detailliert beschrieben. Das Dokument thematisiert auch die damit verbundene Datenschutzproblematik.
Welche ethischen Herausforderungen werden im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren diskutiert?
Das Dokument behandelt ethische Fragen im Kontext des autonomen Fahrens, insbesondere den Umgang mit unvorhergesehenen Situationen und die Notwendigkeit ethischer Richtlinien. Die Rolle einer Ethik-Kommission und die Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die zentralen Themen des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen: Autonomes Fahren, Automatisierungsgrade, Sensortechnik, Car-2-X-Technik, Ethische Herausforderungen, SAE-Stufen, Wettbewerbslandschaft, Datenschutz, künstliche Intelligenz und Verkehrssicherheit.
Was ist das Ziel des Dokuments?
Das Ziel des Dokuments ist es, einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik, die Herausforderungen und das Potential des autonomen Fahrens zu geben.
Welche konkreten Projekte werden erwähnt?
Das Dokument erwähnt das MEC-View-Projekt im Zusammenhang mit der Sensortechnik und dem autonomen Fahren.
- Quote paper
- Andreas Ranftl (Author), 2021, Autonomes Fahren. Stand der Technik, ethische Herausforderungen und das "Trolley-Problem", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021115