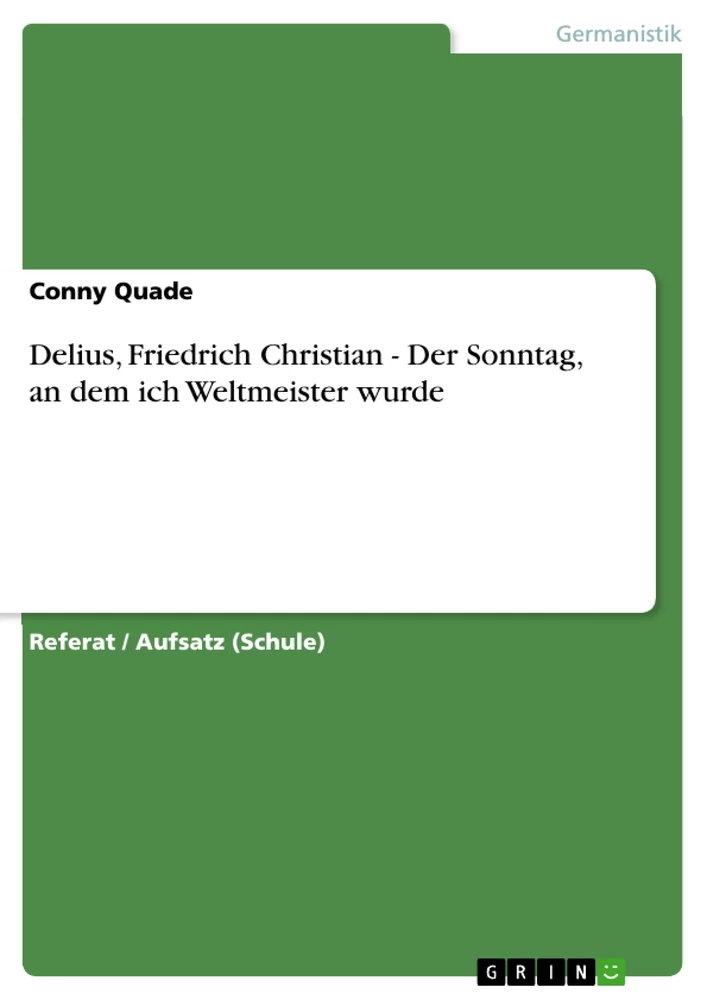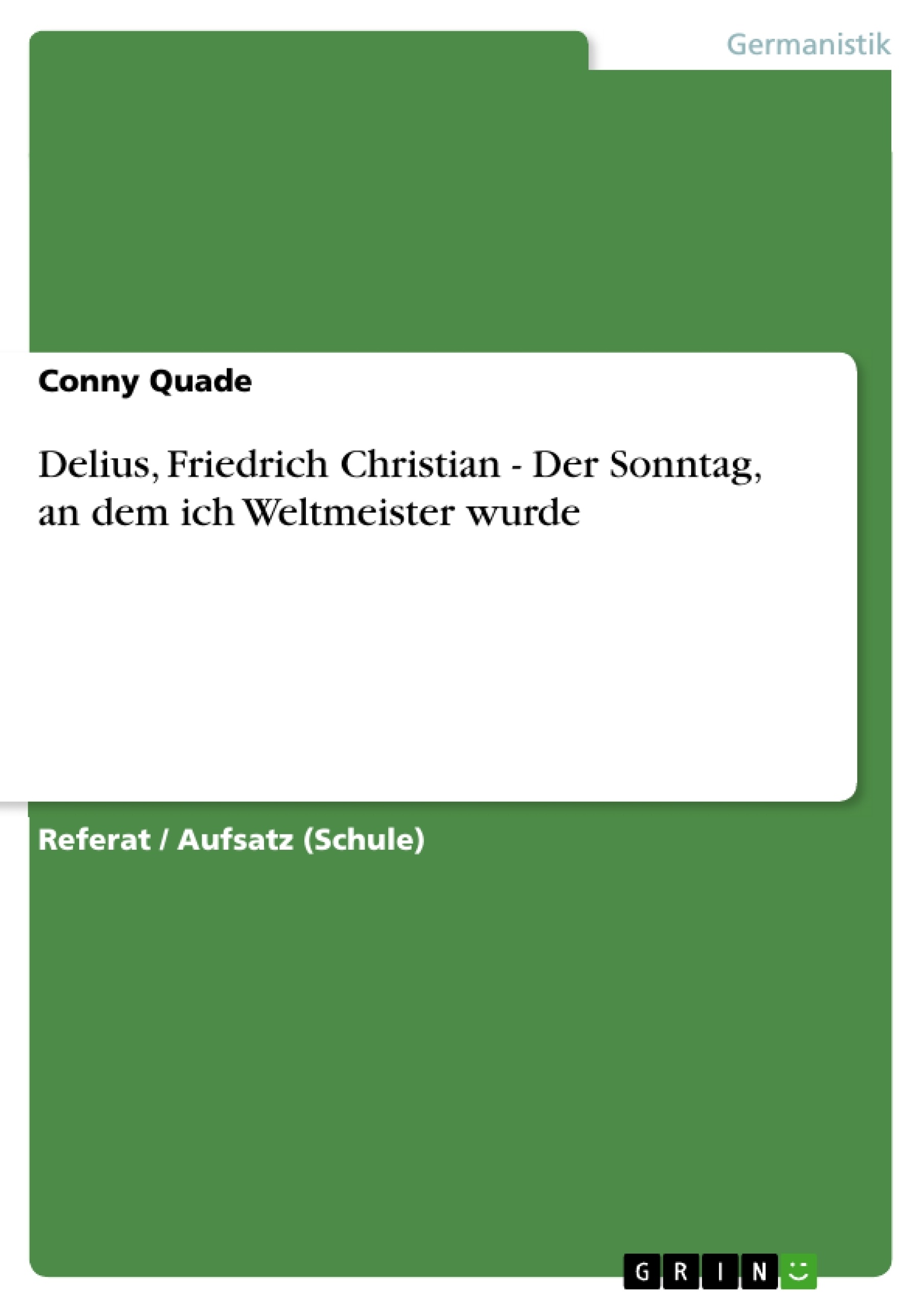Gliederung
1. Informationen zum Autor
2. Informationen zu der Erzählung
3. Haupthandlung
4. Konflikte
5. Textauszüge (S.55; S.78)
6. Wertung
7. Quellen
8. Diskussion
Autor
- *13.2.1943 in Rom
- aufgewachsen in Hessen
- lebt in Berlin
- seit 1966 Veröffentlichungen
- Lynk, Romane, Erzählungen
- Weitere Werke:Wir Unternehmer (1966; Dokumentarpolemik)
- Der Held und seine Wetter (1971; Promotionsarbeit)
- Ein Held der inneren Sicherheit (1981; Roman)
- Adenauerplatz (1984; Roman)
- Die Birnen von Ribbek (1991; Erzählung)
- Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus (1995; Erzählung)
- Amerikahaus und der Tanz um die Frauen (1997; Erzählung)
"Friedrich Christian Delius kommt aus einer aufklärerischen Tradition, die von Heine bis Brecht reicht. Ironie, Satire, kritische Reflexion sind seine Mittel."
Der Spiegel
Werk
autobiographischer Roman
spielt in den 50ger Jahren
Nachkriegsliteratur (obwohl 1994 veröffentlicht), weil
Ausschnitt aus dem Leben eines Menschen (hier: 1 Tag)
Darstellung des Alltags in der Nachkriegszeit
Verarbeitung von Kriegsfolgen (glücklich, seinen Vater zu haben) Beschreibung der Enge des Lebens
Präzise Beobachtungen
Motive Verarbeitung seiner Kindheit
Kritische Betrachtung der Lebensumstände und der Eltern Auseinandersetzung mit dem evangelischen Glauben
Haupthandlung
Hauptfigur:
Junge
11 Jahre
Pfarrerssohn
Lebt in kleinem, hessischen Dorf
3 Geschwister
stottert
Erzähler der Geschichte Fußballfan, -spieler
Beschreibung eines Sonntages (4. Juli 1954), an dem ein WM-Fußballspiel stattfindet ,welches er am Radio miterleben darf
schildert seine Sorgen, Fragen und Wünsche erzählt von seinem täglichen Leben
Konflikte
Eltern-Kind-Beziehung
Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und den religiösen Handlungen, die den Alltag der Familie bestimmen
die Unfähigkeit, seine Gedanken in Worte zu fassen
Dorfleben und die Enge der 50ger Jahre
Textstelle 1 S.55
Thema: Beschreibung der Sprachprobleme des Ich-Erzählers
Aufzählungen
Wiederholungen mit anderen Worten
Erläuterungen
Klangbilder
Lange Sätze (Kommata)
Übertreibungen
Fortlaufende Erinnerungen, Großteil besteht aus Reflexionen
Teilung in Kapitel
Zwischen dem Geschehen: Wünsche, Zukunftsträume, Rückblenden
soll Leser die Schwere des Problems bewusst machen
Verdeutlichung eines Sachverhaltes, der dem Leser unbekannt ist
Künstlerische Aspekte
Textstelle 2 S.78
Nachdenken über Fußball
Faszination des Sportes als Flucht aus dem täglichen Leben
Beschreibung von Sitten und Bräuchen der Familie
Wertung
kein Fußballbuch!
Leicht lesbar, Gedankengänge nachvollziehbar, aber nicht neu
Erzählung, keine spannende Handlung
Buch, das man liest und vergisst
Intention des Autors unklar
Quellen
Buch
Abiturwissen Literatur
Internet
Diskussion
Textstelle S.74 (Isaak-Episode)
Warum denkt ein 11jähriger Junge über diese Geschichte nach?
Arbeitsblatt
Friedrich Christian Delius "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" Über den Autor
1943 in Rom geboren
aufgewachsen in Hessen
seit 1966 Veröffentlichungen
Lyrik, Romane, Erzählungen
Über die Erzählung "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde"
autobiographisch Hauptfigur 11 Jahre,
Geschichte spielt 1954
Hauptfigur lebt in Hessen
Hauptfigur stammt aus Pfarrersfamilie
Hauptfigur stottert
beschreibt das Leben in der Nachkriegszeit in Erinnerungen
kritische Betrachtung von Religion und Glauben
Auseinandersetzung mit den Eltern
Sport als Faszination
Isaak-Episode (S.74-76)
"Ich war Isaak, der Sohn, der Vater griff seinen Sohn und faßte das Messer, weil sein Gott ihm befohlen hatte, daß er seinen Sohn schlachtete, ich sah Isaak mit erschrockenen ergebenen Augen auf dem Holzschnitt der Bilderbibel von Schnorr von Carolsfeld, ich war Isaak, gefesselt ängstlich gebeugt gedrückt an den Vater Abraham, vom Vater mit der linken Hand festgehalten, während die rechte mit dem am Schaft sehr breiten, dann spitz zulaufenden Messer schon ausholte.
Isaak konnte es nicht fassen: der Vater ersticht ihn, ich konnte es nicht fassen: was für ein Gott, der so etwas befiehlt, was für ein Vater, der ohne Widerworte einem solchen Befehl gehorcht, ich zitterte, ich blutete, sah mich brennen auf dem Altar, auf dem Scheiterhaufen, ich wußte nicht, wie mir geschah, und auch wenn mein Vater keine Ähnlichkeit hatte mit Abraham, keinen Bart, kein langes Haar, keine kompliziert gewickelten Tücher als Gewand, und auch wenn Brandopfer nicht mehr der Brauch waren, er war der Vater, ich der Sohn, über und beiden Gott, und ich wußte so wenig wie Isaak, welche Gebetsgespräche der Vater mit dem Herrgott führte, wie eng seine Beziehung zu diesem Wesen war, das alles wußte, alles konnte, alles vorhersah, Ich wußte nicht, ob mein Vater direkte Anweisungen und Befehle vom Herrn im Himmel erhielt wie großen Gestalten des Alten Testaments, ich fürchtete nicht, von meinem Vater wirklich erstochen zu werden, aber es genügte die Vorstellung, das Hören auf die Bibelgeschichte, der Blick auf den Holzschnitt: da ist ein lieber Gott, der einen seiner frömmsten und dienstbarsten Anbeter zwingt, seinen eigenen Sohn zu schlachten, seinen einzigen Sohn, da ist ein Vater, der diesen Befehl ohne Murren und ohne Fragen ausführt oder ausführen will, der den Sohn noch das Brandholz schleppen läßt, den Sohn belügt, als der nach dem Opfertier fragt, den Sohn fesselt und auf den Altar zwingt, der Altas ist Schlachtplatz und Feuerplatz in einem, und reckte seine Hand aus und faßte das Messer, daß er seinen Sohn schlachtete, wenn nicht im letzten Augenblick noch der Engel aufgetaucht wäre und den Sohn gerettet hätte vor dem Vater, der auch noch ausführlich gelobt wird, denn nun weiß ich, daß Du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen, da ist das glückliche Ende, ein Widder wird geschlachtet und verbrannt, aber wo ist der Sohn, was denkt der schreckstarre Isaak, was dachte ich, wie konnte ich mich sicher und angenommen und aufgehoben fühlen von der frohen Botschaft eines Herrn, der meinem frommen Vater ähnliche Prüfungen abverlangte, wie weit würde mein Vater gehen in einer vergleichbaren Situation, wäre ihm Gott lieber als seine Kinder, als ich, (...)"
Sekundärtexte und Werke
F.C. Delius:
"Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde"
Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde ist kein Fußballbuch; vielleicht ein Buch über Väter oder über Befreiung und Unterdrückung durch Sprache; vielleicht eines übers hessische Dorfleben in den fünfziger Jahren, über die Nachkriegszeit, übers Heranwachsen im Schatten der "Zonengrenze", über pubertäre Sehnsüchte und Ängste. Auf jeden Fall eine Kindheitsgeschichte, mit allem was dazugehört. Obschon kaum verhüllt autobiographisch und exakt datierbar auf den 4. Juli 1954, entfaltet der Text typische Strukturen von Kindheit.
Erinnerungssplitter, Assoziationen und bernsteinklar konservierte Beobachtungen gruppieren sich zum Tableau der fünfziger Jahre. Am Sonntagmorgen "zerhacken" Kirchenglocken "die Traumbilder"; zwar ist das Frühstück an diesem Tag weniger gehetzt als an Schultagen, dafür verhindern "Geleetrübsinn" und kleidungsbedingte "Sonntagsvorsicht" Ausbrüche aus der festgefügten Welt des wohlgeordneten Pfarrhaushaltes; sogar das Sanella- Brot ist biblisch aufgeladen, bloß der Kakao mangels einschlägiger Bibelsprüche "nicht von Gottes Gnade" vergiftet. Zum Glück , gibt's die Vorfreude auf den Nachmittag, an dem mit väterlicher Erlaubnis die Übertragung aus dem Berner Wankdorfstadion gehört werden darf und danach ist fast alles ganz anders.
Dr. Friedrich Christian Delius
geb. 13.02.1943 in Rom
Veröffentlichungen:
Kerbholz, 1965 1983
Wir Unternehmer, 1966 1983 Wenn wir, bei Rot, 1969 Der Held und sein Wetter, 1971
Unsere Siemens-Welt, 1972 erw. Neuausg. 1976
Ein Bankier auf der Flucht, 1975
Ein Held der inneren Sicherheit 1981 Die unsichtbaren Blitze, 1981 Adenauerplatz, 1984
Einige Argumente zur Verteidigung der Gemüseesser, 1985 Mogadischu Fensterplatz, 1987
Konservativ in 30 Tagen, 1988 Waschtag, 1988
Japanische Rolltreppen, 1989 Die Birnen von Ribbek, 1991
Selbstporträt mit Luftbrücke, 1962-1992 1993 Himmelfahrt eines Staatsfeindes, 1992
Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, 1994 Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus, 1995 Die Zukunft der Wörter, 1995
Die Verlockungen der Wörter oder Warum ich immer noch kein Zyniker bin, 1996 Amerikahaus und der Tanz um die Frauen, 1997
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Friedrich Christian Delius' "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde"?
Die Erzählung ist ein autobiographischer Roman, der in den 50er Jahren spielt und das Leben eines 11-jährigen Pfarrerssohns an einem Sonntag im Jahr 1954 beschreibt. Der Junge, der stottert, erlebt das WM-Fußballspiel am Radio mit und sinniert über seine Sorgen, Wünsche und sein tägliches Leben. Thematisiert werden die Nachkriegszeit, Familienbeziehungen, religiöse Auseinandersetzungen und die Enge des Dorflebens.
Wer ist Friedrich Christian Delius?
Friedrich Christian Delius wurde am 13. Februar 1943 in Rom geboren und wuchs in Hessen auf. Er ist ein deutscher Schriftsteller, der seit 1966 Lyrik, Romane und Erzählungen veröffentlicht hat. Seine Werke zeichnen sich durch Ironie, Satire und kritische Reflexion aus.
Was sind die Hauptthemen der Erzählung?
Die Hauptthemen sind: Eltern-Kind-Beziehung, Auseinandersetzung mit dem Glauben, Sprachprobleme (Stottern), Dorfleben und die Enge der 50er Jahre, sowie die Faszination für den Fußball.
Welche Konflikte werden in der Erzählung dargestellt?
Die Konflikte umfassen: Die Beziehung des Jungen zu seinen Eltern, seine Auseinandersetzung mit dem Glauben und religiösen Handlungen, seine Schwierigkeiten, sich auszudrücken (Stottern), und das Gefühl der Enge im Dorfleben der 50er Jahre.
Was ist die Isaak-Episode und welche Bedeutung hat sie?
Die Isaak-Episode (S.74-76) behandelt die biblische Geschichte von Isaaks Opferung. Der 11-jährige Junge denkt über diese Geschichte nach und hinterfragt den Befehl Gottes und die Bereitschaft des Vaters, seinen Sohn zu opfern. Dies führt zu Fragen über den Glauben, die Beziehung zu Gott und die Angst vor dem Vater.
Ist "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" ein Fußballbuch?
Nein, obwohl Fußball eine Rolle spielt, ist es kein reines Fußballbuch. Es geht vielmehr um Väter, Befreiung und Unterdrückung durch Sprache, das hessische Dorfleben in den fünfziger Jahren, die Nachkriegszeit und das Heranwachsen.
Was ist die Intention des Autors?
Die Intention des Autors ist nicht eindeutig. Es wird jedoch vermutet, dass er seine eigene Kindheit verarbeitet und eine kritische Betrachtung der Lebensumstände und des Glaubens seiner Eltern vornimmt.
Wo spielt die Geschichte?
Die Geschichte spielt in einem kleinen hessischen Dorf.
Wann spielt die Geschichte?
Die Geschichte spielt am 4. Juli 1954, dem Tag des WM-Fußballspiels.
Was für eine Art Roman ist es?
Es ist ein autobiographischer Roman.
- Arbeit zitieren
- Conny Quade (Autor:in), 2001, Delius, Friedrich Christian - Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102096