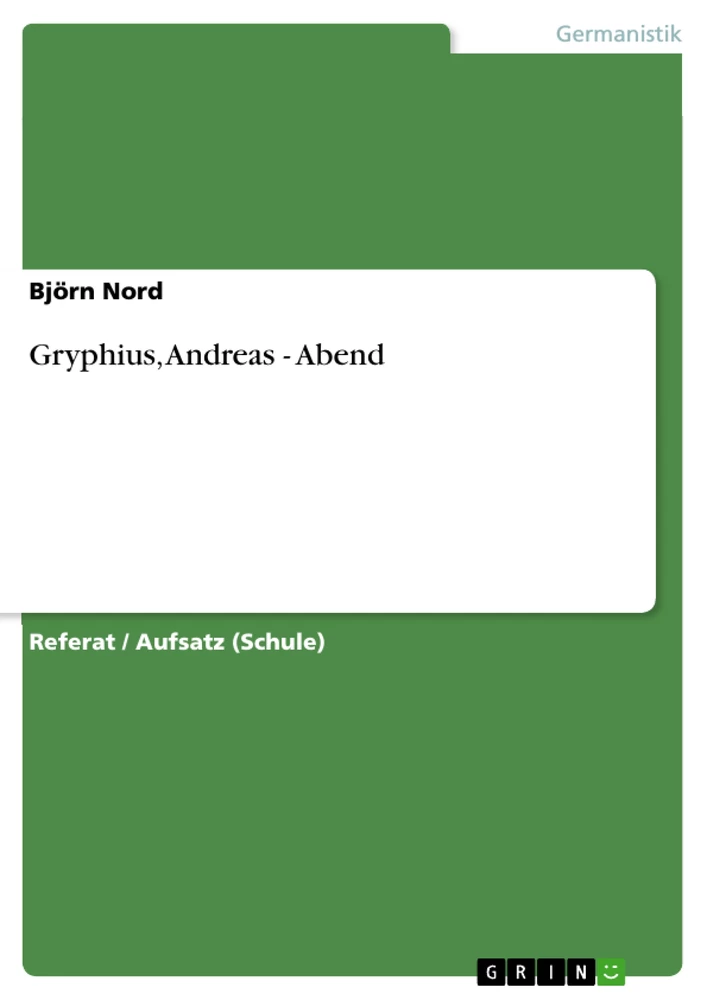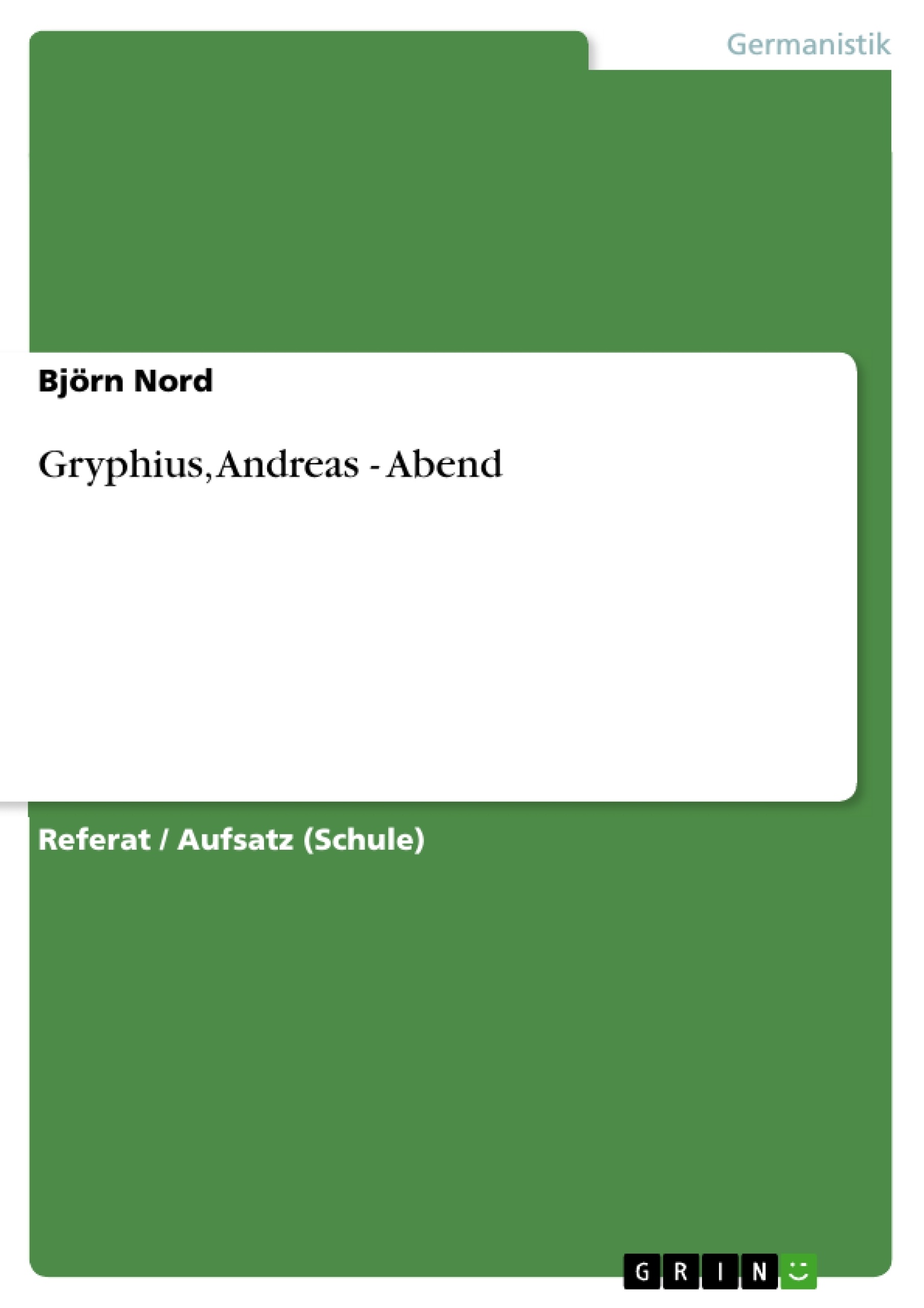Was, wenn der Abend nicht nur das Ende des Tages, sondern ein Spiegelbild unserer eigenen Vergänglichkeit ist? Andreas Gryphius' ergreifendes Sonett "Abend", entstanden im düsteren Zeitalter des Barock, nimmt den Leser mit auf eine introspektive Reise durch die Dunkelheit des Lebens und die unausweichliche Begegnung mit dem Tod. In kunstvoll verwobenen Quartetten und Terzetten entfaltet sich ein tiefgründiger Dialog zwischen dem lyrischen Ich und der allgegenwärtigen Frage nach dem Sinn des Daseins. Die eindringlichen Naturbilder der ersten Strophen, in denen die Nacht hereinbricht und die Welt in Stille hüllt, kontrastieren scharf mit der existentiellen Angst vor dem Vergehen, die in der zweiten Strophenhälfte thematisiert wird. Der "Port" des Todes rückt bedrohlich nahe, während das Leben als ein Wettlauf gegen die Zeit erscheint. Doch inmitten dieser düsteren Reflexion keimt die Hoffnung auf: In der Anrufung Gottes sucht das lyrische Ich Trost und Beistand, fleht um Führung durch die Irrgärten des Lebens und um Aufnahme in den himmlischen Frieden nach dem Tod. Gryphius' meisterhafte Verskunst, geprägt von der barocken Spannung zwischen "Carpe diem" und "Memento mori", verleiht dem Gedicht eine zeitlose Relevanz. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, die Suche nach Sinn in einer vergänglichen Welt und die Sehnsucht nach transzendenter Erlösung – all diese Themen berühren auch den modernen Leser zutiefst und laden zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit den großen Fragen des Lebens ein. "Abend" ist somit nicht nur ein bedeutendes Werk der Barockliteratur, sondern auch ein Spiegel unserer eigenen Ängste und Hoffnungen, ein Mahnmal der Vergänglichkeit und ein Aufruf zur Besinnung auf das Wesentliche in einer schnelllebigen Zeit. Die prägnante Bildsprache, die kunstvolle Form des Sonetts und die tiefgründige Thematik machen dieses Gedicht zu einem unvergesslichen Leseerlebnis, das lange nachwirkt und zum Nachdenken anregt. Entdecken Sie die verborgenen Schätze dieses Meisterwerks und lassen Sie sich von der zeitlosen Weisheit des Andreas Gryphius inspirieren. Tauchen Sie ein in die Welt des Barock und erleben Sie, wie aktuell die Fragen nach Leben, Tod und Ewigkeit auch heute noch sind.
Andreas Gryphius: Abend
Das Gedicht "Abend" von Andreas Gryphius entstand in der Zeit des Barock, im Jahre 1650. Es erzählt vom lyrischen Ich welches sich mit der Vergänglichkeit des Lebens und dem nahendem Tod auseinandersetzt.
Zwei Quartette die als umarmender Reim verfasst sind, bilden zusammen mit den darauffolgenden zwei Terzetten im Schweifreim, ein Sonett. In den Quartetten bildet die jeweils zweite Zeile zusammen mit der dritten ein Enjambement. Der Wechsel der Strophenform von Quartett zu Terzett markiert auch einen inhaltlichen Wechsel. In der ersten Gedichtshälfte beschreibt das lyrische Ich seine Sicht des Lebens, in der zweiten Hälfte kommt es zur Anrufung Gottes. Die Kernaussage einer jeden Strophe steht im letzten Vers. Schon das allein erregt Aufmerksamkeit. Es wird jedoch noch durch den Reim verstärkt, der die Strophenenden einer Gedichtshälfte akkustisch miteinander verbindet.
In der ersten Strophe beschreibt das lyrische Ich in einer sehr bildlichen Sprache den Eintritt der Nacht in der Natur. Es wird dunkel, Menschen und Tiere ziehen sich zurück, draußen herrscht die Einsamkeit. Die Nacht bedeutet das Ende für den Tag. Anfang und Ende der Strophe stehen in starkem Zusammenhang ("Der schnelle Tag ist hin, ..." Z.1; "Wie ist die Zeit vertan" Z.4). Der Tag wird durch das Alltagsleben weniger wahrgenommen als die Nacht, in der Stille und Besinnlichkeit einkehren. Der Vergleich mit vertaner Zeit liegt daher Nahe. Gleichzeitig bildet dieser Schlusssatz die Kernfrage die sich Menschen zum Lebensende hin stellen: War mein Leben sinnvoll?
Die zweite Strophe thematisiert die Vergänglichkeit des Lebens. Der erste Vers beschreibt anhand von Emblemen das nahende Ende. Der "Port" (Z.5) oder auch Hafen symbolisiert den Tod während der "Glieder Kahn" (Z.5) für das Leben steht. Auffällig in diesem Vers ist die Annäherung der statischen Komponente - des Hafens, an die mobile - den Kahn. Die Annäherung eines Individuums an ein Objekt geschieht meist durch den eigenen Willen. Bei der Annäherung an das Lebensende erscheint dies jedoch unwahrscheinlich. Gleichzeitig wird der Tod durch dieses Emblem als unausweichliche, feste Größe dargestellt. Irgendwann muss jeder Kahn in einen Hafen einlaufen. Vers zwei und drei der zweiten Strophe beziehen sich wieder auf Strophe eins. Das lyrische Ich vergleicht hier den Lebenszyklus mit dem Ablauf von Tag und Nacht. Erneut steht die wichtigste Aussage im letzten Vers. Das Leben wird mit einer Rennbahn verglichen. Der Tod stellt hier jedoch nicht, wie man zuerst denken mag das Ziel dar. Er erscheint vielmehr als Verfolger der dem Athleten auf dem Weg zum Ziel, der Erfüllung des Lebens, ständig auf den Fersen ist. Die Verbindung zu Vers eins wird somit auch deutlich: Bezogen auf das Ende der Strophe stellt der Hafen den Verfolger des Kahns dar; auf dem Weg zu seiner Bestimmung.
Strophe drei markiert den Anfang der zweiten Gedichtshälfte und eine Veränderung des Inhalts. Hier wird nicht mehr das Lebensende dargestellt. Vielmehr ruft das lyrische Ich Gott um Beistand und Hilfe an. Vers eins steht in direktem Zusammenhang mit Vers vier der zweiten Strophe. Die Bitte sicher durchs Leben zu kommen erscheint aufgrund der Anapher in Vers zwei und der Präzisierung des Wunsches geradezu wie ein Flehen. Ein Fehler oder ein Abweichen kann den Sieg im Rennen um ein erfülltes Leben kosten. In Vers drei wird die Angst vor dem Unbekannten und der Einsamkeit ausgedrückt. Die dritte Strophe bezieht sich vollständig auf das Leben.
Im Gegensatz hierzu steht die vierte Strophe. Auch hier wird Gott direkt angesprochen. Die Bitten beziehen sich jedoch hier auf den Tod selbst. Enthalten ist der Wunsch nach einer unversehrten Seele (Vers 1). Der zweite Vers assoziiert erneut das Ende des Lebens mit dem Ende des Tages. Hier wird der Bezug zu Strophe eins deutlich. Das Gedicht wirkt in sich geschlossen. Wieder erscheint das wichtigste Element im dritten Vers: Die Furcht vor Dunkelheit und Einsamkeit nach dem Tod. Daher erfolgt hier die Bitte um die Aufnahme in den Himmel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Gedicht "Abend" von Andreas Gryphius?
Das Gedicht "Abend" von Andreas Gryphius ist ein Sonett, das im Jahr 1650, in der Zeit des Barock, entstand. Es thematisiert die Vergänglichkeit des Lebens und die Auseinandersetzung des lyrischen Ichs mit dem nahenden Tod.
Wie ist das Gedicht aufgebaut?
Das Gedicht besteht aus zwei Quartetten (umarmender Reim) und zwei Terzetten (Schweifreim). Der Wechsel von Quartett zu Terzett markiert einen inhaltlichen Wandel: In der ersten Hälfte wird die Sicht des Lebens dargestellt, in der zweiten erfolgt die Anrufung Gottes. Die Kernaussagen stehen jeweils am Ende jeder Strophe.
Was beschreibt die erste Strophe?
Die erste Strophe beschreibt den Einbruch der Nacht in der Natur in bildlicher Sprache. Es wird dunkel, Menschen und Tiere ziehen sich zurück, und Einsamkeit herrscht. Die Strophe schließt mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lebens ("Wie ist die Zeit vertan").
Was ist das Thema der zweiten Strophe?
Die zweite Strophe thematisiert die Vergänglichkeit des Lebens. Embleme wie "Port" (Hafen, Tod) und "Glieder Kahn" (Leben) werden verwendet. Das Leben wird mit einer Rennbahn verglichen, wobei der Tod als Verfolger auf dem Weg zum Ziel (Erfüllung des Lebens) erscheint.
Was geschieht in der dritten Strophe?
In der dritten Strophe wendet sich das lyrische Ich an Gott und bittet um Beistand und Hilfe, um sicher durch das Leben zu kommen. Die Angst vor Fehlern, Unbekanntem und Einsamkeit wird ausgedrückt. Diese Strophe bezieht sich vollständig auf das Leben.
Was ist der Inhalt der vierten Strophe?
Auch in der vierten Strophe wird Gott angesprochen, aber hier beziehen sich die Bitten auf den Tod selbst. Es wird um eine unversehrte Seele gebeten und die Aufnahme in den Himmel ersehnt. Die Furcht vor Dunkelheit und Einsamkeit nach dem Tod wird thematisiert.
Welche Motive wechseln sich im Gedicht ab?
Im Gedicht wechseln sich die Motive Carpe diem (Nutze den Tag) und Memento mori (Gedenke des Todes) ab. Dies ist typisch für das Zeitalter des Barock, in dem Leben und Tod aufgrund von Krieg, Seuchen und Hungersnöten eng beieinander lagen.
Welche Bedeutung hat der Titel "Abend"?
Der Titel "Abend" etabliert eine Symbolik für das Lebensende. Der Vergleich des Lebens mit einer Rennbahn und des Todes als Verfolger ist für den Leser nachvollziehbar. Das Gedicht behält trotz seines Alters seine Aktualität, insbesondere in Bezug auf die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit.
- Quote paper
- Björn Nord (Author), 2000, Gryphius, Andreas - Abend, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102040