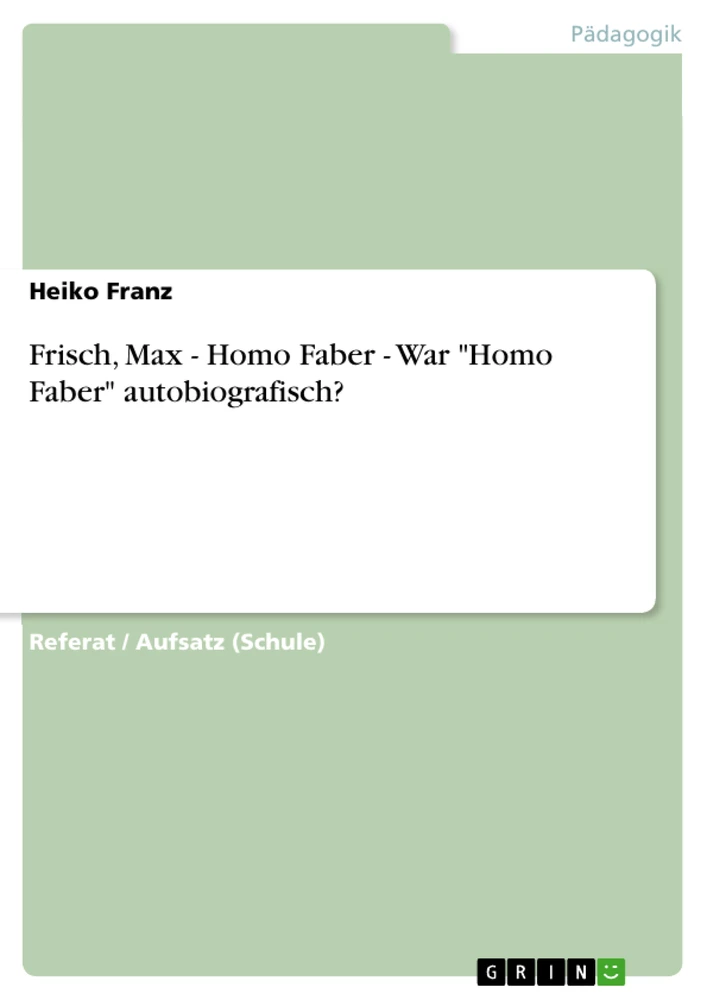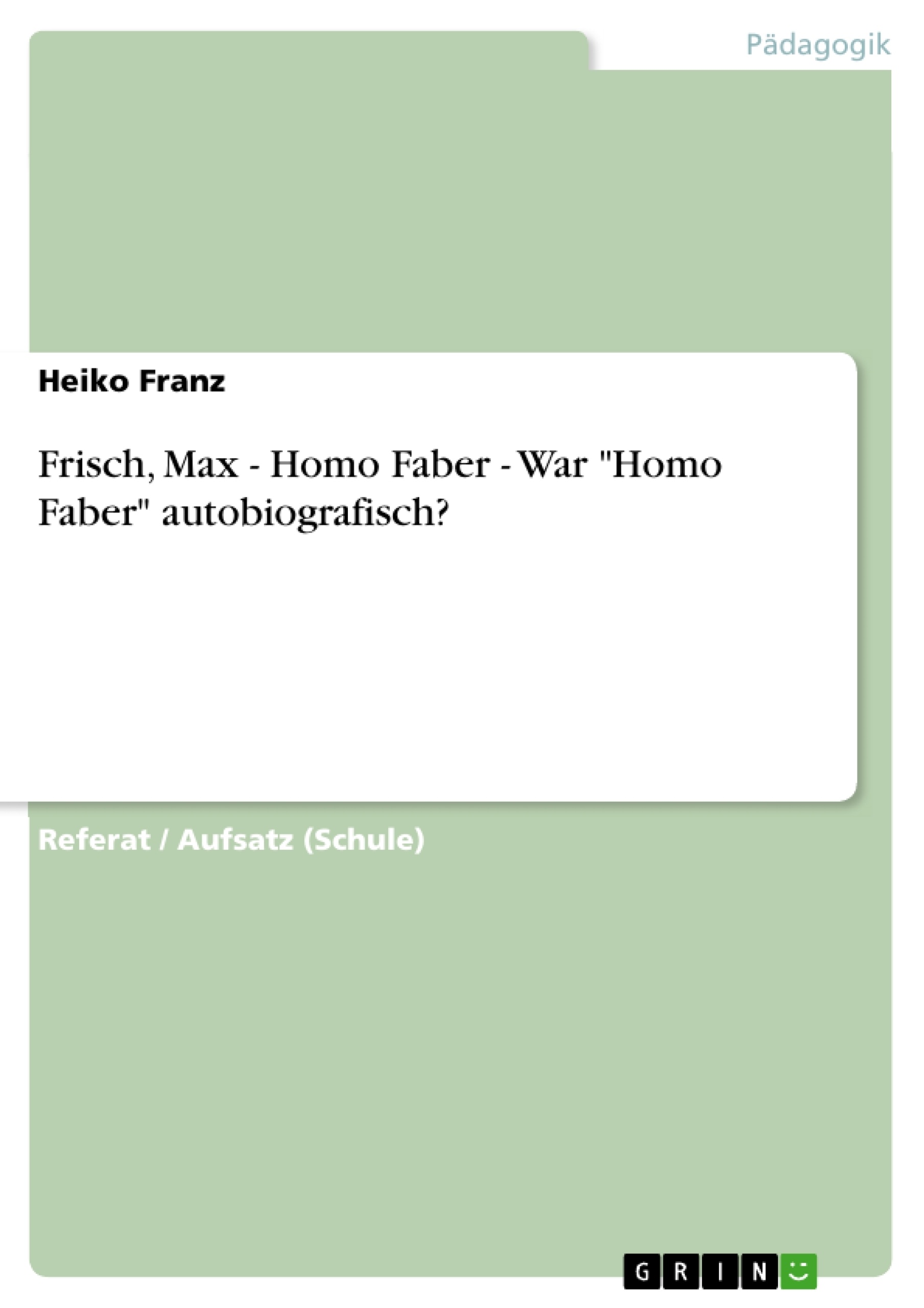Ist „Homo faber“ von Max Frisch autobiografisch? Durch zufälliges Suchen im Internet bin ich auf viele gute Biografien von Max Frisch gestoßen und mir fielen einige Parallelen zu dem Buch „Homo faber“ auf. Im Folgenden versuche ich daher auf Grundlage einiger Biografien Verbindungen zwischen dem Buch und dem Leben von Max Frisch zu ziehen. Wurde „Homo faber“ von Max Frisch als eine Autobiografie geschrieben?
Beim Lesen einiger der tabellarischen Biografien fällt sofort der berufliche Werdegang von Max Frisch auf. Er studiert ab 1936 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich Architektur, nachdem schon sein Vater diesen Beruf ausgeübt hat. Frisch schließt sein Studium 1941 als Diplomarchitekt ab. Schon 1942 gewinnt er den ersten Preis bei einem Architekturwettbewerb in Zürich. Kurz darauf eröffnet er sein eigenes Architekturbüro. All dies lässt den Schluss zu, dass Frisch ein guter Architekt gewesen ist. Dieser Beruf erfordert neben einer hohen Kreativität auch ein gutes mathematisches und technisches Grundwissen.
Ist „Homo faber“ von Max Frisch autobiografisch?
Durch zufälliges Suchen im Internet bin ich auf viele gute Biografien von Max Frisch gestoßen und mir fielen einige Parallelen zu dem Buch „Homo faber“ auf. Im folgenden versuche ich daher auf Grundlage einiger Biografien Verbindungen zwischen dem Buch und dem Leben von Max Frisch zu ziehen. Wurde „Homo faber“ von Max Frisch als eine Autobiografie geschrieben?
Beim Lesen einiger der tabellarischen Biografien fällt sofort der berufliche Werdegang von Max Frisch auf. Er studiert ab 1936 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich Architektur, nachdem schon sein Vater diesen Beruf ausgeübt hat. Frisch schließt sein Studium 1941 als Diplomarchitekt ab. Schon 1942 gewinnt er den ersten Preis bei einem Architekturwettbewerb in Zürich. Kurz darauf eröffnet er sein eigenes Architekturbüro. All dies lässt den Schluss zu, dass Frisch ein guter Architekt gewesen ist. Dieser Beruf erfordert neben einer hohen Kreativität auc h ein gutes mathematisches und technisches Grundwissen.
Auch Walter Faber, die Titelfigur in seinem Buch „Homo faber“, ist ein Techniker. Er ist Ingenieur bei der UNESCO und sein ganzes Leben ist geprägt von der Mathematik und Technik. Faber behauptet, er sei „Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind“ (S.24). Er lehnt den Glauben an Fügung und Schicksal ab und braucht „um das Unwahrscheinliche als Erfahrungstatsache gelten zu lassen keinerlei Mystik; Mathematik genügt [ihm]“ (S.22). Sowohl die Titelfigur im Buch, als auch der Autor selber sind also Techniker bzw. Mathematiker.
Beim weiteren Lesen der Biografie fällt auch besonders auf, dass Frisch, bevor er das Buch geschrieben hat, die Hauptschauplätze des Buches selber besucht hat. „Homo faber“ erscheint Ende 1957. Kurz zuvor reist Frisch nach Griechenland, wo auch ein großer Teil des Buches spielt. Ein Jahr zuvor nimmt Frisch an einer Internationalen Designer-Konferenz in Colorado (USA) teil. Anschließend reist er nach Mexiko und Kuba.
Auch hier werden viele Parallelen zu „Homo faber“ sichtbar. Walter Faber reist gleich zu Beginn des Buches von New York (USA) nach Caracas (Mexiko), New York ist ein Sitz der UNESCO. Walter Faber war also aus beruflichen Gründen dort, ebenso auch Max Frisch, der als Architekt an der Konferenz in Colorado teilgenommen hat. Frisch reist nach der Konferenz weiter nach Mittelamerika - ebenso die spätere Titelfigur in seinem eigenen Buch.
Ein weiterer wichtiger Charakterzug von Walter Faber wird später seine e xtreme Abneigung zur Natur sein. Hier liegt die Vermutung nahe, dass Max Frisch bei seinen Reisen durch Mittelamerika selber diese Abneigung entwickelt hat und sie seiner Titelfigur übergibt. Walter Faber beschreibt die Natur oft abwertend als „schleimig“ und „klebrig“ (S.33). Besonders die Sonne und den Sonnenuntergang bezeichnet er als „gedunsen, im Dunst wie eine Blase voll Blut, widerlich, wie eine Niere oder so etwas“ (S.53). Faber hebt auch die Fruchtbarkeit des Dschungels hervor („Wo man hinspuckt, keimt es!“ (S.51)). Er behauptet „es stinkt nach Fruchtbarkeit, nach blühender Verwesung“ (S.51).
Abgesehen von den großen Übereinstimmungen bei den Reisen nach Nordamerika, Mittelamerika und Griechenland ist die Reiselust allgemein eine Übereinstimmung der beiden Personen. Man könnte auch von einer Rastlosigkeit sprechen. Frischs Biografie ist bestückt mit einer Vielzahl von Reisen, so zum Beispiel nach Nord- und Mittelamerika, Ost- und Südosteuropa, die Sowjetunion, Deutschland und Italien. Auch hier gibt es Übereinstimmungen mit „Homo faber“: die Reise von Walter Faber und Sabeth durch Italien ist verkleidet mit vielen Eindrücken aus der Landschaft und Architektur (vergleiche S.107 bis 123).
Walter Faber reist, durch seinen Beruf bedingt, viel. Faber ist praktisch während des ganzen Buchs auf einer Reise. Zu Beginn fliegt er zum Beispiel von New York nach Caracas, wo er den Bruder eines früheren Freundes trifft. Später reist er mit einem Jeep durch den Dschungel, wo seine Haltung zur Natur deutlich zum Ausdruck kommt. Auch Sabeth, die Schlüsselperson des Buches, trifft er auf einer Reise: Er trifft sie auf dem Schiff von Amerika nach Europa. Große und auch entscheidende Teile der Handlung finden also auf Reisen statt.
Eine weitere deutliche Parallele zwischen der fiktiven Figur Walter Faber und seinem Autor Max Frisch ist deren Alter. Frisch ist zum Zeitpunkt des Erscheinens von „Homo faber“ 48 Jahre alt und Faber ist in dem Buch 50 Jahre alt. Auch die zeitliche Abfolge innerhalb des Romans deckt sich mit der Realität. Faber und Frisch haben so zum Beispiel beide etwa im gleichen Alter unmittelbaren Kontakt mit dem Nationalsozialismus, insbesondere dem Antisemitismus: Frisch 1935 auf einer Reise nach Deutschland und Faber in jungen Jahren mit seiner halbjüdischen Freundin Hanna Landsberg.
Frischs Familienstand und seine Beziehungen zu Frauen stellen eine weitere deutliche Parallele dar: Frisch heiratet 1942 Trudy von Meyenburg. Aus der Ehe gehen 2 Töchter hervor. 1954 trennt sich Frisch von seiner Familie und reist 1957, kurz vor dem Erscheinen von „Homo faber“, mit einer Freundin nach Griechenland. Die Titelfigur Walter Faber ist verheiratet gewesen. Er steht in jungen Jahren kurz davor seine deutsche Freundin, Hanna Landsberg, zu heiraten, um ihr als Halbjüdin den Aufenthalt in der Schweiz zu sichern. Es kommt jedoch nicht zu dieser Heirat, da sich Walter Faber und Hanna aufgrund deren Schwangerschaft zerstritten und Faber aus beruflichen Gründen Zürich verlassen muss. Faber hat Frauen gegenüber eine negative Einstellung. Sie gipfelt in der Aussage: „Ivy heißt Efeu, und so heißen für mich eigentlich alle Frauen“ (S.91). Frauen sind für ihn unverständlich und oft eher lästig. Oft benutzt er „weibisch“ als Adjektiv für die von ihm abgelehnte Weltsicht. Diese abgelehnte Weltsicht beinhaltet besonders den Glauben an Fügung oder Schicksal, den Ausdruck von Emotionen sowie alles Natürliche.
Diese Haltung könnte man in Verbindung mit der Trennung von Max Frisch von seiner Familie setzen. Faber verliebt sich später in seine eigene Tochter, von deren Existenz er nichts wusste und fährt mit ihr nach Griechenland. Dies ist auch der Zeitpunkt innerhalb des Buches, wo sich Fabers Weltsicht komplett ändert. Er drückt jetzt auch Gefühle und Erlebnisse aus. Auch Max Frisch fährt mit einer neuen Freundin nach Griechenland und lässt sich später von seiner Frau scheiden. Er hat später noch viele Freundinnen, heiratet erneut eine Studentin und lässt sich jedoch wieder scheiden. Die Reise nach Griechenland stellt also auch in dem Leben des Autors einen Umbruch dar.
Als letzte Parallele kann noch die gemeinsame Krankheit der beiden Personen aufgeführt werden. Sowohl Max Frisch, als auch dessen Figur Walter Faber haben an Krebs gelitten. Walter Faber stirbt vermutlich am Ende des Buches daran. Max Frisch stirbt 15 Jahre nach erscheinen von „Homo faber“ ebenfalls nach langem Krebsleiden.
Abschließend kann man sagen, dass allein durch das Vergleichen der Biografie von Max Frisch und seinem Buch „Homo faber“ viele Gemeinsamkeiten deutlich werden. Allein durch diesen Vergleich kann man aber nicht klären, inwiefern Frisch einfach nur Eindrücke aus seinem Leben in sein Buch eingebaut hat oder es wirklich autobiografisch schrieb.
Quellen:
- Max Frisch: „Homo faber - ein Bericht“. Suhrkamp 1957
- diverse Biografien aus dem Internet, u.a.:
www.suhrkamp.de/autoren/frisch/frisch.htm
schulen.nordwest.net/Ulricianum_Aurich/50brd/kultur/theater/frisch.htm
www.fh-lueneburg.de/u1/gym03/expo/jonatur/geistesw/homo/faber98/faberbio.htm
www.limmatverlag.ch/frisch/mf_chron.htm
www.wunderzeichen.de/Germanistik/Frisch1.html
Häufig gestellte Fragen zu "Ist „Homo faber“ von Max Frisch autobiografisch?"
Ist "Homo faber" von Max Frisch eine Autobiografie?
Der Text untersucht, ob Max Frischs Roman "Homo faber" autobiografische Züge aufweist, indem er Parallelen zwischen dem Leben des Autors und der Handlung sowie der Hauptfigur des Buches, Walter Faber, aufzeigt.
Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Max Frisch und Walter Faber in Bezug auf ihren Beruf?
Sowohl Max Frisch als auch Walter Faber haben einen technischen Hintergrund. Frisch war Architekt, während Faber Ingenieur bei der UNESCO ist. Beide sind geprägt von Mathematik und Technik.
Welche Rolle spielen Reisen in "Homo faber" und im Leben von Max Frisch?
Reisen spielen sowohl im Roman als auch im Leben von Max Frisch eine wichtige Rolle. Frisch reiste vor dem Schreiben des Buches an die Hauptschauplätze (Griechenland, USA, Mexiko, Kuba), die auch im Buch vorkommen. Walter Faber reist im Roman beruflich und privat viel.
Welche Parallelen gibt es bezüglich der Reiseziele von Max Frisch und Walter Faber?
Sowohl Frisch als auch Faber reisen nach Nordamerika, Mittelamerika und Griechenland. Fabers Reise von New York nach Caracas ähnelt Frischs Teilnahme an einer Konferenz in Colorado und anschließender Reise nach Mexiko. Auch die Reise von Faber und Sabeth durch Italien spiegelt Frischs eigene Reiseerfahrungen wider.
Wie äußert sich Walter Fabers Abneigung zur Natur und wie könnte dies mit Max Frisch in Verbindung stehen?
Walter Faber hat eine starke Abneigung zur Natur, die er als "schleimig" und "klebrig" beschreibt. Der Text vermutet, dass Max Frisch diese Abneigung während seiner Reisen durch Mittelamerika entwickelt und sie auf seine Titelfigur übertragen haben könnte.
Gibt es Parallelen im Alter und in der zeitlichen Abfolge von Ereignissen im Leben von Max Frisch und Walter Faber?
Ja, Frisch und Faber sind zum Zeitpunkt des Erscheinens des Buches ähnlich alt. Beide hatten etwa im gleichen Alter direkten Kontakt mit dem Nationalsozialismus bzw. dem Antisemitismus.
Welche Gemeinsamkeiten gibt es im Familienstand und in den Beziehungen zu Frauen zwischen Max Frisch und Walter Faber?
Beide waren verheiratet und hatten Beziehungen zu Frauen, die von Brüchen und Veränderungen geprägt waren. Frischs Trennung von seiner Familie und seine spätere Reise nach Griechenland spiegeln sich in Fabers Entwicklung im Roman wider. Faber hat eine negative Haltung gegenüber Frauen, die auf Frischs Trennung von seiner Familie zurückzuführen sein könnte.
Gibt es gesundheitliche Parallelen zwischen Max Frisch und Walter Faber?
Sowohl Max Frisch als auch Walter Faber litten an Krebs. Walter Faber stirbt vermutlich am Ende des Buches daran, und Max Frisch starb 15 Jahre nach Erscheinen des Buches ebenfalls nach langem Krebsleiden.
Welche Quellen werden für die Analyse verwendet?
Als Quelle wird Max Frischs Roman "Homo faber" verwendet. Zudem wurden diverse Biografien von Max Frisch aus dem Internet herangezogen.
- Quote paper
- Heiko Franz (Author), 2001, Frisch, Max - Homo Faber - War "Homo Faber" autobiografisch?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101994