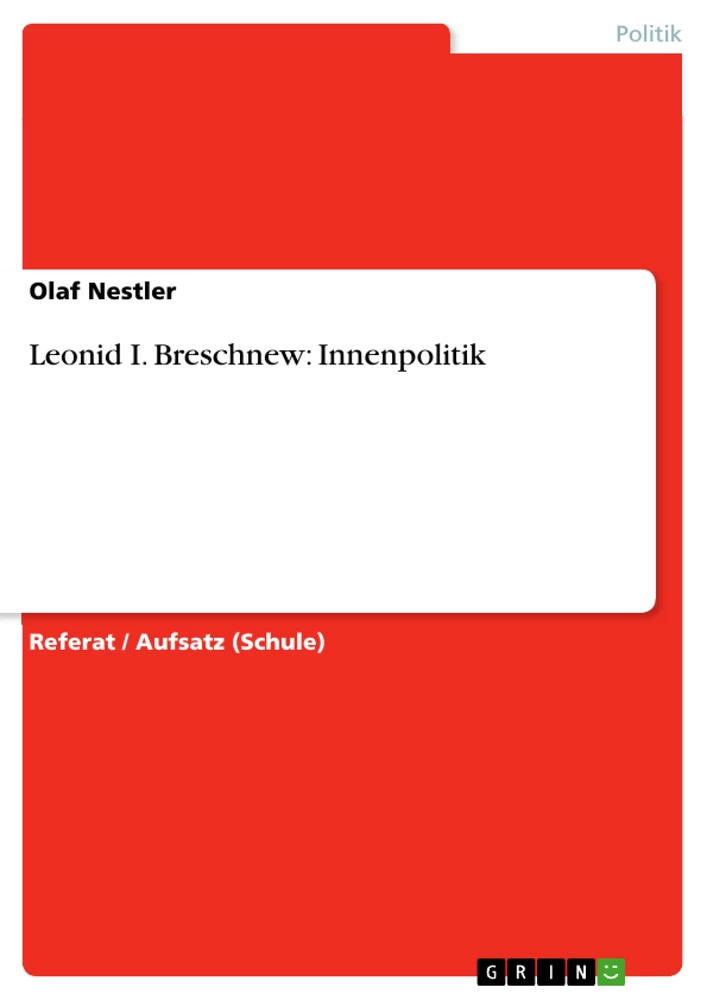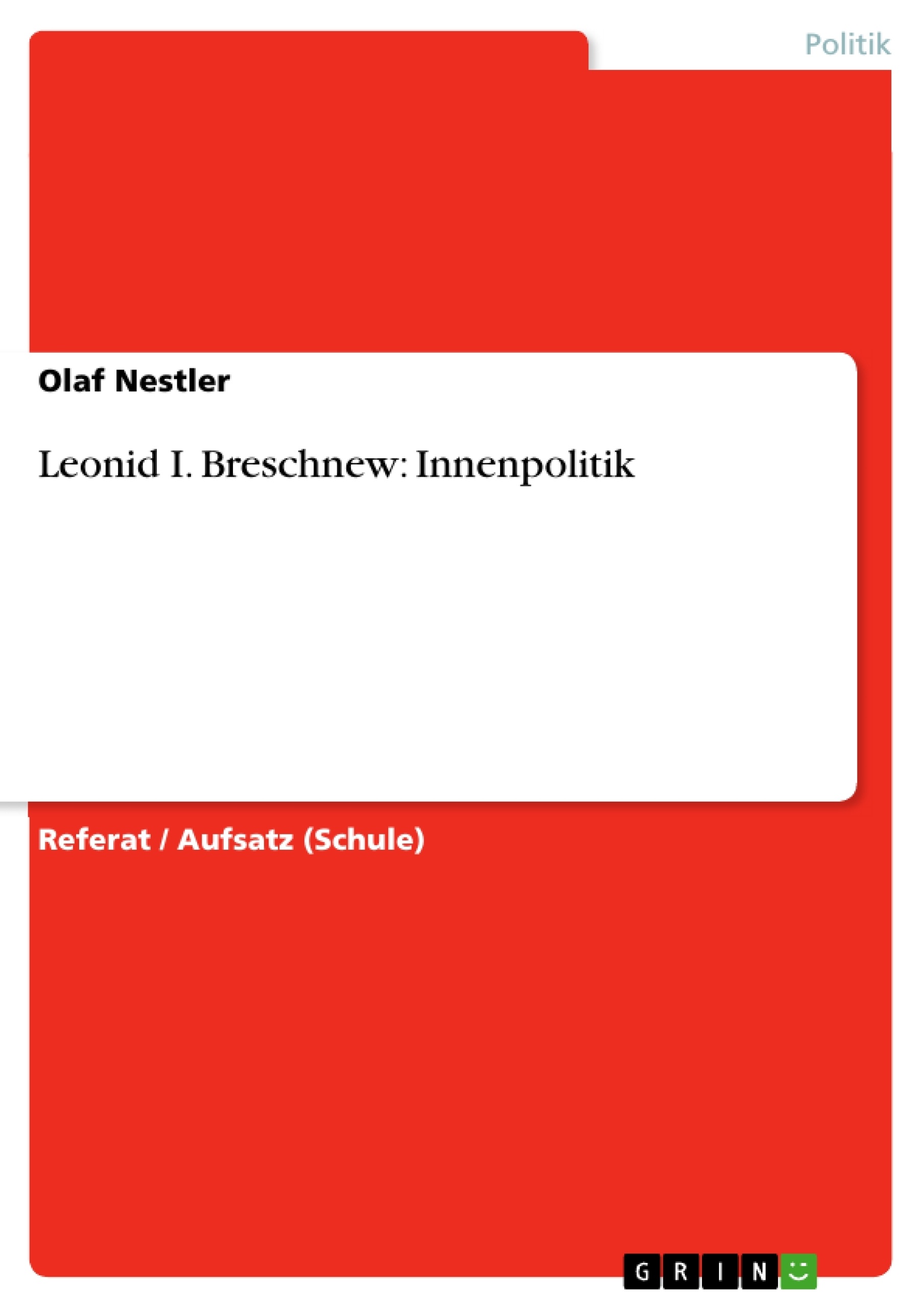Leonid I. Breschnew: Innenpolitik
Nach der Diktatur Stalins mit seinen unmenschlichen Methoden folgte Chruschtschow mit einem sprunghaften Regierungsstil. Seine Politik war mehr auf Popularitätshascherei und Kumpelhaftigkeit ausgerichtet. Dessen „Reformen“ vermochten es nicht die zerrüttete Landwirtschaft wieder aufzubauen, sondern er bewirkte sogar einen außenpolitischen Prestigeverlust und innenpolitisch verloren die Kader das Vertrauen in die KPdSU und immer mehr glaubten die Partei sei auf dem Weg in die Orientierungslosigkeit. Nach Chruschtschows Sturz übernahm die „kollektive Führung“ die Macht, welche aus Leonid Breschnew, dem Ersten Sekretär der KPdSU, dem Ministerpräsidenten Kossygin und dem Vorsitzenden des Obersten Sowjets und damit dem nominellen Staatsoberhaupt Podgornyj bestand. Aus dieser Konstellation trat Breschnew immer mehr hervor, und nach dem Sturz Podgornyjs 1977 (gleichzeitig der Machthöhepunkt von Breschnew) übernahm er auch dessen Amt. Der aus der Ukraine stammende Leonid Breschnew war Sohn eines Stahlarbeiters. Er schaffte den Aufstieg im ukrainischen Parteiapparat und war seit 1952 ZK-Mitglied. Dadurch sammelte er Erfahrung in der Landwirtschaft und Industrie. Nach Chruschtschows Sturz wurde er als heißester Kandidat als dessen Nachfolger gehandelt.
Die neue Führung wollte die verbreitete Verunsicherung in Partei und Gesellschaft stoppen und die Zügel wieder fest in die Hände der Partei lenken. Die illusionären Ziele wurden aufgegeben (z.B. die Vorstellung das, dass sowjetische Volk im Jahr 1980 im Kommunismus lebt) und Sachlichkeit, Selbstkritik, Realitätsnähe und Pflichtbewusstsein sollten den Führungsstil kennzeichnen um die Autorität zu stärken und die kommunistische Bewegung weiter voranzutreiben.
Als einer seiner ersten Schritte führte er den landwirtschaftlichen und industriellen Zweig in der KPdSU wieder zusammen, was die 1962 beschlossene Zweiteilung aufhob. Die Parteikontrolle wurde verschärft und der Eintritt erschwert. Auch bewusst knüpfte er an den Stalinismus an als er das Präsidium in „Politbüro“ und Erster Sekretär in Generalsekretär umbenannte um die Erfolge im damaligen Sozialismus hervorzuheben. Dies alles diente um das öffentliche Leben und die Nomenklatur (die Personen an den Schalthebeln der Macht, welche vom Dorf bis zum Kreml ausgesuchte hohe Parteimitglieder verkörperten) nach den Direktiven der Partei auszurichten, was erstmals in der neuen Verfassung von 1977 geschah: „die führende und lenkende Kraft der sowjetischen Gesellschaft,... ist die kommunistische Partei der Sowjetunion...“
Prägend für die Politik der Sowjetunion blieb die Konkurrenz mit den kapitalistischen Industrienationen. Das Ziel war nicht nur mit dem Westen Schritt zu halten, sondern ihn auch im Lebensstandard und in der Pro- KopfProduktion zu überholen, auch wenn dies in weiter Ferne lag. Denn der technologische Rückstand und die Arbeitsproduktivität waren erst zu überwinden, bevor man effektiv vorankam, wofür bei der Technik mit den Industriestaaten kooperiert wurde. Die Produktion sollte durch die Förderung der Leistungsbereitschaft durch Verbesserung der Sozialpolitik und durch eine verbesserte Wirtschaftsverwaltung erhöht werden. Der Ministerpräsident Kossygin verfügte als Vorsitzender der staatlichen Plankommission, die 60 Jahre lang alle Produktionspläne (Gosplan) für alle Produktionsstätten des Landes erstellte, welche wie Gesetze befolgt wurden, über genügend Erfahrung auf diesem Gebiet. In Erkenntnis der umfassenden und damit zu starren Planung hielt er die Regierung zu einer Minderung der zentralen Kontrolle und einer größeren Verselbständigung der Betriebe und Wirtschaftsverwaltung an. Somit sollte eine Flexibilität für die Situationen des Marktes geboten werden und sogar Investitionen ermöglichen. Die Kürzung des Rüstungsetats sollte eine nachfrageorientierte Konsumgüterproduktion finanzieren, die der Bevölkerung Anreize für eine höhere Leistungsbereitschaft bieten sollten. Die konservative Regierung billigte nur wenige Vorschläge: die Kürzung der Rüstungsausgaben wurde wegen des Eingreifens der USA in den Vietnamkrieg, verworfen, und die Verselbständigung des Wirtschaftsapparates hätte zu einem Verlust der allseitigen Kontrolle und der Machtposition in der Wirtschaft geführt und wurde auch verworfen. Lediglich die Planvorgaben wurde gemindert und die Planung rationalisiert, dies verschaffte den Initiativen der Unternehmen wenigstens ein bisschen mehr Spielraum.
Der Versuch, der Verbesserung der zentralen Planung und Wirtschaftsleitung sowie der Strukturprobleme waren zumindest anfangs wirksam, denn die Wirtschaftsentwicklung schritt schneller voran, auch wenn in der 70er Jahren wieder eine rückläufige Tendenz eintrat war ein Aufholen zu den USA zu spürbar geworden, besonders in rüstungsnahen Bereichen, dem Kernenergiesektor und der Metallverhüttung. Die einseitige Förderung der Erschließung von Sibirien durch die Baikal-Amur-Magistrale und der Rüstung führte zu einem Innovationsmangel in der Elektronik- und Computerindustrie, die zunehmend an Bedeutung gewann, deshalb machte sich bald ein wachsender Rückstand bemerkbar. Die wissenschaftlich- technische Revolution blieb in den Anfängen stecken, obwohl die Sowjetunion versuchte mit den Industriestaaten zu kooperieren und deren Wissen für sich zu nutzen. Durch Abstriche an Kompetenzen der Unionsrepubliken wurde die Überzentralisierung und damit die mangelnde Flexibilität verstärkt, was zum weiteren Rückstand hinter den Industriestaaten führte. Auch die Betriebsprobleme, wie geringe Flexibilität, Ersatzteilbeschaffung und Zulieferungen durch zu lange Wege, blieben bestehen.
Chruschtschows Landwirtschaft war mit der Neuland- und Maiskampagne nicht sehr erfolgreich verlaufen. Breschnew intensivierte die Nutzung der bestehenden Agrarflächen und vergrößerte sie nicht, was zu einem Anfangserfolg führte und die allgemeine Versorgungslage der Bevölkerung verbesserte. Um die Kolchosen und Sowchosen mit Maschinen, Traktoren und Düngemitteln auszustatten wurde erhöht investiert. Weiterhin blieben Projekte wie die Umwandlung von Kolchoswirtschaften in Staatsbetriebe und Maßnahmen zur Verbesserung des Bodens in den Anfängen stecken. Die Verbesserung der Struktur und materielle Reize führten zu einer Bruttoproduktionssteigerung, was zu einer besseren Versorgung der Betriebe mit Futtermitteln führte und so die Tier- und Fleischproduktion stiegen ließ, der Pro-Kopf-Verbrauch lag aber noch weit unter dem der westl. Länder. Als Folge der Missernten von 1972, -95, -79 und -82 musste die Kremlführung große Mengen an Getreide in den Industrienationen einkaufen, dies zeigte die Anfälligkeit der sowjetischen Landwirtschaft gegenüber witterungsbedingten Schwankungen. Ebenso gingen ca. 25% der jährlichen Ernte durch unsachgemäßen Transport oder Lagerung verloren. Dadurch musste der Import von Nahrungsmitteln in etwa vervierzigfacht werden und 1981 wurden 14,5, Milliarden (das entspricht der Hälfte sämtlicher Deviseneinnahmen) ausgegeben werden. Um nicht noch mehr dringend benötigtes Kapital zu verlieren wurde das Privatland, welches aus der Sicht der sowjetischen Ideologie baldmöglichst zu beseitigen gewesen sei, gefördert, vor allem um das Überleben der Kolchosen zu sichern. Die größten Erfolge erzielte die private Landwirtschaft im Bereich des Anbaus von Kartoffeln und Gemüse (mit 50%). Letztlich war die private Landwirtschaft nicht mehr aus der Versorgung wegzudenken.
Verbunden mit den Maßnahmen in der Sozialpolitik war die erhöhte Konsumgüterproduktion. Dies wäre nicht so bereitwillig geschehen, wenn nicht an die entstehende Zufriedenheit der Bevölkerung eine Hoffnung auf eine innenpolitische Sicherung der Macht geknüpft gewesen wäre. Schon im Fünfjahrplan vom XXIII. Parteitag der KPdSU 1966 war die Rede von Senkung der Lohnsteuer und eine Erhöhung der Mindestlöhne und Altersrenten. Die größte Beachtung fanden zunächst die sozial Schwächsten. Die Kolchosbauern benötigten noch immer Inlandspässe für einen Wohnortwechsel, das erlaubte der Regierung die nötigen Papiere zu verweigern und die Bauern in den Kolchosen zu halten, was aber bis 1981 durch Aushändigung von Pässen beseitigt werden sollte. Ebenso wurden diese Bauern bei Einkommenserhöhungen und Rentensteigerungen bevorzugt behandelt und die Landflucht weiter eingeschränkt. Trotzdem blieben die Maßnahmen im Sozialbereich unzureichend es wurde noch immer erst die Hälfte des Existenzminimums gezahlt. Auf dem Familiensektor sieht es da schon besser aus: die seit 1970 gezahlte Geburtenbeihilfe wurde vom dritten Kind auf alle ausgedehnt und 1974 führte die sowjetische Regierung erst mal die Zahlung eines Kindergeldes ein, es war aber beschränkt auf arme Familien und bis um 8. Lebensjahr des Kindes. Auch konnten die Frauen sich ein „Babyjahr“ nehmen bei einer Lohnfortzahlung von 20% des Durchschnittsgehalts. Bei 11,2- 13,2 Quadratmetern pro Person war das Wohnraumproblem ungelöst, die meisten lebten wesentlich beengter und zu einem Verteilungsverfahren für neue Wohnungen wurde man erst bei unter 5 Quadratmetern pro Person zugelassen. 1977 erlangten die Rechte auf Wohnraum, Mindestlohn, Höchstarbeitszeit und andere soziale Errungenschaften Verfassungsrang. Der Lebensstandard stieg trotz der Beschränkungen im Sozialbereich deutlich an. Dennoch blieben Luxusartikel und gute Konsumgüter Mangelware. Schattenwirtschaft und Schwarzmärkte wurden aus den überschüssigen Geldmengen der Haushalte finanziert. Negative Folgen hatten auch der sich ausbreitende Alkoholismus (verstärkt durch eine fehlgeschlagene Alkoholkampagne, bei der die Menschen von den „harten“ Getränken weg sollten und Bier und Wein angepriesen wurde, aber die Jugend fand nun auch Geschmack am Alkohol und er wurde zu einer Volkssucht) und das „Bummelantentum“ (soziale Hängematte). Auch war die Bevölkerung auf dem Land schlechter gestellt und alles funktionierte nur durch Bestechung („Blat“-System). Die „Wertschätzung der sozialen Geborgenheit, die eine totale Verwaltung aller materiellen Verhältnisse selbst auf Kosten bürgerlicher und ökonomischer Freiheiten zu bieten vermag“ war ein zweischneidiges Schwert. Die soziale Sicherheit war der Vorteil, aber die sinkende Arbeitsmoral und die Interesselosigkeit führte zu wachsender Stagnation in der Wirtschaft und Gesellschaft und war eine Bedrohung der Macht.
In der Bildungspolitik wurde auf die Schul- und Hochschulbildung zur Heranbildung geeigneter Fachkräfte für die Entwicklung der UdSSR geachtet. Chruschtschows Schulreform hatte durch die gute Ausbildung von Arbeitskräften das Niveau der wissenschaftlichen Qualifikationen der Hochschulzugänge absinken lassen, dies wurde beseitigt und man kehrte zum allgemeinbildenden Charakter der Mittelschulen zurück. Die polytechnische Bildung wird dabei jedoch fortgesetzt und eine Verordnung von 1977 besagt, das alle Schulabgänger einen Beruf beherrschen sollen. Auf dem XXIV. Parteitag 1973 verabschiedeten die Bildungsplaner ein Grundlagengesetz, darin war eine qualitative Verbesserung der Berufsausbildung, eine Weiterbildung der Kader und die vollständige mittlere Bildung festgeschrieben. Auch Sonderbegabungen sollten optimal eingesetzt werden und verschiedene Verordnungen sorgten deshalb für einen Ausbau von Spezialschulen und eine stärkere Differenzierung der allgemeinbildenden Schulen. Die Hauptaufgabe der Bildung bestand darin die Jugend zu neuen sowjetischen Menschen zu erziehen. Der neue Sowjetmensch hat eine kommunistische Einstellung zur Arbeit und würde deswegen nicht aus Gier nach materiellen Reizen handeln, sondern aus einem höheren Bewusstsein für das Staats- und Parteiinteresse. Diese geförderte sowjetpatriotische Einstellung sollte die ideologischen Einflüsse aus dem Westen von der Jugend fernhalten. Das Mittelschulstatut formuliert es so:
„...den Schülern einen allgemeine mittlere Bildung zu vermitteln, die den gegenwärtigen Erfordernissen des gesellschaftlichen und wissenschaftlich- technischen Fortschritts entspricht; ... eine marxistisch-leninistische Weltanschauung zu formen und die Schüler zu einem tiefempfundenen Patriotismus zu erziehen... wie zur Bereitschaft das sozialistische Vaterland zu verteidigen...“ auch in dem Statut enthalten ist die Wehrerziehung die seit dem Wehrpflichtgesetz 1967 schon Schulbestandteil ist. Sport war einfach nicht mehr nur Sport (die körperliche Erziehung), sondern sollte sich positiv auf die Arbeits- und Verteidigungsbereitschaft auswirken. Jährlich wurden Millionen Jugendliche unter dem Slogan „bereit zur Arbeit und Verteidigung“ auf den Erwerb des Sportabzeichens vorbereitet. Als Konsolidierung der Rolle als Weltmacht wertete der Kreml internationale sportliche Erfolge und halfen dem Sowjetpatriotismus auf die Sprünge. Die Olympischen Spiele in Moskau 1980 wurden vom Großteil des Westens boykottiert aufgrund der Intervention in Afghanistan. Aber jeder sowjetische Sportler konnte bei Erfolg aufsteigen und Privilegien erlangen.
Im kulturpolitischen Bereich sah es erst so aus als würde die Entstalinisierungspolitik fortgesetzt. Politische Häftlinge wurden entlassen und die seit Stalins Tod gewonnenen Freiräume in Kultur und Wissenschaft schienen gewahrt zu bleiben. 1965 wurde der Parteiapparat stark umbesetzt und Stalin als militärischer Führer als positiv gewertet, was eine Verschärfung der Linie prophezeite. Dies zeigte sich Ende 1965 in den ersten Verhaftungen von Intellektuellen und fand im Prozess gegen die beiden Autoren Sinjawinskij und Daniel Anfang 1966 ihren ersten Gipfel. Auch die Verschärfung der Strafmaßnahmen bei Verunglimpfung von Staat und Partei machten den neuen Weg deutlich. Natürlich waren die Intellektuellen nicht bereit ihre Freiheiten passiv wieder herzugeben. Der Versuch die Stalin- Zeit wieder hervorzuholen und die Androhung von Strafen förderte eher die Opposition als das sie sie unterband. Jene hat die bestehenden Dinge nicht in Frage gestellt, sondern „wich“ nur von der ideologischen Richtung der KPdSU ab. Durch die Repressalien, mit denen der Staat der intellektuellen Schicht entgegentrat, verlor sie den Glauben in die Partei als Führungskraft oder sogar in den Sozialismus als beste Gesellschaftsform. Die Dissidentenbewegung ist im Grunde eine Menschen- und Bürgerrechtsbewegung politisch Andersdenkender jeder Richtung, die ihren Anfang bei den Intellektuellen, welche sich offen für die Freiheit von Kunst und Wissenschaft einsetzen, nahm. Schriftsteller forderten die Aufhebung der Zensur und die Umwandlung des Staatsverbandes in eine unabhängige Gesellschaft und Historiker setzten sich mit dem wahren Geschichtsbild, nicht mit dem von der Partei propagierten auseinander. Pressekampagnen wie bei Solschenizyn sollten das Ansehen der „Rebellen“ mindern:„...Solschenizyns Erklärungen... in dem Bestreben die sowjetische Lebensart zu beschmutzen... zieht die sowjetische Jugend in den Dreck und wirft ihr mangelnden „Mut“ und „innere Sklaverei“ vor... er bedauert die völlige Niederlage der Konterrevolution...“ Und Solschenizyn in einem seiner Werke „Lebt nicht von Lügen“:„.. und sie stecken vernünftige Leute in Irrenanstalten... Wir fürchten nur, hinter der Herde zurückzubleiben und allein einen Schritt zu tun- und plötzlich stehen wir dann da, ohne Weißbrot ohne Gasheizung und ohne Wohnberechtigung in Moskau... Wir sind nicht reif genug, um auf die Plätze zu marschieren und die Wahrheit laut hinauszuschreien oder laut zu sagen, was wir denken... ich bin in der Herde und ich bin ein Feigling: Mir ist alles gleichgültig, solange ich nur zu essen habe, solange ich nur ein warmes Zimmer habe...“ Proteste gegen Verhaftungen und Urteile gegen die nicht zur Linie passenden Literaten wurden anfangs nur von Autoren getragen, aber die Kreise wurden immer größer und es schlossen sich Vertreter der technischen Intelligenz und der Naturwissenschaften an. Es entfaltete sich eine politische Opposition, die Herrschaftsanspruch und -praxis in Frage stellt, welche in kleinen Gruppen zergliedert war und so keine Breitenwirkung besaß, aber dennoch hörbar war. Unter Androhung (und Ausführung) von Verlust des Arbeitsplatzes, Haft, Zwangsarbeit, Ausweisung oder Zwangseinweisung in psychiatrische Anstalten forderten die Dissidenten (Gläubige (Juden Krimtataren), Angehörige der unterdrückten Nationalitäten (Ukrainer, Balten, Georgier)) ihre Rechte entweder in offenen Briefen oder im Samisdat, ein. Dieses im Untergrund hergestellte und von Hand zu Hand gereichte Schrifttum (Abkürzung für Selbstverlag) bildete das Informationsmedium über die Ereignisse in der Sowjetunion (Prozesse, die „Besserungsarbeitskolonien“ und Dissidenten in Nervenheilanstalten) und war ein Diskussionsforum reformkommunistischer Ansätze. Die Menschen- und Bürgerrechtsbewegung beruft sich auf die Internationale Charta der Menschenrechte, auf die in der Verfassung verankerten Grundgesetze und die KSZE- Schlussakte von Helsinki. Vor allem stritt sie für die Personen die aufgrund ihrer Überzeugung Repressalien unterworfen waren, die sowjetischen Juden mit ihrem Wunsch auszuwandern und für die Rechte der Nationalitäten in der UdSSR. Die vielen kleinen Gruppen hatten meist gemeinsame Programmpunkte arbeiteten aber aufgrund ihrer Hauptsitze oder unterschiedlicher Zielvorstellungen selten oder nicht zusammen. Medwedew (Reformkommunist) und Sacharow (Liberaler) traten in einem offenen Brief für eine demokratische Reform des Systems und der Gesellschaft ein, die „der Aufrechterhaltung und Stärkung der sozialistischen Ordnung dienen sollte“ die Macht der Partei sichern und der Überwindung der Stagnation dienen sollte. Sacharow dagegen wandte sich von der Vorstellung eines „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ ab und setzte für Reformen bis zum Mehrparteiensystem ein. Er lehnte ein westlichorientiertes System ab. Es war für die jahrhundertelang als Untertanen „erzogene“ Bevölkerung vollkommen ungünstig und er wollte einen Verzicht der Großmachtpolitik.
Die Richtung aus der Chruschtschow- Periode setzt sich auch in der Nationalitätenpolitik fort. Das Sowjetvolk wird 1977 in der Verfassung formuliert:„Eine Gesellschaft hoher Organisiertheit (von der Partei), ideologischer Prinzipienfestigkeit und Bewusstheit der Werktätigen (neue kommunistische Einstellung zur Arbeit= Arbeit ist ein Bedürfnis), die Patrioten und Internationalisten sind.“ Breschnew sah es als Machtverlust, das die Nationen sich annäherten bzw. die Unionsrepubliken hätten aus der Föderation austreten können, denn sie wären autonom geworden. Die Kompetenzen der Republiken waren erweitert worden, auch wenn die Souveränität in der Verfassung nicht mehr Erwähnung findet. Es gab keine „Gleichheit aller Nationen und Völkerschaften“, das beweist der Versuch das Recht auf Nationalsprache aus den Verfassungen der Republiken zu streichen, was Unruhen (Georgien 1978) zur Folge hatte. Die dann aufkommenden Vorwürfe der Opposition waren laut der Partei nur „imperialistische Propaganda“. Die Angleichung wurde z.B. durch Russisch als zweite Muttersprache propagiert, die vom Kindergartenalter gelernt werden sollte. Das wurde Schulen mit der russischen Sprache als Unterrichtssprache und der guten Ausbildung an russischen Universitäten gefördert. Das hätte die Publikationsmöglichkeiten von antisowjetischem Propagandamaterial eingeschränkt. Die Geschichtsschreibung hatte nun den „freiwilligen Anschluss“ der Völker an die UdSSR hervorzuheben. Auch wurden ländertypische Religionen verboten oder verfolgt, Bräuche abgeschafft und sowjetische Feiertage eingeführt. Russen wurden bewusst in anderen Unionsrepubliken zur Verbreitung der russischen Sprache angesiedelt. Künftig musste Russisch zu den Sprachkenntnissen gehören um in die Führungspositionen aufzusteigen oder in einen von einem Russen geführten Betrieb eine Anstellung zu finden. Offene Demonstrationen wie von den Krimtataren oder Russlanddeutschen wegen deren Wunsch in die alten Siedlungsgebiete zurückzukehren wurden durch Massenverhaftungen mundtot gemacht.
Anstatt wie der Alleinherrscher Chruschtschow eine Welle der Willkür über die Kirchen hinwegrollen zu lassen, erfolgte bei der Religionspolitik eine Phase der Beruhigung. Den Schikanenabbau und eine Rechtssicherheit für die Gläubigen brachte die Erkenntnis mit sich, wenn man gegen die eigenen Gesetze verstößt dem Ansehen des Staates zu schaden und der Opposition Nahrung zu geben. Um das Abgleiten der Religionen in den Untergrund zu vermeiden wurde die Befugnis zu m Öffnen und Schließen von Kirchen den Lokalbehören entzogen und dem Rat für die Angelegenheiten der Religionen untergeordnet. Die Verweigerung einer Arbeitsstelle oder eines Studienplatzes oder der Verlust der Studienzulassung aufgrund der Religion wurde untersagt, ebenso die Hinderung der Ausführung von Kulthandlung durch Andersdenkende. Dadurch wurde der beliebigen Behandlung der Gläubigen Grenzen gesetzt und sie den Atheisten formal gleichgestellt, aber das verbesserte nicht die Situation der Religiösen. Glaubensrichtungen, die den Dienst an der Waffe verweigerten waren verboten wie diese, welche mehr als nur Kulthandlungen ausübten (Bibelstunden). Auch wurden neue Religionen nicht mehr registriert und so war es verständlich das sie ein Großteil der Dissidentenbewegung waren.
Die Behandlung der Opposition zeigte nur allzu klar, wo die Rechte der Verfassung ihre Grenzen hatten. Der Diktator Breschnew konnte sich nicht aus der Klemme lösen einerseits das Volk aus dem Schlaf zu wecken und andererseits der Regierung allumfassende Macht zuzugestehen. Der spürbar ausgeweitete Absatz über die Grundrechte war durch Machtzugeständnisse an die Partei belangloser ausgefallen als er sein sollte. Was von der Gleichberechtigung, der Freiheit des Schaffens und dem Verbot der Verfolgung wegen Kritik zu halten war offenbarte die Behandlung der Dissidenten.
Die Breschnew-Ära wird heute als Zeit der Stagnation bezeichnet oder auch als Restalinisierung gesehen. Das erste Ziel was sich durch die ganze Regierungszeit zieht war die Machtsicherung der Partei. In dieser Hinsicht war jene Phase eine Fortsetzung der Stalinära auch auf die Politik gegenüber politisch Andersdenkenden und der Kunst bezogen, wobei die Methoden nicht annähernd an die Stalinära heranreichen. Wirtschaftlich waren Reformansätze da, doch die Konservativität der Nomenklatur und Parteispitze hinderte jegliche Entwicklung und der Rückstand zu den Industrienationen vergrößerte sich unüberwindbar groß. Offen wurde die Russifizierungspolitik betrieben und die Souveränität der Unionsrepubliken ging verloren.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Leonid I. Breschnew: Innenpolitik"?
Der Text behandelt die Innenpolitik unter Leonid Breschnew in der Sowjetunion, die auf die Ära Stalins und Chruschtschows folgte. Er analysiert Breschnews Aufstieg zur Macht, die Konsolidierung der Parteikontrolle, die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik, die Bildungspolitik, die Kulturpolitik (insbesondere die Behandlung von Dissidenten) und die Nationalitätenpolitik.
Wie kam Breschnew an die Macht?
Nach Chruschtschows Sturz übernahm eine "kollektive Führung" die Macht, bestehend aus Breschnew, Kossygin und Podgornyj. Breschnew stieg in dieser Konstellation immer weiter auf und übernahm schließlich nach dem Sturz Podgornyjs 1977 auch dessen Amt des Staatsoberhaupts.
Welche Ziele verfolgte Breschnews Innenpolitik?
Die Hauptziele waren die Stabilisierung der Partei und der Gesellschaft nach der Verunsicherung durch Chruschtschows Politik, die Wiederherstellung der Parteikontrolle, die Steigerung der Wirtschaftskraft, die Verbesserung des Lebensstandards und die Förderung des Sowjetpatriotismus.
Wie versuchte Breschnew, die Wirtschaft zu verbessern?
Es gab Ansätze zur Verbesserung der zentralen Planung und Wirtschaftsleitung, zur Förderung der Leistungsbereitschaft durch Sozialpolitik und verbesserte Wirtschaftsverwaltung. Kossygin setzte sich für eine Minderung der zentralen Kontrolle und größere Selbstständigkeit der Betriebe ein. Es gab jedoch Widerstand gegen eine Kürzung der Rüstungsausgaben und eine umfassende Verselbstständigung des Wirtschaftsapparates.
Welche Rolle spielte die Sozialpolitik unter Breschnew?
Die Sozialpolitik spielte eine wichtige Rolle, um die Zufriedenheit der Bevölkerung zu erhöhen und die Macht innenpolitisch zu sichern. Es gab Erhöhungen der Mindestlöhne und Altersrenten, Verbesserungen für Kolchosbauern, Geburtenbeihilfen und Kindergeld. Trotzdem blieben viele Probleme bestehen, wie z.B. Wohnungsmangel, Mangelwirtschaft und Alkoholismus.
Wie sah die Bildungspolitik unter Breschnew aus?
Die Bildungspolitik konzentrierte sich auf die Schul- und Hochschulbildung, um Fachkräfte für die Entwicklung der UdSSR heranzubilden. Es wurde Wert auf eine allgemeinbildende Mittelschule gelegt, aber auch die polytechnische Bildung fortgesetzt. Ein wichtiges Ziel war die Erziehung der Jugend zu neuen sowjetischen Menschen mit einer kommunistischen Einstellung zur Arbeit und einem ausgeprägten Sowjetpatriotismus.
Wie wurden Dissidenten unter Breschnew behandelt?
Obwohl es anfangs so aussah, als würde die Entstalinisierungspolitik fortgesetzt, kam es bald zu einer Verschärfung der Linie gegenüber Intellektuellen und Andersdenkenden. Es gab Verhaftungen, Prozesse und Repressalien. Die Dissidentenbewegung forderte Menschen- und Bürgerrechte und berief sich auf die Internationale Charta der Menschenrechte und die KSZE-Schlussakte von Helsinki.
Wie gestaltete sich die Nationalitätenpolitik unter Breschnew?
Die Nationalitätenpolitik war geprägt von dem Versuch, die Nationen einander anzunähern und die Kompetenzen der Republiken zu erweitern, aber gleichzeitig die zentrale Kontrolle zu stärken. Es gab eine Förderung des Russischen als zweiter Muttersprache und eine Einschränkung der Rechte auf Nationalsprache. Proteste von Nationalitäten wie den Krimtataren und Russlanddeutschen wurden unterdrückt.
Wie wurde die Religionspolitik umgesetzt?
Die Religionspolitik war zunächst von einer Phase der Beruhigung geprägt, um das Abgleiten der Religionen in den Untergrund zu vermeiden. Es gab eine formale Gleichstellung der Gläubigen und Atheisten, aber Glaubensrichtungen, die den Dienst an der Waffe verweigerten oder mehr als nur Kulthandlungen ausübten, waren verboten. Neue Religionen wurden nicht mehr registriert.
Wie wird die Breschnew-Ära heute bewertet?
Die Breschnew-Ära wird heute oft als Zeit der Stagnation oder Restalinisierung bezeichnet. Es gab zwar Reformansätze, aber die Konservativität der Nomenklatur und Parteispitze hinderte eine Weiterentwicklung. Der Rückstand zu den Industrienationen vergrößerte sich und die Souveränität der Unionsrepubliken ging verloren.
- Quote paper
- Olaf Nestler (Author), 2001, Leonid I. Breschnew: Innenpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101976