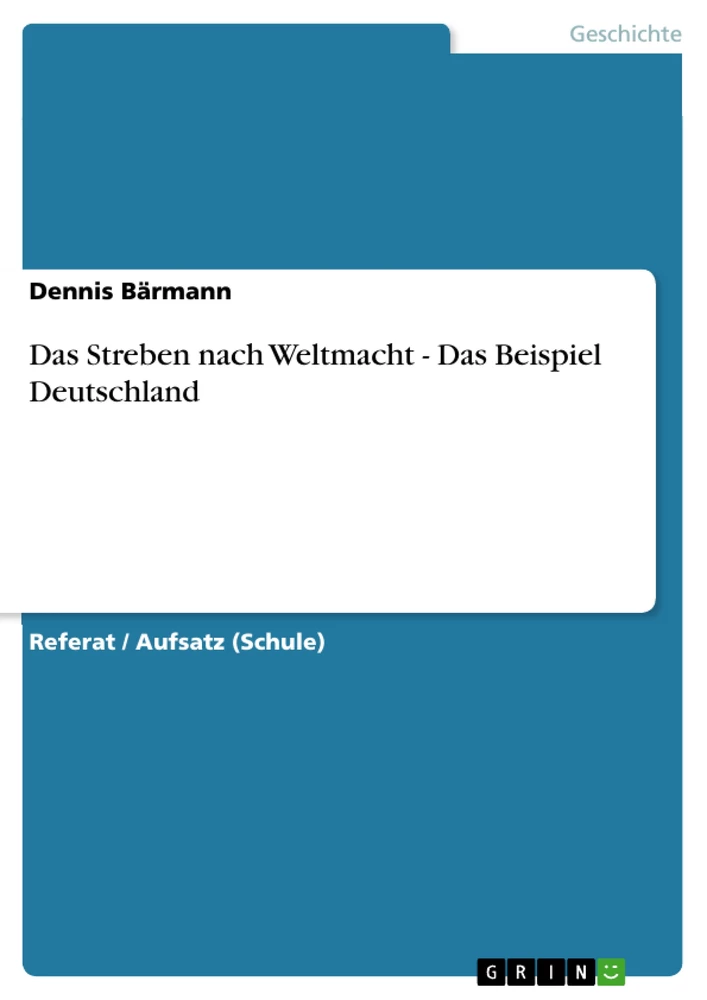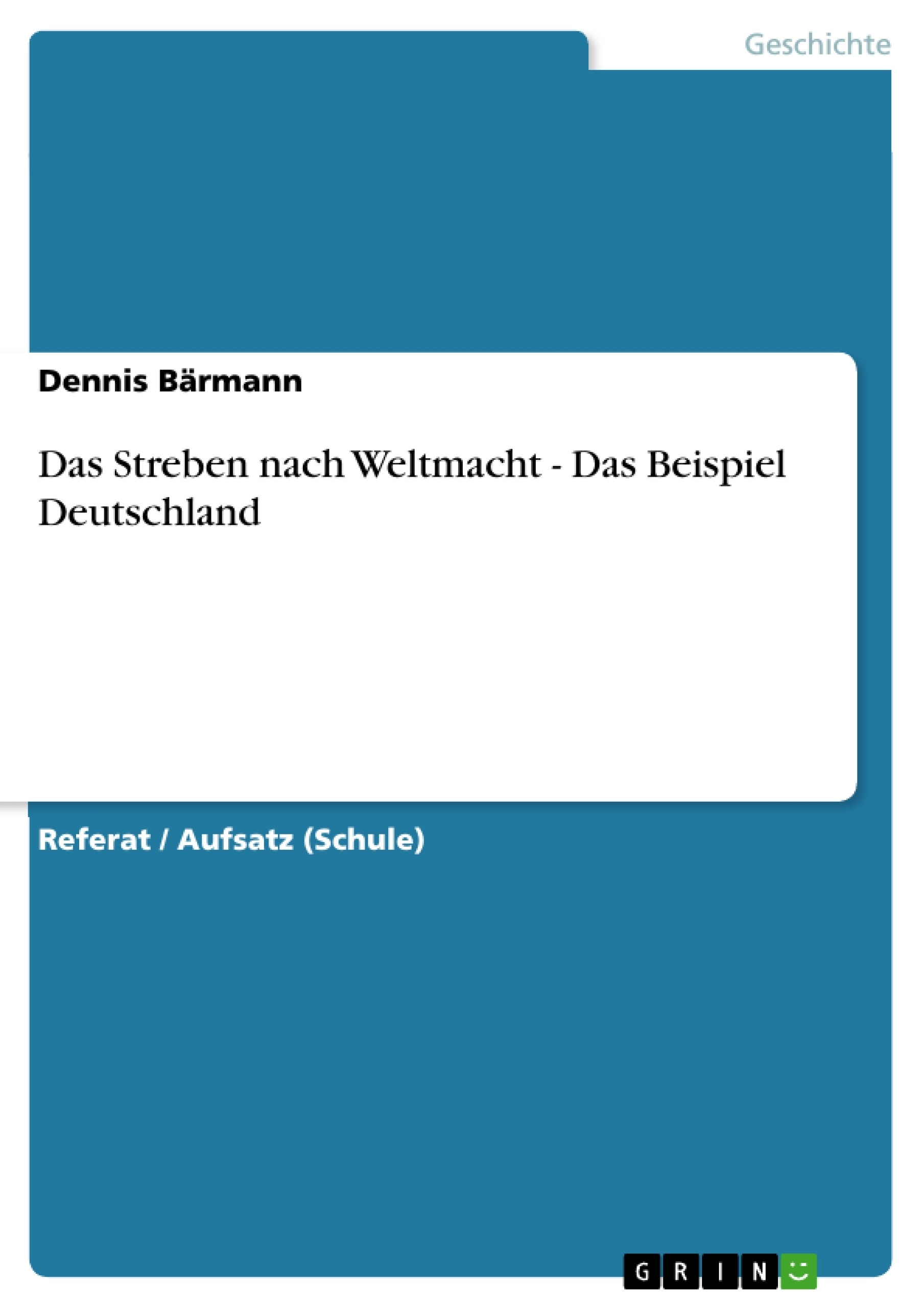Was trieb Deutschland an, sich in das mörderische Rennen um Kolonien zu stürzen? Tauchen Sie ein in die düstere Epoche des deutschen Imperialismus, eine Zeit des rasanten Wandels, der sozialen Spannungen und des unerbittlichen Strebens nach Weltmacht. Dieses Buch enthüllt die komplexen Hintergründe, die Deutschland im späten 19. Jahrhundert dazu bewegten, seinen "Platz an der Sonne" zu fordern. Von der Massenarmut und den wirtschaftlichen Nöten im eigenen Land bis hin zu den strategischen Überlegungen Bismarcks und dem aggressiven Expansionsdrang Wilhelms II., werden die vielfältigen Motive beleuchtet, die zur Gründung von Kolonien in Afrika, Asien und der Südsee führten. Erfahren Sie, wie anfängliche Konzepte privater Handelskolonien unter dem Druck wirtschaftlicher Realitäten scheiterten und in staatliche Kronkolonien umgewandelt wurden, wodurch immense Kosten für das Deutsche Kaiserreich entstanden. Analysiert werden die Rolle von Kolonialgesellschaften, die Politik der Kolonialgründer und die verheerenden Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung. Entdecken Sie, wie das Wettrüsten mit England und Frankreich, angetrieben durch kolonialeProfite und nationalistische Ambitionen, Europa an den Rand des Abgrunds brachte und schließlich im Ersten Weltkrieg mündete. Eine fesselnde Analyse der deutschen Kolonialgeschichte, die nicht nur die politischen und wirtschaftlichen Aspekte, sondern auch die ideologischen Grundlagen und die verheerenden Folgen dieser dunklen Epoche beleuchtet. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die die Ursachen und Konsequenzen des Imperialismus verstehen und die Parallelen zur heutigen globalen Politik erkennen wollen. Dieses Buch bietet tiefe Einblicke in die Mechanismen von Macht, Expansion und Ausbeutung, die bis heute unsere Welt prägen. Begleiten Sie uns auf einer Reise in eine Vergangenheit, die uns hilft, die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft verantwortungsvoll zu gestalten. Untersuchen Sie die dunklen Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte, von Deutsch-Südwestafrika bis Deutsch-Ostafrika, und gewinnen Sie ein umfassendes Verständnis der Motive, Methoden und Auswirkungen des deutschen Kolonialismus. Eine kritische Auseinandersetzung mit einem oft verdrängten Teil der deutschen Geschichte, die zum Nachdenken anregt und neue Perspektiven eröffnet.
Das Streben nach Weltmacht: Das Beispiel Deutschland
Die Situation in Deutschland zu Beginn des Imperialismus:
Eine rapide Zunahme der Bevölkerung in Deutschland führte dazu, dass das Getreide und das Vieh in Deutschland knapp wurde und man Gefahr lief, dass sich das Land nicht mehr selbst versorgen konnte. Die knappen Lebensmittel wurden immer teurer .Der durchschnittliche Arbeitslohn wurde immer weniger als folge des schwachen Gewerbes und der Industrie, die unter der geringen Kaufkraft des Volkes litten.
Es herrschte Massenarmut und soziale Not.
Warum wurden überhaupt Kolonien gegründet:
Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern erst sehr spät in die Kolonialpolitik eingestiegen. Das liegt nicht zuletzt an der hartnäckigen antikolonialen Politik Bismarcks bis in die Mitte der 80er Jahre. Ein weiterer Grund für die Verspätung Deutschlands in der Kolonialpolitik war die späte Industrialisierung. Denn wichtige Aspekte für den Erwerb von Kolonien waren Rohstoffressourcen und Absatzmärkte in diesen Gebieten, die der Industrie nützten.
Ein weitere Grund war die Massenarmut und die sozialen Not. Deshalb gründeten die Deutschen zwei Grundformen von Kolonien:
1. Ackerbau-Kolonie: Diese wurden in gemäßigten Zonen errichtet um das Mutterland mit Nahrungsmittel zu versorgen. Sie sollten sich als europäische Tochterstaaten entwickeln. Man subventionierte diese Kolonien um später von den reichen und starken Kolonien zu profitieren. Die Kolonien tauschten ihre Waren und Erzeugnisse gegen Industrie-Erzeugnisse des Mutterlandes ein.
2. Handels - Kolonie: Aufgrund der geographischen Lage dieser Kolonien in den Tropen konnte hier keine Landwirtschaft betrieben werden. Auch eigneten sich das dortige Klima nicht für eine Besiedelung. Diese Kolonien trieben handel mit Deutschland, das heißt es wurden Waren in die Kolonien Exportiert und Waren aus den Kolonien nach Deutschland importiert.
Bismarcks Kolonialpolitik:
Bismarck verfolgte eine ziemlich passive Kolonialpolitik und das obwohl während seiner Regierungszeit die meisten Kolonien gegründet wurden. Er wollte kein Land zum Ausbeuten oder zum Besiedeln erobern, sonder propagierte, dass Reiche Deutsche Kaufleute und Händler Kolonien gründen sollten. Diese neu gegründeten Unternehmungen sollten staatliche Beihilfen erhalten, sogenannte Deutsche Schutzbriefe. Er wollte also keine Provinzen sondern deutsche Unternehmen, die alle Rechte besitzen, z.B. kaufmännische Souveränität, freie Entwicklung, Schutz durch Deutschland, etc.). Somit war der Staat größtenteils abgesichert, denn bei Niedergang der Kolonie trugen die Unternehmer das Risiko
Resultate der Kolonialpolitik Bismarcks
Die von Bismarck favorisierte Organisationsform der Handelskolonie, getragen von privat finanzierten Gesellschaften, scheiterte bereits nach wenigen Jahren.
Bereits im Herbst 1886 erwarb der Staat Anteile an der Deutschen Ostafrikanischen Gesellschaft im Wert von einer halben Million Mark und wurde somit zum größten Anteilseigner. Bis 1. Januar 1891 wurden alle Schutzgebiete in Kronkolonien umgewandelt, da sich die Kolonien für die Betreiber nicht wirtschaftlich rentierten. Geringe Export- und Importbilanzen entsprachen bei weitem nicht den erwarteten Zahlen.
Auch politische Wünsche der Kolonialbefürworter erfüllten sich nicht. Lediglich 1200 Menschen wanderten innerhalb von 13 Jahren (1880-93) in die außereuropäischen Gebiete aus. Der weitaus größere Teil versuchte sein Glück wie schon seit Jahrzehnten auf dem amerikanischen Kontinent. Man führte als Gründe für die Auswanderungshemmungen schlechte Klima- und Bodenverhältnisse in den Kolonien an. Europäer könnten in den Schutzgebieten wegen des tropischen Klimas keine körperliche Arbeit verrichten. Außerdem bestehe die Gefahr der Ansteckung mit tropischen Krankheiten. Das einzige deutsche Schutzgebiet, das nicht in den Tropen liege, sei Südwestafrika. Wegen Mangel an Wasser und Holz seien jedoch in diesen Gebiet jegliche Versuche zur Bodenbearbeitung gescheitert. Vielmehr verursachten deutsche Überseegebiete immense Kosten für das Deutsche Kaiserreich. Die Unterhaltungskosten der Beamten und die Entsendung der Schutztruppen, um immer wieder vorkommende Aufstände der Eingeborenen aufzulösen, bedingten horrende Unkosten.
Beginn der Kolonialgründung
Ab 1884 begann die eigentliche Kolonialpolitik Deutschlands. Innerhalb von 2 Jahren (188486) stellte das Deutsche Reich mehrere Gebiete in Südwestafrika, Togo, Kamerun, Ostafrika und in Pazifik unter Schutz. Bismarck wollte seine Kolonialpolitik nach dem Vorbild Englands gestalten. Privatunternehmen wurde es mit Hilfe der staatlichen Schutzbriefe ermöglicht, sicher vor Ort zu agieren. Die staatliche Intervention sollte auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Zu den Deutschen Kolonien gehörten Togo, Kamerun, Deutsch Ostafrika (Tansania), Deutsch Südwest Afrika (Namibia), Tsingtau (Korea (teilweise), Papua-Neuguinea, Marshallinseln, Samoainseln und die Karolineninseln
Kolonialgesellschaften
Um die Interessenschaften von Privatinverstoren zu vereinigen, wurden zur Zeit der Kolonialpolitik Deutschlands Kolonialgesellschaften gegründet. 1884 gründete Carl Peters die "Gesellschaft für deutsche Kolonisation" und im Jahr darauf die "Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft". Im selben Jahr wurde auch die "Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika" errichtet.
Ein einzelner Kaufmann konnte in den meisten Fällen wenig Einfluß auf die Politik ausüben. Durch Zusammenschlüsse der einzelnen Privatinvestoren entstand eine Lobby, die genügend Druck auf die Staatsführung ausüben konnte, um ihre Ziele zu erreichen. Sicherung der wirtschaftlichen Prosperität durch Erwerb von Kolonien war die Hautpintention der Mitglieder. Ein weiterer Grund war die einfachere Verwaltung der einzelnen Gebiete.
Die Kolonialgesellschaften waren nicht vom Staat abhängig, sie hatten primär wirtschaftliche Interessen und ihre Gebiete würden vom Staat lediglich im Falle eines Angriffes verteidigt.
Politik der Kolonialgründer:
Ganz anders als Bismarcks passive Kolonialpolitik sah hingegen die Politik der Koloniegründer aus. Ihrer Meinung nach lebte der Mensch in einem Daseinskampf, der Sieger und Verlierer hervor brachte. Dieser Kampf konnte nicht durch Friedensverträge beigelegt werden, sondern nur durch das Übergewicht einer Nation gegen eine andere. Auch durch den raschen Bevölkerungsanstie g in Deutschland musste das deutsche Gebiet vergrößert werden. Durch die Gründung von Kolonien und der Unterwerfung der Einheimischen sollte der Lebensraum einer höheren Kultur vergrößert werden, damit diese eine noch höhere Entwicklungsstufe geistiger und kultureller Natur erreichten konnte.
Deshalb lief die Kolonialpolitik nach dem Motto ab: Bereicherung des eigenen Volkes auf Kosten eines schwächeren. Die nutzlos gespeicherten Reichtümer der schwächeren Nation wurden zum Wohle der deutschen Kultur geplündert.
Wilhelminische Kolonialpolitik
Im Juni 1888 bestieg Wilhelm II. im Alter von 29 Jahren den deutschen Kaiserthron. Dieser wollte sich viel intensiver mit der Politik befassen, als es sein Großvater Wilhelm I. getan hat. Mit seinem aufbrausenden Temperament und seiner Begeisterung für alles Militärische "verschärfte er den Ton deutscher Politik erheblich". Die Differenzen vom Bismarck und Wilhelm II. führten zur Entlassung des Reichskanzlers Bismarck Alle Kolonien ließ der Kaiser 1891 dem Auswärtigen Amt in Berlin unterstellen. Der Kaiser gab auch die defensive Kolonialpolitik Bismarcks auf. Er wollte für die "zu spät gekommene Nation" einen "Platz an der Sonne schaffen". Im Gegensatz zu Bismarck wollte er durch Erwerb von Kolonien die Macht Deutschlands stärken. Das Schüren nationaler Gefühle der Deutschen und die provokative Aufrüstung (u.a. Risikoflotte Tirpitz‘) ließen das komplizierte Bündnis- und Gleichgewichtssystem Bismarcks endgültig zusammenbrechen Um die hohe Arbeitslosigkeit zu besiegen und um die Wirtschaft anzukurbeln begann Deutschland ein Wettrüsten mit England und Frankreich mit dem Geld, das sie über die Kolonien eingenommen hatten. Sie wollten die Herrschaft auf dem Meer erreichen. Dies war eine offensichtliche Provokation an England. Diese sahen die große deutsche Flotte als Bedrohung an.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Streben nach Weltmacht: Das Beispiel Deutschland"
Was war die Situation in Deutschland zu Beginn des Imperialismus?
Zu Beginn des Imperialismus erlebte Deutschland ein rasantes Bevölkerungswachstum, was zu einer Verknappung von Getreide und Vieh führte. Das Land drohte, sich nicht mehr selbst versorgen zu können, die Lebensmittelpreise stiegen, und die Arbeitslöhne sanken aufgrund einer schwachen Gewerbe- und Industrielage. Es herrschte Massenarmut und soziale Not.
Warum wurden überhaupt Kolonien gegründet?
Deutschland stieg im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ spät in die Kolonialpolitik ein. Dies lag an Bismarcks antikolonialer Politik bis Mitte der 1880er Jahre und der späten Industrialisierung. Der Erwerb von Kolonien war wichtig, um Rohstoffe zu sichern und Absatzmärkte für die Industrie zu schaffen. Massenarmut und soziale Not waren weitere Gründe. Es wurden zwei Grundformen von Kolonien gegründet: Ackerbau-Kolonien und Handels-Kolonien.
Wie sah Bismarcks Kolonialpolitik aus?
Bismarck verfolgte eine eher passive Kolonialpolitik, obwohl während seiner Regierungszeit die meisten Kolonien gegründet wurden. Er wollte kein Land ausbeuten oder besiedeln, sondern befürwortete, dass deutsche Kaufleute und Händler Kolonien gründen sollten, die staatliche Beihilfen (Deutsche Schutzbriefe) erhielten. Der Staat sollte weitgehend abgesichert sein, da die Unternehmer das Risiko bei einem Niedergang der Kolonie trugen.
Welche Resultate hatte Bismarcks Kolonialpolitik?
Die von Bismarck bevorzugte Organisationsform der Handelskolonie, die von privat finanzierten Gesellschaften getragen wurde, scheiterte bereits nach wenigen Jahren. Der Staat erwarb Anteile an Kolonialgesellschaften und wandelte die Schutzgebiete bis 1891 in Kronkolonien um, da sie sich für die Betreiber nicht wirtschaftlich rentierten. Die politischen Wünsche der Kolonialbefürworter erfüllten sich ebenfalls nicht, da nur wenige Menschen in die Kolonien auswanderten.
Wann begann die eigentliche Kolonialpolitik Deutschlands?
Die eigentliche Kolonialpolitik Deutschlands begann ab 1884. Innerhalb von zwei Jahren stellte das Deutsche Reich mehrere Gebiete in Südwestafrika, Togo, Kamerun, Ostafrika und im Pazifik unter Schutz. Bismarck wollte seine Kolonialpolitik nach dem Vorbild Englands gestalten, indem er Privatunternehmen mit Hilfe staatlicher Schutzbriefe ein sicheres Agieren vor Ort ermöglichte.
Welche Gebiete gehörten zu den Deutschen Kolonien?
Zu den Deutschen Kolonien gehörten Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika (Tansania), Deutsch-Südwestafrika (Namibia), Tsingtau (Korea, teilweise), Papua-Neuguinea, die Marshallinseln, die Samoainseln und die Karolineninseln.
Was waren Kolonialgesellschaften und welche Rolle spielten sie?
Um die Interessen von Privatinvestoren zu vereinen, wurden Kolonialgesellschaften gegründet. Diese Gesellschaften, wie die "Gesellschaft für deutsche Kolonisation" und die "Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft", dienten als Lobby, um Druck auf die Staatsführung auszuüben und die wirtschaftliche Prosperität durch den Erwerb von Kolonien zu sichern. Sie waren primär an wirtschaftlichen Interessen orientiert und nicht vom Staat abhängig.
Wie unterschied sich die Politik der Koloniegründer von der Bismarcks?
Im Gegensatz zu Bismarcks passiver Kolonialpolitik sahen die Koloniegründer den Menschen in einem Daseinskampf, der Sieger und Verlierer hervorbrachte. Sie waren der Meinung, dass das deutsche Gebiet vergrößert werden müsse und die Kolonialpolitik die Bereicherung des eigenen Volkes auf Kosten eines schwächeren Volkes bedeute.
Wie sah die Wilhelminische Kolonialpolitik aus?
Unter Wilhelm II. intensivierte sich die deutsche Kolonialpolitik. Wilhelm II. strebte nach einem "Platz an der Sonne" für die "zu spät gekommene Nation" und wollte durch den Erwerb von Kolonien die Macht Deutschlands stärken. Das Schüren nationaler Gefühle und die Aufrüstung, insbesondere der Aufbau einer großen Flotte unter Tirpitz, führten zu einem Wettrüsten mit England und Frankreich, das bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges andauerte.
- Quote paper
- Dennis Bärmann (Author), 2001, Das Streben nach Weltmacht - Das Beispiel Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101972