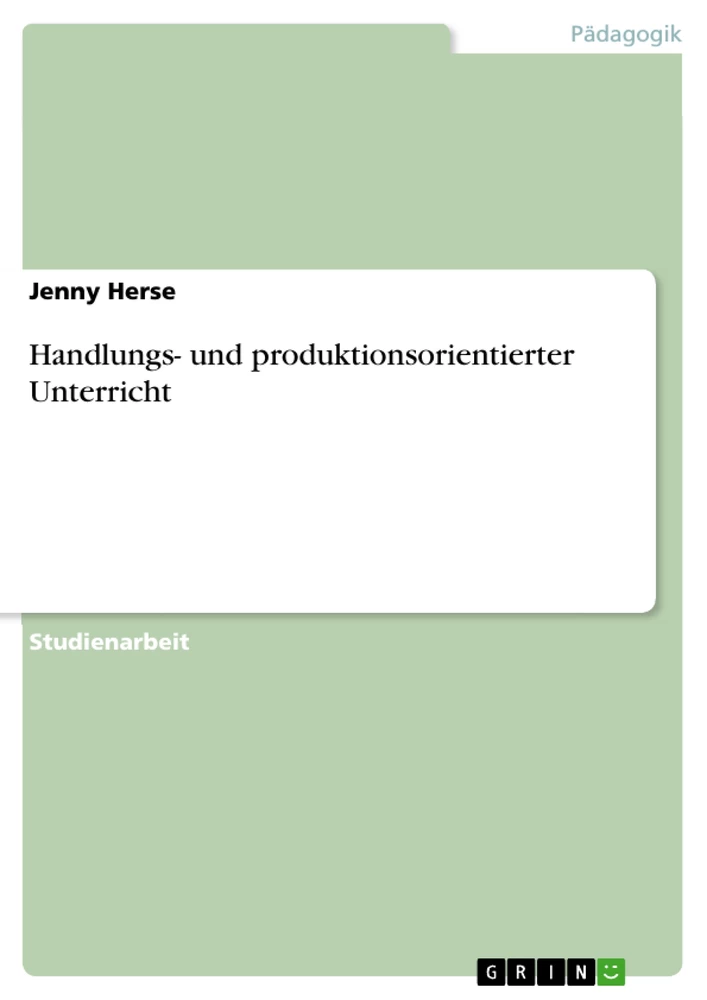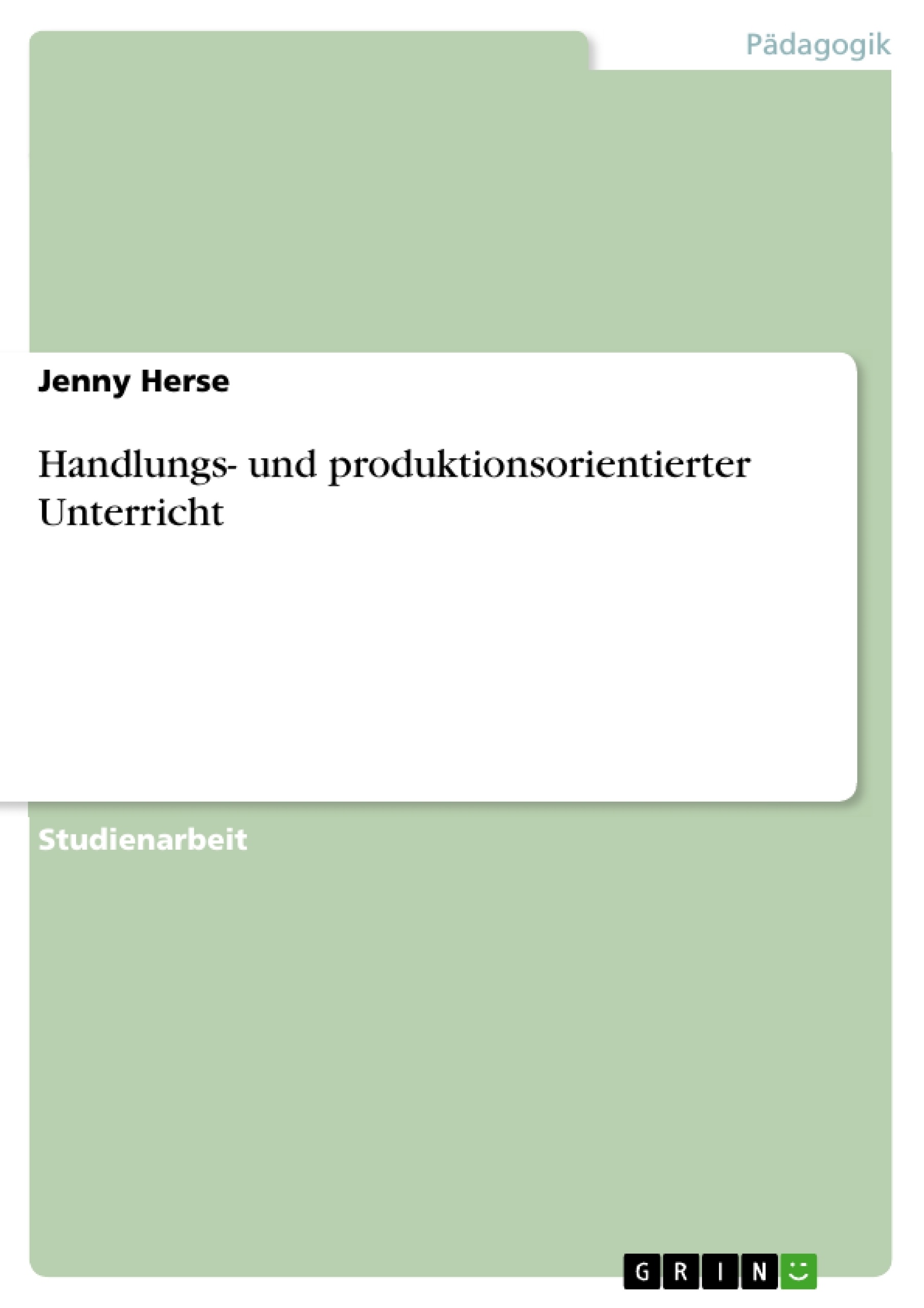Was wäre, wenn der Schlüssel zur Entfaltung des vollen Potenzials junger Geister nicht in der reinen Wissensvermittlung, sondern im aktiven Erleben und Gestalten des Lernstoffes läge? Diese Frage steht im Zentrum einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit dem handlungs- und produktionsorientierten Unterricht, einem innovativen didaktischen Ansatz, der das Klassenzimmer in einen dynamischen Raum der Kreativität und des Engagements verwandelt. Entdecken Sie, wie dieser Ansatz, der auf den Prinzipien der Selbsttätigkeit, Mitbestimmung und Individualisierung basiert, die Schüler dazu befähigt, über den traditionellen Rahmen des Lernens hinauszugehen und eine tiefere, persönlichere Verbindung zum Lernstoff aufzubauen. Von den historischen Wurzeln, die bis zu Comenius und Pestalozzi zurückreichen, bis hin zu modernen Anwendungen im Literaturunterricht, wird untersucht, wie das Konzept die Kluft zwischen Theorie und Praxis überbrückt, die Motivation steigert und die Kooperationsfähigkeit fördert. Im Fokus steht dabei die Lyrik, deren vielfältige Interpretations- und Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des handlungsorientierten Unterrichts neu ausgelotet werden. Lassen Sie sich inspirieren von praktischen Beispielen, die zeigen, wie Schüler durch Verskombinatorik, Parallelgedichte und szenische Interpretationen zu einem produktiven und lustvollen Umgang mit Sprache und Literatur finden. Doch auch die kritischen Stimmen kommen zu Wort: Ist die Gefahr einer zu starken Verlagerung des Fokus vom Text hin zum kreativen Prozess berechtigt? Wie lässt sich sicherstellen, dass die gewonnenen Erfahrungen stets auf den literarischen Text bezogen bleiben? Eine umfassende Analyse, die sowohl die unbestreitbaren Vorteile als auch die potenziellen Herausforderungen dieses Ansatzes beleuchtet und Lehrkräften wertvolle Impulse für die Gestaltung eines lebendigen, schülerzentrierten Unterrichts bietet. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Lernen zum Abenteuer wird und jeder Schüler die Chance hat, seine eigene Stimme zu finden und zu entfalten. Erfahren Sie, wie handlungs- und produktionsorientierter Unterricht dazu beitragen kann, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch kritisches Denken, Kreativität und soziale Kompetenzen zu fördern – Fähigkeiten, die in der heutigen komplexen Welt unerlässlich sind. Diese Arbeit ist ein Muss für alle Pädagogen, die nach Wegen suchen, ihre Schüler zu begeistern, zu fördern und auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Es werden neue Perspektiven eröffnet, wie der Unterricht zu einem Ort der Entdeckung, des Wachstums und der persönlichen Entfaltung werden kann, an dem Schüler nicht nur lernen, sondern auch leben und erleben. Der handlungs- und produktionsorientierte Unterricht erweist sich somit als ein kraftvolles Werkzeug, um die nächste Generation auf eine Zukunft vorzubereiten, in der Kreativität, Zusammenarbeit und kritisches Denken mehr denn je gefragt sind.
EINLEITUNG
In dieser Hausarbeit beschäftige ich mich mit handlungs- und produktionsorientiertem Unterricht.
Meine Hausarbeit lässt sich grob in fünf Teile gliedern.
Als erstes werde ich auf die Konzeption des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts eingehen, wobei ich hier den Schwerpunkt auf den Literaturunterricht lege. Der zweite Aspekt meiner Arbeit beschäftigt sich mit den geschichtlichen Hintergründen, wobei ich stärker auf die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten eingehen werde, als auf die Vorläufer dieses didaktischen Modells.
Die Frage nach dem Sinn von handlungs- und produktionsorientiertem Unterricht zeichnet den dritten Abschnitt aus. Der enge Zusammenhang von Handeln und Denken, die Notwendigkeit der Integration der Lernschwächeren und der Motivation der Schüler als auch die in der heutigen Berufswelt als grundlegende Voraussetzung angesehene Fähigkeit zur Kooperation wird begründet.
Der vierte Punkt befasst sich schließlich mit den Anwendungsmöglichkeiten von Lyrik im handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht. Hier werden vor allen Dingen die Aufgaben hervorgehoben, für die es gilt, kreativ zu arbeiten, da ich diesen Aspekt für ein besonders wichtiges Kennzeichen des produktiven Umgangs mit Lyrik halte.
Um die verschiedensten Varianten allein eines einzigen Aspekts zu unterstreichen, habe ich meinen Schwerpunkt hierbei auf die Verskombinatorik gelegt. Dadurch versuche ich die unendlichen Möglichkeiten, die ein handlungs- und produktionsorientierter Unterricht mit sich bringt, ins rechte Licht zu rücken. Im fünften Punkt möchte ich kurz und knapp einige wertende Urteile bezüglich des produktions- und handlungsorientierten Unterrichts vorstellen. Abschließend nehme ich eine kritische Bewertung des didaktischen Modells vor.
1. HANDLUNGS - UND PRODUKTIONSORIENTIERTER (LITERATUR)UNTERRICHT
1.1 EINE DEFINITION NACH HILBERT MEYER
Der Begriff der Handlungsorientierung ist in der pädagogischen Literatur keineswegs eindeutig definiert, was jedoch für eine noch lebendige Entwicklung spricht. Trotz der auftauchenden Mehrdeutigkeit des Begriffes möchte ich, um zu einer ersten, wenn auch zunächst noch recht abstrakten Idee zu gelangen, was mit "handlungs- und produktionsorientiertem Unterricht" überhaupt gemeint sein könnte, mit einem Zitat Hilbert Meyers einsteigen:
"Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses leiten, so daß Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können."1
1.2 ZUR KONZEPTION EINES HANDLUNGS- UND PRODUKTIONSORIENTIERTEN UNTERRICHTS
Mit dem Begriff "handlungsorientierter Unterricht" wird ein Unterrichtskonzept bezeichnet, dass Schülern einen - wie der Name schon besagt - handelnden Umgang mit den Lerngegenständen und Lerninhalten des Unterrichts ermöglichen soll. Die Beseitigung der Trennung von Kopf - und Handarbeit ist besonders wichtig für einen handlungs- und produktionsorientierten Unterricht, wie auch Hilbert Meyer es oben schon betont hat. Ebenso unerlässlich und unmittelbar daraus folgend ist die Abschaffung der Isolierung der Theorie von der Praxis.2
Anstelle eines rein analytischen Vorgehens soll Schülern ermöglicht werden, durch aktive und handelnde Auseinandersetzung mit den einzelnen Themen eine engere Verbindung zwischen Schule und Leben zu schaffen.
Ziel ist es also, Schule und Leben enger zusammenzubringen.3
Handlungsorientierter Unterricht berücksichtigt die Verschiedenheit der Schüler, da er nicht nur kognitive, sondern sehr vielfältige Handlungszugänge ermöglicht. Aktives und entdeckendes Fragen der Kinder soll gefördert werden, in dem der Lehrkörper seinen Schülern ermöglicht, spielerisch zu üben und selbstständig zu lernen.4 Das Lesen und Begreifen von Texten wird somit als ein produktives Mitgestalten verstanden, welches im Unterricht am ehesten durch operative und phantasievolle Verfahren erzielt werden kann.5
1.2.1 PLANUNG EINES HANDLUNGSORIENTIERTEN LITERATURUNTERRICHTS
Ein Lehrer hat zwei grundlegende Möglichkeiten, um handlungs- und produktionsorientierten Unterricht vernünftig zu planen: Entweder plant er in sein persönliches Unterrichtskonzept möglichst viele Handlungselemente mit ein, oder er plant gemeinsam mit seinen Schülern, allerdings so, dass er als Lehrer der Klasse Themenvorschläge unterbreitet, die dem Interesse der Schüler entsprechen.6 So fühlen sich die Schüler für den geplanten Unterricht mitverantwortlich und denken und organisieren eher mit.
Weiterhin dient diese "Arbeitsteilung" auch der Entlastung des Lehrkörpers, da sich die Klasse ohne Anweisungen und Befehle zu großen Teilen selbst organisiert. Lässt der Lehrer seine Schüler an der Unterrichtsplanung teilhaben, entspricht das demokratischen Grundsätzen und der Unterricht ist nicht mehr nur eine alleinige Veranstaltung des Lehrers.7
1.3 KONKLUSION
Folgende Punkte sind grundlegende Hauptmerkmale eines handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts:
1. Der Unterricht ist praxisorientiert.
2. Lehrer und Schüler nehmen mit Freude und Eigeninitiative am Unterricht teil.
3. Kinder haben die Möglichkeit, ihre Neugierde zu befriedigen und auszuleben.
4. Spontaneität wird gefördert.
5. Es entsteht eine Chancengleichheit und somit eine ausgleichende Gerechtigkeit für leistungsschwächere Schüler.8
6. Kinder haben die Möglichkeit, entdeckend, forschend, kooperativ, mit allen Sinnen und mehrperspektivisch zu lernen.9
Ein handlungs- und produktionsorientierter Unterricht bemüht sich, emotionale, imaginative und kognitive Prozesse zu verbinden und hat als Bildungsziel die Selbsttätigkeit und die Selbständigkeit der Schüler vor Augen. Konsequenterweise legt der handlungs- und produktionsorientierte Unterricht viel Wert auf die Mitbestimmung, Individualisierung, Kreativität und Phantasie der Schüler.
Dieses geschieht um die Motivation der Schüler zu steigern, ihr Interesse für Literatur zu wecken und durch intensive Auseinandersetzung mit Themen auch bei leistungsschwächeren Schülern das Verständnis zu vertiefen und literarisches Wissen auszubauen.
2. DAS HISTORISCHE UMFELD DES HANDLUNGS -UND PRODUKTIONSORIENTIERTEN UNTERRICHTS
2.1 HISTORISCHE VORLÄUFER
Das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts basiert auf einer theoretischen Tradition, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Allerdings wurde sie erst in den letzten fünfzehn Jahren zu ihrem jetzigen Stand in der Diskussion entwickelt. In der Entwicklungslinie sind Comenius, Rousseau, Pestalozzi und Schleiermacher wohl die bedeutendsten Vertreter des handlungsorientierten Unterrichts. Comenius benutzte zum ersten Mal überhaupt den Begriff der Handlungsorientierung. Er war der Ansicht, man müsse Abschied von einer elitären Bildung nehmen. Alle Menschen sollten mit allen Sinnen alles lernen dürfen.
Auf Comenius` Prinzip des ganzheitlichen Lernens stützt sich später Rousseau, wenn er vom ganzheitlichen Bildungsideal spricht.
Pestalozzi plädierte für ein Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“.
Wichtige Vorläufer des handlungsorientierten Unterrichts kommen auch aus der Reform-Pädagogik. Hier sind vor allem Montessori, Freinet und Kerschensteiner (Arbeiterschule) zu nennen.
2.2 DIE ENTWICKLUNG ZUM "TREND HANDLUNGSORIENTIERUNG"
Die neuere Geschichte eines handelnden Umgangs mit Texten beginnt mit der von Alfred Lichtwark ins Leben gerufenen Kunsterziehungsbewegung und mit der neuen Schreibdidaktik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ziel der Kunsterziehungsbewegung war es, neben praktisch-künstlerischen Fertigkeiten auch das theoretische Verständnis für das Schöne zu fördern.10
Ende der 60er Jahre war entscheidendes Ziel des Unterrichts, die Kinder an ein Leben in der jeweiligen Gesellschaft so anzupassen, dass sie sich in ihr zurechtfinden und in ihr aktiv leben können.11
Daran anknüpfend wurde im Literaturunterricht in den 70er Jahren verstärkt in Richtung eines "emanzipierenden Verhaltens" und eines "kritischen Lesens" der Schüler zu entwickeln versucht, wobei die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion von Literatur im Vordergrund stand.12
In der zweiten Hälfte der 70er Jahre sprach man sich schließlich durch den mehr und mehr übernommenen handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht gegen eine Dominanz der strikt analytischen Verfahren im Unterricht als auch gegen die fast ausschließliche Betonung der kognitiven Momente eines Lesevorgangs aus. Der Begriff der Produktionsorientierung wurde 1979 von Günter Waldmann thematisiert und entschieden geprägt.13
In den 80er Jahren gewannen die produktiven Methoden mehr und mehr an Beliebtheit, da man einsah, dass jedes Verstehen ein Mitwirken des Sinns ist, bei dem die individuellen, expressiven Fiktionen in Anspruch genommen werden.14
3. SINN UND ZWECK DER HANDLUNGS- UND PRODUKTIONSORIENTIERUNG IM (LITERATUR-)UNTERICHT
3.1 HANDELN UND DENKEN STEHEN IN ENGEM ZUSAMMENHANG
Aus der Lernpsychologie ist seit langem bekannt, dass die Aktivierung fast aller Sinne beim Lernen sehr bedeutend ist.
Handlungsorientierung spricht auf vielseitige Art und Weise viele Sinne an, was eindeutig im Gegensatz zum gelenkten Unterrichtsgespräch steht.15
Auch Gedächtnisleistung und Handeln sind eng miteinander verbunden. In einer von Witzenbacher zitierten Untersuchung der American Audiovisuell Society über menschliche Behaltensleistungen besagt, dass wir 20% von dem behalten, was wir hören, 30% von dem, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, 80% von dem, was wir selbst beschreiben und ausdrücken können und sogar 90% behalten, von dem was wir selbst ausführen.16
3.2 INTEGRATION DURCH INTENSIVITÄTSSTEIGERUNG
Nach Gerhard Haas ist handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht die beste Möglichkeit, leistungsschwächeren Schülern die Chance zu geben sich anhand von einer intensiven Auseinandersetzung mit Literatur in den Unterricht zu integrieren. Durch eine intensivere Auseinandersetzung mit Literatur wird den Schülern ermöglicht, sich mit dem Text über einen längeren Zeitraum hin zu beschäftigen und schließlich anzufreunden.17
So bekommt jeder Schüler eine ihm gebührende Chance, die er zwar nicht unbedingt nutzen muss, die jedoch wenigstens durch Handlungs- und Produktionsorientierung im Unterricht geschaffen wird, während ein zum Sprechen genötigter, nicht - eloquenter Schüler resigniert, weil er die von ihm erwartete Leistung auf diese traditionelle Art und Weise nicht erbringen kann:
"Kritisch-analytisches Lesen ohne das breite Fundament einer affektiv-emotiven Einübung und Bejahung von Leseprozessen (...) dient primär der Zerstörung einer in aller Regel vom Kind in die Schule mitgebrachten, auf das Lesen bezogenen Erwartungshaltung, und, falls in Ansätzen ausgebildet der Leselust und der Lesemotivation."18
Haas geht davon aus, dass so auch die langsameren und weniger intellektuellen Schüler Mut bekommen, sich im Unterricht einzubringen, und das kognitive Ziel dementsprechend zwar verspätet, aber dafür um so wahrscheinlicher erreicht wird. So wird die Lektüre schließlich dazu beitragen, dass ein "lebenslanges, positiv getöntes Leseinteresse" aufgebaut wird. Wenn diese sowohl intensive als auch affektive und emotionale Beziehung des Schülers zum Text erfolgt ist, dann also auch Leselust, Lesemotivation und Lesestabilität aufgebaut sind, dann kann auch eine strikt kognitive Analyse eines anderen Textes der gleichen Thematik oder Gattung gewagt werden, die so viel mehr Erfolg, auch für die zuvor weniger leistungsstarken Schüler, verspricht.19
3.3 MOTIVATION DER LERNENDEN
Ein engagierter und motivierter Lehrer macht häufig die Erfahrung, dass seine Unterrichtsstunden trotz aller Bemühungen vielfach sehr unproduktiv sind, und die Schüler dem Unterricht mit Desinteresse begegnen. Dieses Misslingen der Schulstunden scheint selbst dann einzutreten, wenn Abfolge und Ergebnis der Planung des Lehrers entsprechen, denn die Schüler verhalten sich der Idee sehr distanziert gegenüber, die gesellschaftskritischen Gedanken mit ihrer persönlichen Meinung zu koppeln. Konsequenterweise verlässt diese anhand von Texten angeeignete Gesellschaftskritik den Klassenraum nicht, und Lernen und Leben bleibe isoliert.
Aus diesen Problemen, die sich aus der Anknüpfung an das Gedankengut der Aufklärung im Deutschunterricht ergeben, stellt sich die Frage, wie der Umgang mit Texten aus dem Unterricht zu einer Reflexion über die Gesellschaft und der eigenen Person führen kann.20
Günter Waldmann geht davon aus, dass, wenn Literaturunterricht wieder einen größeren Stellenwert im Deutschunterricht erlangen soll, erst einmal und vor allem neue Unterrichtsverfahren hervorgebracht werden müssen, die dazu fähig sind, Literaturunterricht zu gestalten.21
Eine veränderte Konzeption des Unterrichts ist notwendig, denn bei alleiniger Fixierung des kritischen Lesens bleibt der Schüler trotz aller aufklärerischen Absichten ohne feste Grundsätze und ohne eine geprüfte eigene Meinung.22
Die Aktivierung der Sinne durch handlungsorientierten Unterricht wirkt sich auf die Motivation aus, denn wo Kinder herstellen und auseinander nehmen, untersuchen und experimentieren können, wachsen die Neugier und das Interesse. Daraus folgend nimmt die Identifikation mit dem eigenen Handeln zu. Dadurch, dass die Schüler diese Art von Unterricht als sinnvoll einstufen und ihr eine subjektive Wichtigkeit zuschreiben, wird die schülereigene Motivation gesteigert.23 Das Wort schülereigen ist in diesem Sinne von besonderem Wert, denn als Lehrer den Schülern Begeisterung befehlen zu wollen, ist ein Widerspruch in sich.24
3.4 SCHULUNG DER KOOPERATIONSFÄHIGKEIT
Nachdem, was bisher zum handlungs- und produktionsorientierten Unterricht gesagt wurde, ist es einleuchtend, dass auch kooperative Handlungsformen notwendig sind, um Unterrichtsziele zu erreichen. Arbeitsformen von der Partner- und Kleingruppenarbeit bis zum gemeinsamen Klassengespräch sind empfehlenswert. Auch wenn die Pflege des sozialen Klimas in der Klasse für den Lehrer ein oft schwieriges Unterfangen ist, so ist die Kooperation doch ein unerlässliches Prinzip der Handlungs- und Produktionsorientierung Durch diese Zusammenarbeit wird Rücksichtnahme und Durchsetzung erlernt, Schüler lernen Konfliktlösungen zu finden und werden zur Teamfähigkeit erzogen. Es wird miteinander und voneinander gelernt, und Interaktionen werden nicht einzig und allein frontal vom Lehrer aus gesteuert.25
4. PRODUKTIVER UMGANG MIT LYRIK IM UNTERRICHT
4.1 NOTWENDIGKEIT HANDLUNGS - UND PRODUKTIONSORIENTIERTEN UMGANGS MIT LYRIK
Der methodische Vorteil einer traditionellen Vorgehensweise mit Analyse und werkimmanenter Textinterpretation liegt in der Möglichkeit, den Unterrichtsverlauf kleinschrittig vorkonstruieren und den Erfolg umgehend überprüfen zu können. Auf Schüler wirkt dieses Verfahren allerdings entmotivierend, da ein so streng vorgegebenes Schema der Textbehandlung Vorstellungskraft und Entdeckerfreude, die für den Umgang mit Lyrik wichtig sind, im Keim erstickt.26
Das Problem der traditionellen Textbehandlung liegt darin, dass der Lehrer in seinem Kopf ein bereits fertig projiziertes Bild einer vollständigen Interpretation hat, an dem er festhält und auf dessen Deutung er versucht, seine Schüler durch zielgerichtetes Fragen hinzulenken. Diese kognitive Methode stiftet viele Schüler jedoch dazu an, nur noch zu erraten, was der Lehrer hören möchte, anstatt eine selbständige Auseinandersetzung mit dem Text zu versuchen. Deshalb ist es an der Zeit, diese starren, traditionellen Methoden ruhen zu lassen und zu vielfältigeren Arbeitsweisen zu wechseln.27
Der handlungs- und produktionsorientierte Umgang mit Lyrik im Unterricht bietet nahezu unerschöpflich viele Möglichkeiten, Gedichte zu behandeln, von denen ich im Folgenden einige wenige aufzählen und beschreiben werde.
Besonders Schüler, die anfänglich große Probleme mit Chiffrierungen und ihren Inhalten haben, müssen die Chance bekommen, ein Gedicht als etwas Gemachtes zu erfahren. Diese Schüler müssen deshalb die Möglichkeit haben, auf verschiedenste Art und Weise Varianten des Textes und auch des Verstehens selbst ausprobieren zu dürfen, um sie als etwas Gemachtes erfahren und verstehen zu können.28
4.2 TEXTERSCHLIEßUNG MIT DEM ZIEL EINES ERÖRTERNDEN GESPRÄCHS
4.2.1 DIE SPONTANPHASE
Während beim lernzielorientierten Unterricht aus Angst vor Umwegen oder gar Abwegen zur Erreichung eines Unterrichtsziels kaum Raum für Schülerspontaneität geschaffen wird, hält ein handlungs- und produktionsorientierter Unterrichtsansatz diese Spontanphasen nach dem Lesen eines Gedichts für unerlässlich. Es interessieren nicht mehr ausschließlich die Autorenintentionen, sondern es wird Platz geschaffen für freie Assoziationen und Schilderung individueller Eindrücke.
Wesentlicher Bestandteil des Unterrichts ist die Diskussion über die Wirkung, die ein Gedicht beim Leser erzielt und die Frage, warum die Schülereindrücke und - assoziationen so voneinander abweichen.
Ein solches Stundengespräch, dass dazu beitragen kann, dass Schülern weitere Sinndimensionen aufgehen oder sie sich durch andere Schülerbeiträge in ihren ersten Eindrücken korrigieren lassen, führt also sowohl zum Text als auch zu den verschiedenen Verstehensweisen der Schüler.
Unterrichtspraktisch könnte eine solche Spontanphase in Form eines "Blitzlichts" durchgeführt werden. Hierbei äußert sich jeder der Reihe nach kurz zum Text, ohne dass zunächst auf diese Äußerungen eingegangen wird.
Dieses Verfahren ermöglicht, dass jeder Schüler, auch die Zurückhaltenden, wenigstens einen Wortbeitrag abgibt. Anschließend beginnt dann die Diskussionsrunde.
Eine andere Möglichkeit, alle Schüler einzubeziehen bietet ein schriftliches Festhalten erster Leseeindrücke, am besten auf dem Blatt, auf dem das Gedicht steht. Hier sollte beim Kopieren darauf geachtet werden, dass das Gedicht so zentriert ist, dass die Kinder an einzelne Wörter oder Verse ihre Eindrücke und Bemerkungen notieren können. Obwohl dieses Verfahren aufwendiger als das "Blitzlicht" ist, hat es den großen Vorteil, dass Kinder nicht einfach Äußerungen nachsagen können, die schon genannt wurden. Die Methode des freien Gesprächs über Gedichte führt Schüler langsam aber kontinuierlich auf eine Selbständigkeit im Umgang mit literarischen Texten hin, so dass der Lehrer im Optimalfall kaum noch Anweisungen geben oder Hilfestellungen leisten muss.29
4.2.2 PROVOKANTE THESEN ZU EINEM GEDICHT DISKUTIEREN
Werden die Schüler im Unterricht zusätzlich mit einer Deutungshypothese konfrontiert, die ihnen entweder nicht einleuchtet oder die sie nicht unterschreiben würden, hat der Lehrer den Weg zu einer motivierten Diskussionsrunde ein Stück weit geebnet. Diese These kann entweder vom Lehrer selbst formuliert oder einer Interpretation (auch der Schüler) entnommen sein. Ihre Berechtigung oder Unangemessenheit kann mit den Schülern diskutiert werden.
Auch zwei sich stark unterscheidende Interpretationen eines Gedichts können die Schüler zum eifrigen diskutieren der jeweiligen Hauptthesen anregen.30
4.2.3 ANALOGIEN AUS DER EIGENEN ERFAHRUNG EINBEZIEHEN
Gerade Lyrik kennzeichnet sich dadurch, dass der Leser sich mit ihr emotional sehr stark identifizieren kann.
Es ist demnach natürlich sinnvoll, wenn Schüler explizit Gedanken und Gefühle aus der eigenen Erfahrungswelt ins Unterrichtsgespräch einbringen. Diese individuellen Äußerungen dienen der Texterschließung, wenn der jeweilige Vergleichspunkt der Analogie nicht zu übersehen ist oder im Unterrichtgespräch herausgearbeitet werden kann.
Allerdings ist hierbei auf altersspezifische Unterschiede zu achten: Verstehen anhand von Analogien spielt in der 5./6. Klasse eine größere Rolle als zum Beispiel in der Oberstufe, wo eine unübersehbare Zurückhaltung gegenüber persönlichen Aussagen zu Tage tritt.31
4.2.4 BRIEFE AN DEN AUTOR VERFASSEN
In der Sekundarstufe I ist es sinnvoll, das erörternde Schreiben, wenn auch nur imaginativ, in einen Kommunikationszusammenhang einzukleiden, da Schüler in dieser Altersstufe die Funktion der Textanalyse häufig nicht begreifen.
Es bietet sich an, einen Brief an den Autor zu verfassen - selbst wenn dieser bereits verstorben ist, in dem die Schüler schreiben, was sie am Gedicht ärgert, was ihnen gefällt oder was sie nicht verstanden haben. Dieses Verfahren ermöglich eine individuell motivierte und zugleich textimmanente Auseinandersetzung mit dem Gedicht.32
4.3 PHANTASIEVOLLE UND KREATIVE MÖGLICHKEITEN DES UMGANGS MIT GEDICHTEN
Die bisher genannten möglichen Aufgabenstellungen zur Texterschließung zielen vor allen Dingen auf ein erörterndes Gespräch, nicht jedoch, wie es der handlungs- und produktionsorientierte Unterricht auch betont, auf den Einbezug von Phantasie und Kreativität der Schüler in den Unterricht.
In der Schulpraxis zeigt sich, dass häufig erst durch einen spielerischen, kreativen Umgang mit Lyrik das Interesse geweckt werden kann.33
Deshalb möchte ich im Folgenden noch einige Beispiele für einen Umgang mit Lyrik vorstellen, bei dem Phantasie und Kreativität im Vordergrund stehen.
4.3.1 PRODUKTIVES VERSTÄNDNIS DURCH VERSKOMBINATIONEN Für die Grundschule eignen sich zunächst am besten inhaltlich einen Ablauf beschreibende Gedichte.
Das Gedicht wird mit doppeltem Zeilenabstand zwischen den Versen vervielfältigt, damit man es versweise in Streifen schneiden kann.
Je zwei Kinder bekommen einen Umschlag, in dem sich das zerschnittene Gedicht befindet und legen die Streifen untereinander, ohne zunächst auf den Sinn zu achten. Beim Legen und Umlegen der Verszeilen finden die Partner irgendwann eine für sie plausible Gedichtform, die sie später vorlesen oder notieren und abgeben.
Es ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich von großer Bedeutung das Selbstbewusstsein der Kinder aufzubauen. Deshalb sollte der Lehrer das Original anonym als eine Lösung unter die anderen mischen.
Eine zweite Variante besteht darin, Verszeilen zweier Gedichte durcheinander zu würfeln, die die Kinder in Partnerarbeit erst entwirren und schließlich in eine logische Reihenfolge bringen sollen.
Je größer die thematische Nähe der beiden Gedichte und je ähnlicher die sprachliche Form, desto komplizierter wird natürlich die Entwirrung. Auch das Fehlen der Endreime erhöht den Schwierigkeitsgrad, dennoch sollte die Aufgabe selbst für die Langsameren der Klasse stets lösbar bleiben!
In der Sekundarstufe I werden nach und nach komplexere und nicht mehr ausschließlich mit Endreim versehene Gedichte ausgewählt.
Diese Verse sind auch wieder so zu kombinieren, dass sie sinnvoll erscheinen, um einen Einblick in die Struktur und in die Machart der Gedichte zu gewinnen. Schätzungsweise ab der neunten oder zehnten Klasse kann mit dieser Methode vereinzelt auch die Darstellung des Schaffensprozesses der Autoren verknüpft werden. Notwendig hierfür ist entweder eine Aufzeichnung über den Entstehungsweg eines Gedichtes oder eine historisch - kritische Ausgabe, die die verschiedenen Varianten beinhaltet. Dazu werden den Schülern auch die alternativen Verse vorgelegt, und sie sollen mit Blick auf zentrale ästhetische und poetologische Fragen entscheiden, welche Verse sie wählen würden. Der Wert liegt hierbei auf der subjektiven Plausibilität der gefundenen Form. Die Schüler werden entdecken, dass nur ganz selten eine konkrete, einzige Lösung gefunden und vertreten werden kann.
Haben die Schüler zusätzlich die Aufgabe, eine Überschrift für das Gedicht zu finden oder die Verse in Strophen zu unterteilen, so bestärkt sie das in ihrer Tätigkeit, da sie das Gefühl bekommen, mit Kreativität eigene Akzente und Vorstellungen einbauen zu können.
Eine weitere Möglichkeit, die Schüler kreativ und produktiv mitwirken zu lassen liegt darin, in den Versen einige Wörter wegzulassen, wobei auch hier wieder die Auslassungen dem Entwicklungsstand der Klasse angepasst sein müssen. Als schwerere Variante spart man Wörter aus, die keine Endreime sind und deshalb nicht so leicht erschlossen werden können. Die Schüler müssen sachlogisch und metrisch - rhythmisch korrekt passende Wörter finden. Bei dieser Aufgabe ist also nicht nur die Phantasie, sondern zusätzlich auch logische Argumentationsfähigkeit gefordert. Erfahrungsgemäß lernen die Schüler im Laufe der Zeit lückenhafte Texte immer schneller zu ergänzen, was auch bedeutet, dass sie durch diese handwerklich - produktive Tätigkeit relativ gute Einsichten in Grundstrukturen, sprich Reim, Metrum, Rhythmus, Aussagelogik, etc. , erlangen.34
4.3.2 KURZER UMRISS ANDERER HANDLUNGS- UND PRODUKTIONSORIENTIERTER MÖGLICHKEITEN DES UMGANGS MIT LYRIK
Es würde zu weit führen, wollte ich weitere typische handlungs- und produktionsorientierte Methoden im Umgang mit Lyrik ausführen. Dennoch halte ich es für sinnvoll einen kurzen Einblick in den umfangreichen Ideenkatalog vorzunehmen, damit die vielfältigen Möglichkeiten eines handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts im vollen Maße zum Tragen kommen.
4.3.2.1 PARALLELGEDICHTE SCHREIBEN
Die Klasse bekommt ein Gedicht, aus dem ein von Strophe zu Strophe wiederkehrendes Schema ersichtlich wird. Die Klasse sucht zum Beispiel zunächst nach Reimpaaren und setzt diese anschließend in das vorgegebene Gedicht ein. So entstehen variierende Parallelgedichte.35
4.3.2.2 GEDICHTPRODUKTION NACH REGELN/DAS ELFCHEN
Ein 'Elfchen' ist ein kurzes Gedicht aus nur fünf Versen und elf Wörtern, mit der Wortverteilung 1-2-3-4-1 pro Zeile.
Inhaltlich muss die erste Zeile eine Farbe, die zweite Zeile etwas, das die Farbe hat, die dritte Zeile eine Aussage darüber, wo sich der Gegenstand befindet oder über die Tätigkeit dieses Gegenstandes, die vierte Zeile etwas über das "Ich" des Schreibenden und die fünfte Zeile ein abschließendes Wort enthalten.36
4.3.2.3 GEDICHTE OHNE VORLAGE VERFASSEN
Diese Arbeit ist die freieste Form der lyrischen Eigenproduktion. Das Verfassen von Gedichten ermöglicht den Schülern, sich auch emotional und gestalterisch mit einem Thema auseinanderzusetzen.
Jedoch sollte diese Form nur im Zusammenhang mit anderen Unterrichtsformen angewandt werden, da es nicht darum geht Lyriker heranzuziehen.37
4.3.2.4 SZENISCHE INTERPRETATIONEN
Manche Gedichte, die stark auf Handlungen und gestische Aktionen zielen, lassen sich sehr gut durch szenische Umsetzungsversuche vermitteln. Ein solcher Spiel-Text muss Freiräume für verschiedenste Ideenansätze zur szenischen Realisierung einer Ausgangssituation beinhalten, wie zum Beispiel das Gedicht "Fünfter sein" von Ernst Jandl.
Die Schüler beginnen mit jener Ausgangssituation, die ihnen am Vertrautesten ist und spielen das Gedicht nach, wobei die Schüler sowohl die lyrische Sprache als auch Pantomime nutzen und von Durchgang zu Durchgang variieren sollten. Bei jedem neuen Durchgang wird eine andere Situation durchgespielt. Möchte man den Schwierigkeitsgrad anheben, kann die Klasse versuchen, ein Gedicht nur pantomimisch darzustellen. Es ist notwendig, dass für diese Darstellungsweise ein positives Klassenklima herrscht, damit der einzelne nicht zu befürchten hat, er könne ausgelacht werden.
Wie in allen szenisch dargestellten Interpretationsversuchen handelt es sich nicht um eine Verzierung der Schulstunde, sondern um eine Basis für darauf aufbauende analytische Gespräche. Deshalb stehen diese spielerischen und bildlichen Annäherungen an ein Gedicht am Anfang einer Unterrichtsreihe.38
4.3.2.5 COLLAGEN AUS GEDICHTEN BASTELN ODER EIN BILD ZU EINEM GEDICHT MALEN
Für den Unterricht sind diese Methoden wertvoll, da sie auch ohne besondere poetische Formulierungsfähigkeiten bei den Schülern vorauszusetzen, das Bewusstsein für sprachliches Wirkungsvermögen schulen. Wenn ein Schüler sich zu einem Text künstlerisch äußern soll, werden ihm Vorstellungen zum Gedicht entlockt, die man später im Unterricht aufgreifen und besprechen kann.39
5. KRITIKPUNKTE DES HANDLUNGS- UND PRODUKTIONSORIENTIERTEN (LITERATUR-)UNTERRICHTS
5.1 KRITISCHE BEWERTUNG BEDEUTENDER DIDAKTIKER
Obwohl der Ansatz des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts einen Paradigmenwechsel in der Didaktik eingeleitet, sogar teilweise vollzogen hat, ist er natürlich dennoch nicht unumstritten. Fachdidaktiker debattieren die Vor- und Nachteile dieses Unterrichtsmodells seit etwa zwei Jahrzehnten in theoretischer als auch praktischer Hinsicht mit großer Leidenschaftlichkeit.
Eine mögliche Gefahr des handlungs- und produktionsorientierten Konzepts ist nach Ansicht der Kritiker, dass der literarische Text an sich nicht mehr den Mittelpunkt bilde, sondern einzig und allein das kreative und produktive Gestalten im Vordergrund stehe. Die Wertzerstörung literarischer Texte ist einer der am häufigsten anzutreffenden Kritikpunkte in diesem Zusammenhang.
Waldmann verlangt deshalb ganz deutlich, dass ausnahmslos alle Erfahrungen, die während produktiven Handelns im Unterricht gemacht werden anschließend wieder auf den Text bezogen werden, um sich an ihm zu orientieren.40
Handlungs- und produktionsorientiertem Unterricht wird häufig vorgeworfen, er handle zu spontan und unreflektiert, sogar mehr oder weniger blind, also ohne zu wissen, was sein Lernziel sei.
Fingerhut, Melenk und Waldmann stellen dem gegenüber, "dass sich produktionsorientierter Literaturunterricht sehr wohl mit dem Konzept des kritischen Lesens verbinden läßt und daß dessen entscheidende Nachteile - die kognitive Reduktion, das Aussparen der Person des Schülers - im produktionsorientiertem Literaturunterricht vermieden werden können."41
Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht soll also nicht verabsolutiert werden, wovor zum Beispiel auch Spinner warnt. Durch diese Verherrlichung würde ansonsten eine Einseitigkeit im Unterricht auftreten. Es ist deshalb nach Spinner wichtig zu erwähnen, dass die Vertreter der Handlungs- und Produktionsorientierung den kognitiv - analytischen Ansatz nicht verneinen, sondern lediglich ein Zusammenspiel beider Komponenten wünschen.42
5.2 PERSÖNLICHE STELLUNGNAHME
Als erstes ist einmal zu betonen, dass sich handlungs- und produktionsorientierter Unterricht leider nicht auf alle Fächer anwenden lässt, denken wir zum Beispiel einmal an die Mathematik, in der so ziemlich alle Regeln feststehen.
Ich denke, dass bei handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtseinheiten mit Sicherheit oft schwierig ist, ein striktes Konzept zu verfolgen, es die gesamte Unterrichtseinheit über vor Augen zu haben und auch durchzuhalten. Freie Handlungsprozesse entfalten eine starke individuelle Dynamik auf Seiten der Kinder, was im Bezug auf ihr selbständiges Entdecken und Erarbeiten von Vorteil ist, aber das konkrete Lernziel verliert sich dabei sehr schnell, glaube ich. Es scheint deshalb wichtig, handlungsorientierte Unterrichtseinheiten und ihre Ergebnisse immer einem thematischen Sachgebiet unterzuordnen, wenn man als Lehrer einer Willkürlichkeit oder Beliebigkeit des Unterrichtsverlaufs vorbeugen möchte, so wie es Waldmann oben auch schon betont hat.
Folglich wäre der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht nur ein Teilgebiet, eine Möglichkeit, Literaturunterricht zu gestalten.
Diese Vorraussetzung trägt jedoch die Konsequenz mit sich, dass der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht grundsätzlich auf die Systematik des Fachunterrichts angewiesen ist, niemals jedoch als ganzheitliches Prinzip angesehen werden kann.
Ein weiterer Kritikpunkt meinerseits am handlungs- und produktionsorientiertem Unterricht stellt die Frage nach der Leistungsbewertung des einzelnen Schülers.
Erstens habe ich beim handlungs- und produktionsorientierten Umgang mit Lyrik mehrfach erwähnt, dass sich viele Arbeiten am erfolgreichsten in Partnerarbeit durchführen lassen, wenn nicht sogar in größeren Gruppen. Die individuelle Benotung fiele bei einem strikt handlungs- und produktionsorientiertem Unterricht also in all diesen Fällen schon einmal aus.
Weiterhin habe ich oben auch beschrieben, dass es bei produktiven Arbeiten sehr stark darauf ankommt, das Selbstbewusstsein des Schülers zu stärken, also kann man eine individuell erbrachte Leistung konsequenterweise auch nicht als Defizit brandmarken.
Ein weiteres Problem sehe ich darin, dass die institutionelle Verfassung der Schule Handlungs- und Produktionsorientierung nicht besonders fördert oder unterstützt. Stoffdruck, Lehrplanzwänge, Verwaltungsvorschriften, aber auch vielleicht bornierte Kollegen und skeptische Eltern bieten nahezu nicht allein zu bewältigende Hürden. Schon alleine die Unterteilung der Unterrichtseinheiten in einen 45-Minuten-Rhythmus bietet sich nicht zu produktivem, handelndem Unterricht an.
Auch ist es sinnvoller, wenn der Lehrer einen Kollegen mit einbeziehen kann, da handlungsorientierter Unterricht eigentlich fächerübergreifenden Unterricht voraussetzt, den ein einziger Lehrer in dieser Form nicht alleine bewältigen kann. Weiterhin scheint es nahezu unmöglich, dass ein einzelner Lehrer konsequent nach jedem produktiven Umgang der Kinder mit Literatur jedes einzelne Kind individuell bewertet, was aber auf Grund dieser Didaktik eigentlich seine Aufgabe wäre.
Eine letzte Schwierigkeit ist vermutlich auch in den Schülern selbst zu finden, die diese neue, freiere Art von Unterricht missbrauchen könnten, in dem 'freiere Art von Unterricht' mit 'Freizeit' verwechselt wird. Denn auch sie sind natürlich noch ungeübt, zum Beispiel im produktiven Umgang mit Literatur und müssen diese neue Form erst einmal kennenlernen.
Bis dahin ist es jedoch ein langer Weg, der für beide Parteien, Lehrer und Schüler, viel Arbeit bedeutet. Es ist ein kleinschrittiges Vorgehen, für das der Lehrer viel Ausdauer benötigt, bis seine Klasse schließlich so gut eingespielt ist, dass sie Aufgaben eines handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts vernünftig bearbeiten kann.
LITERATURVERZEICHNIS
Bartnitzky, Horst / Hecker, Ulrich (Hg.): Was tun mit Texten? Handelnder Umgang mit Texten. Essen 1991
Becker, Georg E.: Planung von Unterricht. Handlungsorientierte Didaktik. Teil I. Weinheim und Basel: Beltz, 1997, 7., neu ausgestattete Auflage
ders. : Durchführung von Unterricht. Handlungsorientierte Didaktik. Teil II. Weinheim und Basel: Beltz, 1998, 8., neu ausgestattete Auflage
Fingerhut, Karlheinz / Melenk, Hartmut / Waldmann, Günter: Kritischer und produktiver Umgang mit Literatur. Diskussion Deutsch, 58 (1981)
Göttler, Hans: Moderne Jugendbücher in der Schule. Modelle zu einem handlungsund produktionsorientierten Literaturunterricht. Baltmannsweiler, 1993
Gudjons, Herbert: Didaktik zum Anfassen. Lehrer/in - Persönlichkeit und lebendiger Unterricht. Bad Heilbrunn / Obb. : Klinkhardt, 1998, 2., überarb. Auflage
ders. : Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung - Selbsttätigkeit - Projektarbeit. Bad Heilbrunn / Obb. : Klinkhardt, 1997, 5. Auflage
Haas, Gerhard: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Theorie und Praxis eines „anderen“ Literaturunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze: Kallmeyer, 1997
Jank, Werner / Meyer, Hilbert: Didaktische Modelle. Frankfurt a. M: Cornelsen Scriptor, 1991
Kaiser, Astrid: Praxisbuch handelnder Sachunterricht. Bd.1. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag, Hohengehren, 1997, 4. Auflage
Meyer, Hilbert: Unterrichtsmethoden Bd. 1, Frankfurt / Main: Scriptor, 1987
Schuster, Karl: Einführung in die Fachdidaktik Deutsch. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1998, vollst. überarb. und erw. 7. Auflage
Spinner, Kaspar H.: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1997, 3. Auflage
Waldmann, Günter: Produktiver Umgang mit Lyrik. Eine systematische Einführung in die Lyrik, ihre produktive Erfahrung und ihr Schreiben. 2. korr. Auflage, 1992
ders. : Grundzüge von Theorie und Praxis eines produktionsorientierten
Literaturunterrichts. In: Hopster (Hg.): Handbuch "Deutsch" für Schule und
Hochschule. Sekundarstufe I. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh, 1984, 98- 141.
[...]
1 Meyer, Hilbert: Unterrichtsmethoden. Bd. 1. Frankfurt / Main: Scriptor, 1987, S. 214
2 Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung - Selbsttätigkeit - Projektarbeit. Bad Heilbrunn / Obb.: Klinkhardt, 1997, 5. Auflage
3 Gudjons, Herbert: Didaktik zum Anfassen. Lehrer/in - Persönlichkeit und lebendiger Unterricht. Bad Heilbrunn / Obb.: Klinkhardt, 1998, 2., überarb. Auflage, S. 103
4 Kaiser, Astrid: Praxisbuch handelnder Sachunterricht. Bd.1. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag, Hohengehren, 1997, 4. Auflage, S.2
5 Spinner, Kaspar H.: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1997, 3. Auflage, S. 3
6 ebd. S. 113f
7 Becker, Georg E.: Planung von Unterricht. Handlungsorientierte Didaktik. Teil 1. Weinheim und Basel: Beltz, 1984, 7., neu ausgestattete Auflage, S.94
8 Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung - Selbsttätigkeit - Projektarbeit. Bad Heilbrunn / Obb.: Klinkhardt, 1997, 5. Auflage, S.37
9 Kaiser, Astrid: Praxisbuch handelnder Sachunterricht. Bd. 1. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag, Hohengehren, 1997, 4. Auflage, S.2
10 Microsoft® Encarta® 99 Enzyklopädie: "Kunsterziehungsbewegung"
11 Haas, Gerhard: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Theorie und Praxis eines „anderen“ Literaturunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze: Kallmeyer, 1997, S. 24
12 Spinner, Kaspar H.: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1997, 3. Auflage, S.2f
13 Göttler, Hans: Moderne Jugendbücher in der Schule. Modelle zu einem handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht. Baltmannsweiler, 1993, S.1
14 Spinner, Kaspar H.: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1997, 3. Auflage, S. 30
15 Gudjons, Herbert: Didaktik zum Anfassen. Lehrer/in - Persönlichkeit und lebendiger Unterricht. Bad Heilbrunn / Obb.: Klinkhardt, 1998, 2., überarb. Auflage, S. 106f
16 Witzenbacher, 1985, S. 17. In: Gudjons, Herbert: : Didaktik zum Anfassen. Lehrer/in - Persönlichkeit und lebendiger Unterricht. Bad Heilbrunn / Obb.: Klinkhardt, 1998, 2., überarb. Auflage, S. 107 und in: Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung - Selbsttätigkeit - Projektarbeit. Bad Heilbrunn / Obb.: Klinkhardt, 1997, 5. Auflage, S. 55
17 Haas, Gerhard: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Theorie und Praxis eines „anderen“ Literaturunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze: Kallmeyer, 1997, S. 40
18 ebd. S.46f
19 ebd. S. 41-44
20 Fingerhut, Karlheinz / Melenk, Hartmut / Waldmann, Günter: Kritischer und produktiver Umgang mit Literatur. Diskussion Deutsch, 58 (1981), S. 132
21 Waldmann, Günter: Grundzüge von Theorie und Praxis eines produktionsorientierten Literaturunterrichts. In: Hopster (Hg.): Handbuch "Deutsch" für Schule und Hochschule. Sekundarstufe I. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh, 1984, S.99
22 Fingerhut, Karlheinz / Melenk, Hartmut / Waldmann, Günter: Kritischer und produktiver Umgang mit Literatur. Diskussion Deutsch, 58 (1981), S. 131f
23 Gudjons, Herbert: Didaktik zum Anfassen. Lehrer/in - Persönlichkeit und lebendiger Unterricht. Bad Heilbrunn / Obb.: Klinkhardt, 1998, 2., überarb. Auflage, S. 107
24 Schuster, Karl: Einführung in die Fachdidaktik Deutsch. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1998, 7., vollständig überarb. und erw. Auflage, S.79
25 Gudjons, Herbert: Didaktik zum Anfassen. Lehrer/in - Persönlichkeit und lebendiger Unterricht. Bad Heilbrunn / Obb.: Klinkhardt, 1998, 2., überarb. Auflage, S. 111
26 Spinner, Kaspar H.: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1997, 3. Auflage, S. 29f
27 ebd. S. 31
28 Haas, Gerhard: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Theorie und Praxis eines „anderen“ Literaturunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze: Kallmeyer, 1997, S. 54f
29 Spinner, Kaspar H.: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1997, 3. Auflage. S. 31-34
30 ebd. S.41
31 ebd. S.40f
32 ebd. S. 44
33 ebd. S. 44f
34 Haas, Gerhard: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Theorie und Praxis eines „anderen“ Literaturunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze: Kallmeyer, 1997, S. 56 - 69
35 ebd. S. 69ff
36 Schuster, Karl: Einführung in die Fachdidaktik Deutsch. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1998, 7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 107f
37 Spinner, Kaspar H.: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1997, 3. Auflage, S. 58
38 Haas, Gerhard: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Theorie und Praxis eines „anderen“ Literaturunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze: Kallmeyer, 1997, S. 111 - 115
39 Spinner, Kaspar H.: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider - Verlag Hohengehren, 1997, 3. Auflage, S. 58f
40 Göttler, Hans: Moderne Jugendbücher in der Schule. Modelle zu einem handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht. Baltmannsweiler, 1993, S.7
41 Fingerhut, Karlheinz / Melenk, Hartmut / Waldmann, Günter: Kritischer und produktiver Umgang mit Literatur. Diskussion Deutsch, 58 (1981), S. 133
Häufig gestellte Fragen
Was ist handlungs- und produktionsorientierter Unterricht?
Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses leiten, so daß Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können.
Welche Punkte sind grundlegende Hauptmerkmale eines handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts?
1. Der Unterricht ist praxisorientiert.
2. Lehrer und Schüler nehmen mit Freude und Eigeninitiative am Unterricht teil.
3. Kinder haben die Möglichkeit, ihre Neugierde zu befriedigen und auszuleben.
4. Spontaneität wird gefördert.
5. Es entsteht eine Chancengleichheit und somit eine ausgleichende Gerechtigkeit für leistungsschwächere Schüler.
6. Kinder haben die Möglichkeit, entdeckend, forschend, kooperativ, mit allen Sinnen und mehrperspektivisch zu lernen.
Wer sind einige historische Vorläufer des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts?
Comenius, Rousseau, Pestalozzi und Schleiermacher sind wohl die bedeutendsten Vertreter des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts. Wichtige Vorläufer des handlungsorientierten Unterrichts kommen auch aus der Reform-Pädagogik. Hier sind vor allem Montessori, Freinet und Kerschensteiner (Arbeiterschule) zu nennen.
Warum ist Handeln und Denken im handlungs- und produktionsorientierten Unterricht so wichtig?
Aus der Lernpsychologie ist seit langem bekannt, dass die Aktivierung fast aller Sinne beim Lernen sehr bedeutend ist. Handlungsorientierung spricht auf vielseitige Art und Weise viele Sinne an, was eindeutig im Gegensatz zum gelenkten Unterrichtsgespräch steht.
Wie kann handlungs- und produktionsorientierter Unterricht die Integration von Schülern fördern?
Nach Gerhard Haas ist handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht die beste Möglichkeit, leistungsschwächeren Schülern die Chance zu geben sich anhand von einer intensiven Auseinandersetzung mit Literatur in den Unterricht zu integrieren. Durch eine intensivere Auseinandersetzung mit Literatur wird den Schülern ermöglicht, sich mit dem Text über einen längeren Zeitraum hin zu beschäftigen und schließlich anzufreunden.
Wie kann man die Motivation der Lernenden im Unterricht steigern?
Die Aktivierung der Sinne durch handlungsorientierten Unterricht wirkt sich auf die Motivation aus, denn wo Kinder herstellen und auseinander nehmen, untersuchen und experimentieren können, wachsen die Neugier und das Interesse. Daraus folgend nimmt die Identifikation mit dem eigenen Handeln zu.
Warum ist die Schulung der Kooperationsfähigkeit im handlungs- und produktionsorientierten Unterricht wichtig?
Kooperative Handlungsformen sind notwendig, um Unterrichtsziele zu erreichen. Arbeitsformen von der Partner- und Kleingruppenarbeit bis zum gemeinsamen Klassengespräch sind empfehlenswert. Durch diese Zusammenarbeit wird Rücksichtnahme und Durchsetzung erlernt, Schüler lernen Konfliktlösungen zu finden und werden zur Teamfähigkeit erzogen.
Welche phantasievollen und kreativen Möglichkeiten gibt es, Gedichte im Unterricht zu behandeln?
Produktives Verständnis durch Verskombinationen, Parallelgedichte schreiben, Gedichtproduktion nach Regeln/das Elfchen, Gedichte ohne Vorlage verfassen, szenische Interpretationen, Collagen aus Gedichten basteln oder ein Bild zu einem Gedicht malen.
Welche Kritikpunkte gibt es am handlungs- und produktionsorientierten (Literatur-)Unterricht?
Eine mögliche Gefahr des handlungs- und produktionsorientierten Konzepts ist nach Ansicht der Kritiker, dass der literarische Text an sich nicht mehr den Mittelpunkt bilde, sondern einzig und allein das kreative und produktive Gestalten im Vordergrund stehe. Handlungs- und produktionsorientiertem Unterricht wird häufig vorgeworfen, er handle zu spontan und unreflektiert, sogar mehr oder weniger blind, also ohne zu wissen, was sein Lernziel sei.
- Citar trabajo
- Jenny Herse (Autor), 2000, Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101900