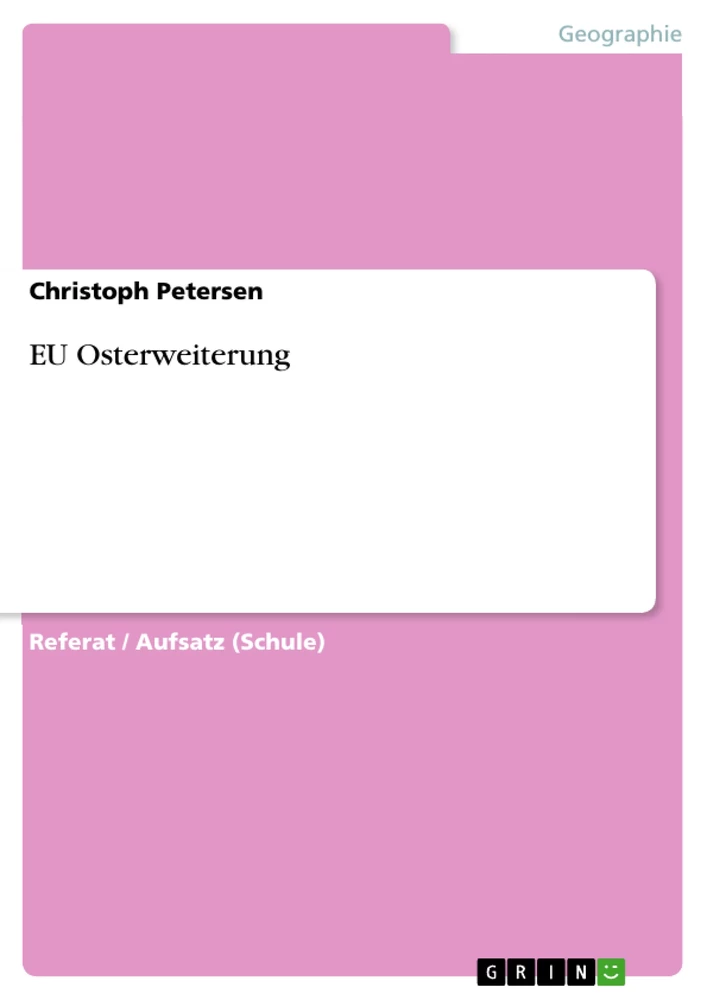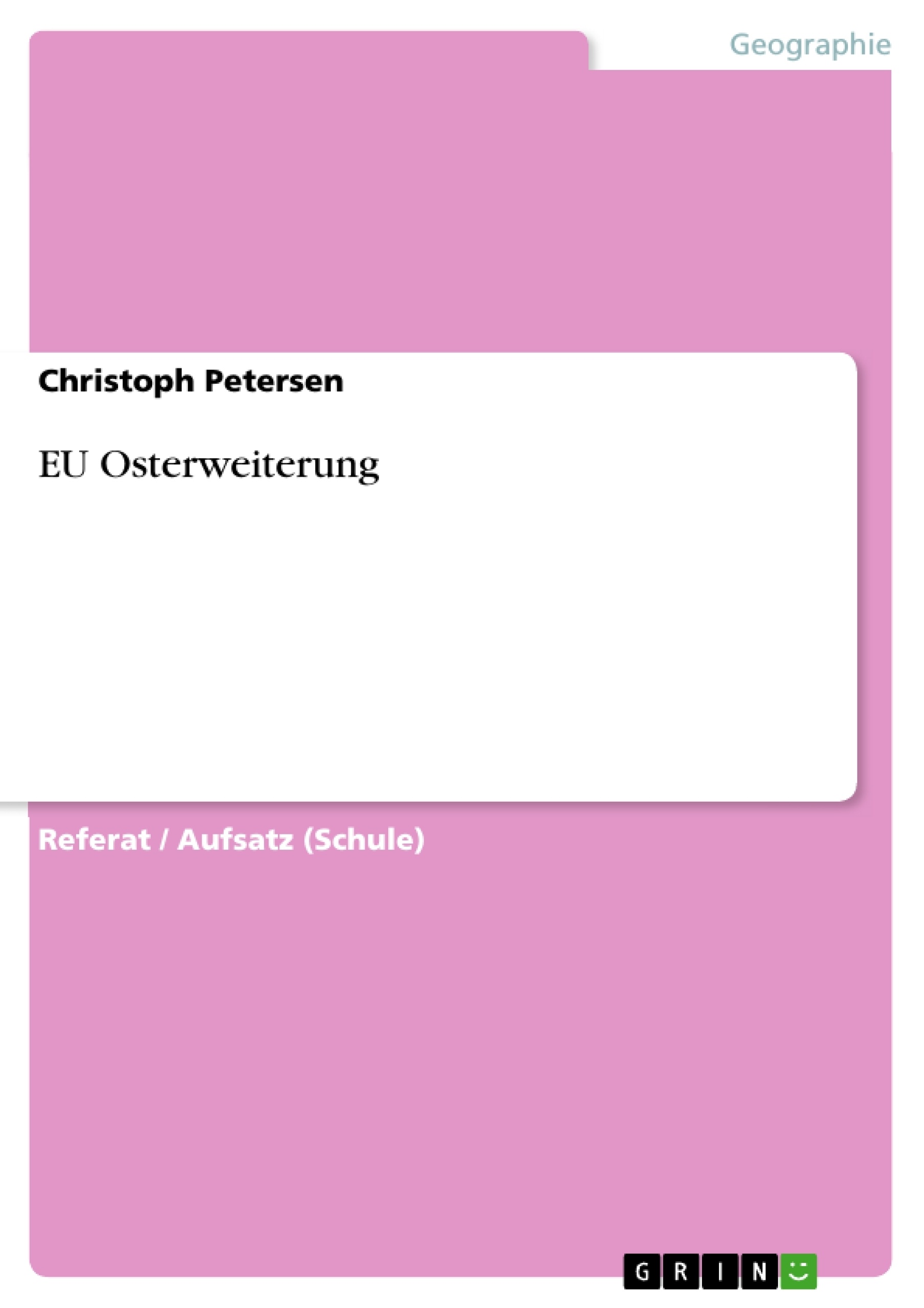Inhalt
1. Einführung zur EU - Osterweiterung
2. Die Beitrittskanditen zur Europäischen Union
2.1. „Luxemburggruppe“
2.2. „Helsinkigruppe“
2.3. Eckdaten der Beitrittskandidaten
2.4. Länderbericht
3. Gründe für die Erweiterung der Europäischen Union
3.1. Rede vom Außenminister zur EU- Osterweiterung
4. Vorteile und Nutzen der Erweiterung
4.1. Wirtschaft
4.2. Umwelt
4.3. Justiz und Inneres
4.4. Am Beispiel Frankfurt/ Oder
5. Probleme und Risiken der Erweiterung
6. Voraussetzungen für einen Beitritt zur EU
6.1. Voraussetzungen für die Beitrittsländer
6.2. Voraussetzungen für die EU
6.2.1. Besonderheiten der Beitrittsländer beachten
7. Der Stand des Beitrittsprozesses
8. Geschichte der EU ab 1987
9. Strategien und Vorhaben zur Erweiterungsfähigkeit der EU
9.1. Reformen
9.2. Strategieplan
9.3. Finanzielle Unterstützung
10. Ergebnisse des EU - Gipfels in Nizza
10.1. Am Beispiel Ungarn
11. Quellenangabe
12. Anhang: Artikel der DIW1 zur EU- Osterweiterung
1. Einleitung zur EU - Osterweiterung
Die Europäische Union wird in einem Jahrzehnt erheblich größer sein als heute. Nicht nur ihre Gestalt, auch ihr Gewicht und Umfang werden sich spürbar verändern. Doch welches Europa soll es sein? Aus welchen Ländern soll es sich zusammen setzen? Wo sollen seine Grenzen verlaufen?
Die EU ist prinzipiell offen für alle europäischen Staaten. Vorstellungen von europäischer Einigung, die während des Zweiten Weltkriegs und in den Jahren danach entwickelt wurden, zielten alle auf die kontinentale Dimension Europas. Als bald nach Kriegsende der Eiserne Vorhang den östlichen Teil des Kontinents allen Einigungsbemühungen entzog, mussten Integrationsschritte auf Westeuropa beschränkt bleiben.
So gelang es zunächst nur einer begrenzten Gruppe von sechs Ländern, 1950 mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) eine erste Gemeinschaft zu begründen. Sie war die Alternative zur gescheiterten Hoffnung einer unmittelbar zu verwirklichenden gesamteuropäischen Föderation, blieb aber auf dasselbe Ziel bezogen. Daraus ergibt sich, dass von Anfang an Erweiterung bis an die Grenzen Europas als Entwicklungstendenz in der Gemeinschaftsbildung angelegt war.
Im Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von 1957 ergeht folglich in der Präambel "die Aufforderung an die anderen Völker Europas, (...) sich diesen Bestrebungen anzuschließen." Artikel 0 des Unionsvertrages präzisiert, dass jeder europäische Staat den Antrag auf Mitgliedschaft stellen kann.
13 Staaten Europas wünschen nun der EU in absehbarer Zeit beizutreten und dazuzugehören. Staaten des ehemaligen Ostblocks, die erst in jüngerer Vergangenheit ihre Freiheit und Souveränität erlangt haben, sind bereit, auf Hoheitsrechte zu verzichten, um an Wachstum und Wohlergehen der EU teilzuhaben.
Der Weg zum Eintritt in die Gemeinschaft wird lang und mühsam sein. Die Beitritte werden nicht mit einem Schlag realisiert, sondern in Etappen erfolgen. Bei den Verhandlungen wird jedes beitrittswillige Land für sich genommen beurteilt. Tempo und Fahrplan hängen von der Erfüllung der Beitrittskriterien ab. Die Erweiterung ist nicht nur für die Beitrittsländer, die ihr wirtschaftliches und politisches System "europäisieren" wollen, sondern auch für die EU eine große Herausforderung und Chance.
2. Die Beitrittskandidaten zur Europäischen Union
2.1 Die „Luxemburggruppe“
Mit den folgenden sechs Ländern hat die EU seit 1998 Beitrittsverhandlungen begonnen: Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Estland, Slowenien, Zypern
2.2 Die „Helsinkigruppe“
Mit folgenden sechs Ländern hat die EU seit dem Frühjahr 2000 Beitrittsverhandlungen begonnen:
Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen und Malta
Die Türkei hat seit dem EU- Gipfel in Helsinki 1999 als 13. Land den Kandidatenstatus erhalten. Beitrittsverhandlungen können erst beginnen, wenn die Türkei die politischen Kriterien für einen Beitritt erfüllt.
2.3 Eckdaten der Beitrittskandidaten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten2 3
2.4. Länderbericht
Estland Als ein Vorreiterstaat im Transformationsprozeß im Baltikum weist Estland derzeit eine stolze Bilanz aus. Die Wirtschaft wuchs allein 1997 um ca. 7 %, angetrieben durch den stark expandierenden Handels- und Dienstleistungssektor. Der Anteil des Privatsektors am BIP liegt bei über 70 %. Der Staatshaushalt ist ausgeglichen. Etwa drei Viertel des Außenhandels wird mit westlichen Partnern abgewickelt - auch wenn mit Blick auf das ständig wachsende
Handelsbilanzdefizit die Exportbasis weiterhin zu schmal ist. Staatsbetriebe gelten als privatisiert.
Lettland Während die ökonomische Entwicklung in Lettland bis Ende 1995 kein einheitliches Bild lieferte, zeigt die gesamte Entwicklung 1996/97 überwiegend positive Tendenzen. Die bisher erzielten makroökonomischen Erfolge und die konsequente Anpassung der Gesetzgebung an EU-Standards haben das Ansehen Lettlands weltweit gefördert. Wie in anderen Ländern auch ist Lettland - speziell auch unter Beachtung der langen Zugehörigkeit zur UdSSR - bei der Umsetzung der neuen Rechtsnormen Aus- und Fortbildungshilfe zu gewähren.
Polen Wirtschaftlich wichtigstes Tätigkeitsfeld im Hinblick auf den EU-Beitritt ist die Privatisierung. Zu Beginn des Prozesses (1990) gab es 8.441 registrierte staatliche Unternehmen. Verglichen mit dieser Zahl sind bisher 26 % privatisiert worden. Insbesondere in wichtigen Schlüsselbereichen, wie Telekommunikation, Energiewirtschaft, Mineralöl, Chemie, Stahlindustrie und Bankwesen, existieren noch die alten Strukturen. Andererseits hat in Polen eine starke Privatisierung von unten stattgefunden. Die neue polnische Regierung hat mehrfach bekräftigt, daß sie die Anstrengungen zur weiteren Privatisierung nicht nur fortsetzen, sondern in den nächsten Jahren verstärken will.
Als problematische Bereiche werden vor allem die Landwirtschaft und das Sozialversicherungssystem angesehen. Der Agrarbereich beschäftigt derzeitig 26 % der Arbeitskräfte in Polen (im Vergleich: 5,7 % durchschnittlich in den 15 EU-Staaten) und erwirtschaftet lediglich 6,6 % des BIP. Das Sozialversicherungssystem ist dringend reformbedürftig.
Bulgarien hat seit dem Umbruch schwierige Jahre erlebt. Sieben Regierungen in sieben Jahren haben es nicht ausreichend verstanden, die Zukunftsprobleme anzupacken. Für die bulgarische Wirtschaft war 1996 das katastrophalste Jahr seit Beginn der Reformperiode, weil die notwendigen strukturellen Reformen immer wieder verzögert und die hohen Verluste der staatlichen Unternehmen sowie die illiquiden Banken letztlich durch die öffentlichen Haushalte finanziert wurden. 1996 ging das BIP um 11 % und die Industrieproduktion um 9 % zurück. Der Außenhandel entwickelte sich negativ, mit Deutschland entstand ein Rückgang von 180 Mio DM (13,5 %). Das Regierungsprogramm „Bulgarien 2001“ beinhaltet sowohl wichtige innenpolitische Prioritäten (Finanzstabilität, Strukturreformen, radikale und schnelle Privatisierung, Rückgabe von Grund und Boden, Bekämpfung der organisierten Kriminalität u.a.) als auch außenpolitische Ziele (z. B. Vollmitgliedschaft in der EU und in der NATO). Die bulgarische Währung wurde fest an die DM mit einem Kurs 1 DM = 1000 bulg. Leva gebunden. Die ersten positiven Auswirkungen waren sofort zu spüren, z. B. stark rückläufige Inflation, Senkung des Zinsniveaus, allgemeine wirtschaftliche und vor allem finanzielle Lageverbesserung.
Litauen Die Bedingungen für eine erfolgreiche Integration in die europäische Arbeitsteilung wurden weiter verbessert. Die EU-Anpassung der Rechtsnomen wird als längerfristiger Prozeß gesehen, der sich noch in den kommenden Jahren vollziehen wird, zumal Litauen viele Jahre in das sowjetische System integriert war. Probleme gibt es in solchen Bereichen wie Umweltschutz und Energieversorgung. Vor allem die Ebene der Gebietskörperschaften wird die Umsetzung der neuen Rechtsakte ohne zusätzliche Qualifizierungshilfe kaum erfüllen können. Die BIP-Entwicklung für 1997 (4 - 5 %) läßt hoffen, daß sich die Wirtschaft weiter stabilisieren wird. Der Außenhandelsanteil der EU liegt im Export um die 33 % und im Import bereits bei über 40 %. Deutschland partizipiert daran mit 13 bzw. 16 %. Für 1997 könnte ein Warenaustausch in Höhe von knapp 2 Mrd. DM realisiert werden. Bei den ausländischen Direktinvestitionen in Litauen liegen die USA derzeit an erster Stelle.
Rumänien Versäumnisse der Reformpolitik sowie die Zuspitzung von strukturellen und sozialen Problemen führten 1996 zu einer Abschwächung des realen Wirtschaftswachstums in Rumänien. Der ins Stocken geratene Transformationsprozeß, insbesondere die verzögerten Strukturreformen, soll nun durch das im Februar 1997 vorgelegte Reformprogramm der neuen rumänischen Regierung angeschoben werden. Für 1998/99 wird wieder mit einem Anstieg des BIP um 2,3 % und der Industrieproduktion um 4 % gerechnet.
Tschechische Republik Die Transformation der tschechischen Wirtschaft kam bislang relativ gut voran. Die wirtschaftliche Ausrichtung auf die westlichen Marktwirtschaften gelang: Je ca. 60 % der Ein-und Ausfuhren Tschechiens kommen aus der bzw. gehen in die EU. Der lange stabil gehaltene Wechselkurs zog ausländische Portfolio- und Direktinvestitionen an. Seit etwa Mitte 1996 zeigen sich strukturelle Verwerfungen; sie führten zu ansteigender Inflation, und Arbeitslosigkeit, Handels- und Leistungsbilanz gerieten in bedrohliches Ungleichgewicht. Dennoch wird per Ende 1997 das Budgetdefizit mit 1,5 % nur die Hälfte des in der EU noch zulässigen Satzes betragen. Die Wirtschaft gilt als weitgehend entstaatlicht, mit Ausnahme von ca. 60 strategischen Betrieben, vier Großbanken sowie Versorgungs- und Transportbetrieben. Privatisierte Firmen befinden sich häufig im Eigentum von Großbanken und/oder diesen gehörenden Investmentfonds. Dies könnte eine Fehlentwicklung in bezug auf Kredit- und Managemententscheidungen begünstigen. Die Regierung hat nun Maßnahmen beschlossen, um die strategischen Unternehmen zu privatisieren und den Kapitalmarkt zu reformieren; weitere Aktionen sind in der Diskussion.
Slowenien: Das BIP Sloweniens wuchs in den letzten Jahren um durchschnittlich 3 - 5 %. Für 1997 rechnet man mit einer Steigerung um 4,2 %. Die Industrieproduktion wächst langsamer, weil größere Schwierigkeiten in den Bereichen Textilien, Landwirtschaft, Schuh- und Lederwarenindustrie in bezug auf die EU-Anpassung zu erwarten sind.
Slowenien gehört zu den wenigen Ländern, die nach Deutschland mehr exportieren als von dort importieren. Der Warenverkehr erreicht zur Zeit 7 - 8 Mrd. DM; prognostiziert werden für 2005 mindestens 10 Mrd. DM. Deutsches Kapital wurde in mehr als 500 slowenischen Unternehmen investiert. Der Anteil Deutschlands bei den ausländischen Investitionen beträgt über ein Drittel, nach slowenischen Angaben sind das in etwa 150 Mio DM.
Slowakei: Das Land hat wesentliche marktwirtschaftliche Reformen eingeführt, kann jedoch noch nicht in vollem Umfang als eine funktionierende Marktwirtschaft betrachtet werden. Gegenwärtig sollen ca. 70 % der Rechtsvorschriften der Slowakischen Republik mit denen der EU übereinstimmen. Probleme bestehen in der Terminologie, in der technischen Ausstattung und der personellen Besetzung der Rechtsabteilungen in den Ministerien und Wirtschaftsorganisationen. Es wird notwendig sein, recht kurzfristig u.a. ein Gesetz über technische Produktanforderungen und einheitliche Normen zu verabschieden.
3. Gründe für die Erweiterung
Gemeinsame Ziele und Werte verbinden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu einer Gemeinschaft. Sie zu verwirklichen, umzusetzen und zu wahren - dazu hat sich in der 50- jährigen Geschichte der europäischen Einigung eine beständig wachsende Zahl von Mitgliedern im Rahmen unterschiedlicher Verträge gemeinsam verpflichtet.
Ausgehend von den blutigen Auseinander-setzungen der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts waren die Mitgliedstaaten von Anfang an vornehmlich davon beseelt, künftig gemeinsam dauerhaft für Frieden und Sicherheit in Europa zu sorgen. Mit Gründung der Montanunion wurde 1951 ein erster Schritt vollzogen. Die umfassende ökonomische Integration des zentralen Wirtschaftssektors Kohle und Stahl sollte eine spätere politische Einigung nach sich ziehen.
In vier Erweiterungsrunden hat sich die Gemeinschaft der sechs Gründerstaaten in der Folgezeit zur heutigen Europäischen Union der Fünfzehn fortentwickelt. Weitere Staaten Europas wünschen ihr beizutreten. Sie erklären sich bereit, ihre Länder von Grund auf zu reformieren, für institutionelle Stabilität, Demokratie und Rechtstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte zu sorgen. Sie wollen sich den gemeinsamen Rechtstexten verpflichten. Mit der anstehenden Erweiterung unternehmen die Staaten Europas einen weiteren historischen Schritt, der es ihnen nicht nur ermöglicht, die Teilung Europas ein Jahrzehnt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu überwinden, sondern zugleich die Stabilitätszone nach Osten und Süden auszudehnen. Konflikten kann so präventiv vorgebeugt werden. Die EU-Erweiterung stellt die Mitglieder der Europäischen Union vor eine schwere Aufgabe, die den Staaten Europas aber zugleich die einzigartige Chance bietet, sich für das 21. Jahrhundert fit zu machen. Die EU integriert ausgesprochene Wachstumsmärkte: allein der deutsche Handel mit den Ländern Mittel- und Osteuropas (MOE) ist inzwischen bedeutender als mit den USA und Kanada bei sehr hohen Wachstumsraten.
Zusätzlich gewinnt die EU an kultureller Vielfalt und internationaler Bedeutung. Sie wird sich auf internationalem Parkett besser behaupten können als bisher.
Doch jetzt steht schon fest: Es geht in Europa nicht mehr um Sicherheit vor den anderen, sondern um Sicherheit mit den anderen.
Mit der Erweiterung wird die Teilung Europas endgültig überwunden. Die Erweiterung entspricht den strategischen und wirtschaftlichen Interessen der jetzigen wie der künftigen Mitglieder der EU:
- Die geographische, historische und kulturelle Zugehörigkeit der Beitrittsländer zu Europa findet eine politische Entsprechung.
- Stabilität, Demokratie und Frieden werden exportiert und in weiten Teilen Europas langfristig gesichert.
- Die EU wächst um 100 Millionen zu einem Wirtschaftsraum mit 470 Millionen Menschen - es entsteht der größte einheitliche Markt der Welt und eine Weltwirtschaftsmacht, die für die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs hervorragend gerüstet ist.
3.1 Außenminister Fischer vor dem Europäischen Parlament am 12. Januar 1999 zur Erweiterung:
"Die EU darf nach dem Ende des Kalten Krieges nicht auf Westeuropa beschränkt bleiben, sondern es liegt im Wesen der europäischen Integrationsidee, daßsie gesamteuropäisch angelegt ist. Darüber hinaus lassen die geopolitischen Realitäten auch gar keine ernsthafte Alternative zu. Wenn dies richtig ist, dann hat die Geschichte 1989/90 bereitsüber das OB der Osterweiterung entschieden, allein das WIE und das WANN mußnoch gestaltet und entschieden werden. Nur durch den Beitritt der mittel- und osteuropäischen Partner lassen sich Wohlstand, Frieden und Stabilität für ganz Europa dauerhaft sichern. Und erst mit der Ö ffnung nach Osten löst die EU ihren Anspruch ein, als Kulturraum und Wertegemeinschaft für ganz Europa zu sprechen. Wir vergessen als Deutsche auch nicht, welch unschätzbaren Beitrag die Völker in Mittel- und Osteuropa für die Ü berwindung der Teilung Deutschlands und Europas geleistet haben."
4. Vorteile und Nutzen der Erweiterung
4.1 In der Wirtschaft
Den Kosten der Erweiterung stehen deren positive wirtschaftliche Effekte gegenüber. Die unmittelbaren Nachbarn Polen, Tschechische Republik und Ungarn sind in den letzten Jahren zu wichtigen Wirtschaftspartnern der EU und insbesondere auch Deutschlands geworden. Die Zuwächse im Handel mit den Mittel- und Osteuropäischen Staaten (MOE) sind überdurchschnittlich hoch. Dieser Trend dürfte sich auch künftig fortsetzen.
Durch das Wegfallen der tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnisse entsteht die Perspektive des größten einheitlichen Marktes der Welt mit rund 500 Mio. Menschen
- wird das Wirtschaftswachstum fördern. Es wird prognostiziert, dass durch den Beitritt beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland und Österreich um ca. 0,5% wachsen wird. Auch andere Länder - in West- wie in Mittel- und Osteuropa - werden unmittelbar davon profitieren.
- wird neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen lassen.
- gibt der europäischen Wirtschaft die Möglichkeit, ihre Stellung im globalen Wettbewerb zu festigen und ermöglicht der EU ein stärkerer Partner in den internationalen Handelsbeziehungen zu sein.
- Erschließung eines Zukunftsmarktes im Osten und die damit verbundene Erweiterung des mittel- und osteuropäischer Absatzmarktes
Die Übernahme der gesamten Rechtstexte der EU durch die Beitrittsländer schafft bessere Voraussetzungen für Auslandsinvestitionen in diesen Staaten:
- Die damit einhergehende Steigerung der Investitionen und des Kapitalverkehrs fördert das Wirtschaftswachstum und somit Arbeitsplätze in den Beitrittsländern. Dies kommt wiederum den alten Mitgliedsstaaten der EU zugute. Überdies wird das Wohlstandsgefälle durch die Integration sinken.
- Grenzüberschreitende Kooperationen z.B. in Bereichen der Forschung
- Neue Investitionen in und damit verbundene Standortverlagerungen tragen zum Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Unternehmen bei und sichern damit Arbeitsplätze.
Der EU-Handel mit den Beitrittskandidaten hat sich seit 1989 schon mehr als verdreifacht. Mit dem Fortschreiten der Umstrukturierung und der Annäherung wird sich diese Entwicklung fortsetzen und vertiefen:
- Die Transferzahlungen im Rahmen des Erweiterungsprozesses werden die Importnachfrage insbesondere nach Investitionsgütern aus den westlichen Nachbarländern steigern.
- Durch die neu entstehenden Märkte steigt der Export, dass wiederum fördert das Wirtschaftswachstum in den Mitgliedstaaten der EU und sichert damit Arbeitsplätze. Das Handelsvolumen Deutschlands mit den Beitrittsländern betrug 1998 ca. 142 Mrd. DM. Für Deutschland hat der Handel mit den Beitrittsländern schon heute größere Bedeutung als der mit den USA und Kanada zusammen. Zwischen 1997 und 1998 ist der deutsche Export nach Mittel- und Osteuropa um 19% gestiegen (dreimal mehr als der Export weltweit)4.
- Dieser Trend dürfte sich angesichts der Tatsache fortsetzen, dass die meisten Beitrittsländer Zukunftsmärkte darstellen. Der Handelsüberschuss zugunsten Deutschlands bei Gütern und Dienstleistungen zeigt, dass Qualität, Technologie und Erfahrung niedrigere Löhne und Produktionskosten überkompensieren.
Die Erweiterung bietet die Möglichkeit einer weiträumigen wirtschaftlichen Verflechtung mit den osteuropäischen Nachbarstaaten. Insbesondere in den neuen Bundesländern ist mit einer verstärkten Ansiedlung von Unternehmen zu rechnen, die sich im Osthandel engagieren.
Ohne die Perspektive eines Beitritts der MOE-Staaten5 bestünde die Gefahr, dass sich an der Ostgrenze der EU eine Zone der Instabilität entwickelt. Die Nichtintegration könnte die Schattenwirtschaft (ca. 20 bis 30% des Bruttoinlandsproduktes der MOE) verstärken, die Kooperation von Behörden erschweren und die Kapitalströme verschleiern helfen. Diese Kosten müssten im Falle einer Nichterweiterung generell berücksichtigt werden.
4.2 Bei der Umwelt
Die Erweiterung bietet die Chance, eine gesamteuropäische Umweltpolitik zu schaffen. Der Erweiterungsprozeß ist somit das effektivste Instrument zur Durchsetzung der EUUmweltstandards.
- Angesichts der Umweltprobleme in den Beitrittsländern, mit zum Teil erheblichen Auswirkungen auf die bisherigen Mitgliedsstaaten und damit gerade auch auf Deutschland, wird die Umsetzung der EU-Umweltvorschriften positive Wirkungen für alle haben. Durch die Erhöhung der Umweltstandards in den Beitrittsländern wird die grenzüberschreitende Luft- und Wasserverschmutzung stark reduziert werden können. Gewinn an Sicherheit durch Übernahme von hohen EU-Standards, z.B. bei AKWs, im Umweltschutz generell, im Luftverkehr, bei Gefahrgütertransporten
- Die Übernahme der Umweltvorschriften schafft gleiche Wettbewerbsgrundlagen für alle und fördert neue Absatzmärkte für die Umweltindustrie.
- Die europäische Umweltpolitik kann im Kontext des Beitritts ein Motor der Modernisierung der Wirtschaft in den Beitrittsländern sein.
4.3 Justiz und Inneres
Höhere Rechtssicherheit Die Erweiterung wird die Herstellung eines gemeinsamen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ermöglichen. Das bedeutet grundlegende Verbesserungen durch:
- Schaffung eines weitgehend gemeinsamen europäischen Asylsystems, das gemeinsame Standards für Asylverfahren, harmonisierte Aufnahmebedingungen und einen einheitlichen Asylstatus beinhalten soll.
- Verstärkung des Kampfes gegen organisierte und grenzüberschreitende Kriminalität sowie die Verschärfung der Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität.
- gemeinsame Bekämpfung des Drogen- und Menschenhandels sowie des Terrorismus. Gefährliche Spaltung Europas durch Osterweiterung verhindern und stabile und gerechte soziale Verhältnisse in Europa schaffen
- Friede kann durch soziale Ausgewogenheit gesichert werden
- 1250 km EU- Außengrenze wird zur Binnengrenze: innere Sicherheit verbessert sich
Überdies unterstützen die alten Mitgliedsstaaten der EU die MOE bei der Beseitigung der erhebliche Defizite im Bereich Justiz und Inneres und helfen geeignete Behörden und Institutionen zu schaffen.6
4.4 Beispiel Frankfurt / Oder Teil I
Ein Technologiepark ist die Hoffnung Frankfurts an der Oder auf eine bessere Zukunft: Er soll Investoren anlocken, Arbeitsplätze schaffen, die aus der DDR-Zeit ererbten daniederliegenden Industriestrukturen modernisieren. Damals war das Halbleiterwerk der größte Arbeitgeber der Region, um die tausend Polen arbeiteten dort. Inzwischen musste das Werk Konkurs anmelden, zuletzt zählte es gerade noch 150 Beschäftigte. In Frankfurt herrschen 17 Prozent Arbeitslosigkeit.
„ Nun sitzt H. Kahlke in einem Büro der Technologieparkverwaltung und schwärmt von dem Nutzen, den die EU-Erweiterung bringen könnte: "Für Investoren bedeutet das, dass sie die Vorteile unserer Infrastruktur mit den billigen Löhnen in Polen und den gut ausgebildeten Ingenieuren auf beiden Seiten der Grenze kombinieren können."
Der Park hat bereits einige Studien erstellen lassen, mit denen sich genau ermitteln lässt, ab welchem Kapitaleinsatz in welcher Branche ein Standbein auf beiden Seiten der Grenze günstiger ist als eine Firmengründung nur auf einer Seite. Und wie Investoren die Wirtschaftsförderung Brandenburgs mit der Polens kombinieren können. Als allgemeine Regel gilt: Kapitalintensive Investitionen kommen in Frankfurt besser weg, arbeitsintensive Bereiche sollten ins polnische Slubice ausgelagert werden.
Kahlke meint, am besten sei ein Mix aus beiden, wie bei einigen Call-Centern, die sich bereits umsehen und von hier aus den polnischen und den deutschen Markt bedienen. Die Grenzeüberbrücken sie -ähnlich wie die deutsch-polnische Universität in Frankfurt und Slubice - per Richtfunk. Selbst für ihre Studien nutzt die Technologiepark -Direktion den Vorteil der Grenzlage: Sie werden oft von polnischen Doktoranden der Universität erstellt. Wilke: "Hier in der Grenzregion geht das auch ohne Greencard."
Vor einigen Jahren erregte der Fall eines Bäckers die Gemüter, der seine Brötchen in Posen backen ließ, aber in Frankfurt verkaufte. Nach heftigen Protesten in Frankfurt musste er schließen - Posener Brötchen werden heute in Slubice verkauft, und die Frankfurter erstehen sie nun einfach jenseits der Grenze. In Polen ist der Fall zum Symbol. "Jeder zahlt selbst den Preis für seine Vorurteile", meint ein polnischer Unternehmer, der die bürokratischen Hürden und die deutsche Abneigung gegen polnische Investitionen beklagt. "Wenn wir nicht auf den deutschen Markt gelassen werden, dann kommen die großen Betriebe aus Deutschland eben zu uns, und die Ostdeutschen verlieren neben den Arbeitsplätzen auch noch Kapital, Know-how und Steuern."
H. Kahlke fragt: "Was hindert unsere Bäcker eigentlich daran, in Polen Zweigstellen einzurichten? Nach der Erweiterung kämen sie selbst in den Genuss der Wettbewerbsvorteile in Polen und müssten nicht die billige Konkurrenz von drüben fürchten." Stattdessen wartet man in Frankfurt auf Brüssler Gelder. Was wir wirklich brauchen", sagt Kahlke, "sind Gelder für eine bessere Ausbildung und Umschulungen. Wir müssen uns anpassen, nicht den Ist-Zustand mit zusätzlichen Subvention einfrieren. "
5. Probleme und Risiken der Erweiterung
Bestimmte Probleme, die die Erweiterung mit sich bringen kann, sind nicht zu leugnen. Hierzu gehören der Druck auf den Arbeitsmarkt, der Konkurrenzdruck für lohnintensive Branchen, die Konkurrenz für Dienstleistungsbetriebe in Grenzregionen und die Abwanderung von Betrieben in die MOE. Dennoch können die Befürchtungen über negative Auswirkungen der Erweiterung relativiert werden. Dies trifft auch für die vermeintlichen negativen Konsequenzen der Erweiterung in den neuen Bundesländern zu.
- In wissenschaftlichen Studien werden unterschiedliche Prognosen über die negativen Folgen der Erweiterung auf den Arbeitsmarkt gestellt. Das DIW7 hat in einer Studie vom Mai 2000 seine 1997 kalkulierte Zahl des Wanderungspotenzials (340.000-680.000 Zuzügler aus den MOE nach Deutschland pro Jahr) nach unten revidiert und rechnet jetzt mit in der Anfangsphase mit 200.000 Menschen pro Jahr und ca. 2 Mio. verteilt auf 30 Jahre.
- Die Aufnahme von Transformationsstaaten bringt zusätzlich Kriminalität, Terrorismus und höhere Gewaltbereitschaft mit sich
- Angesichts der Altersstruktur der deutschen und westeuropäischen Bevölkerung und den damit zusammenhängenden Problemen für die Wirtschaft und die Sozialversicherungssysteme muss eine erhebliche Zuwanderung stattfinden, um die Zahl der Erwerbspersonen zu erhalten. Zuwanderung liegt daher im Interesse Deutschlands, wenn sie zeitlich richtig gesteuert wird.
- Die Zuwanderung von Arbeitskräften aus den früheren südeuropäischen Beitrittsländern entwickelte sich übrigens auch nicht in dem damals befürchteten Umfang. · Der Zuwanderungsdruck wird geringer werden, wenn die EU sich weiter für die Waren und Dienstleistungen der Beitrittsländer öffnet. Dies ist eines der Ziele der im Rahmen der Erweiterungsprozesses stattfindenden Heranführungsstrategie.
- Bei schlechter regionaler Planung und Förderung: Migration (dauerhafte Wanderung: hier von Gebieten mit höherer Arbeitslosigkeit in Gebiete mit niedriger Arbeitslosigkeit) · Finanzielle und technische Hilfe sind Notwendig, ansonsten ist eine Erweiterung in kurzer Zeit nicht erreichbar (Schätzung der EU-Kommission: 74,8 Mrd. DM zwischen 2000 und 2006)
- Unterschiedliche Kostenniveaus: im Durchschnitt liegen z.B. Personal-, Energie- und Transportkosten 10 bis 40% unter den Vergleichswerten
Beispiel Frankfurt /Oder Teil II8
In der Stadt selbst scheint niemand Kahlkes Optimismus zu teilen. In den Gesprächen der ostdeutschen Frankfurter erscheint der EU-Beitritt Polens wie ein unabwendbares Unheil, mit dem man sich abfinden muss. Besonders für Handwerker und kleine Unternehmer kämen durch die polnische Konkurrenz harte Zeiten, befürchtet Klaus Baldauf, Sonderbeauftragter der Stadt für internationale Zusammenarbeit. "Unsere Unternehmer sind zu vorsichtig, um ihre Chance zu erkennen. Es wäre höchste Zeit, sich den polnischen Markt zu erschließen." Doch bisher haben erst ganz wenige Frankfurter gewagt, auf der anderen Seite der Oder zu investieren
Während nach Umfragen für die jungen Polen die Grenzöffnung vor allem bessere Einkaufs- und Reisemöglichkeiten bedeutet, finden 83 Prozent der jungen Menschen in Frankfurt/Oder, sie habe vor allem die Kriminalitätsrate in die Höhe getrieben. "Die Grenzregion hat besondere Probleme", erklärt Baldauf. "Ein spezieller Fonds zur Förderung könnte da helfen." So etwas hat bereits EU-Kommissar Günter Verheugen in Aussicht gestellt, zusammen mit Ü bergangsfristen bei der Freizügigkeit für billigere polnische Arbeitskräfte. Nach einer Umfrage des kultursoziologischen Lehrstuhls der Frankfurter Europa- Universität Viadrina vom vergangenen Jahr sind immerhin 38,8 Prozent der befragten jungen Erwachsenen in der Stadt der Ansicht, Ausländer nähmen Deutschen die Arbeit weg. Gleichzeitig beklagt die Industrie- und Handelskammer, dass trotz der hohen Arbeitslosigkeit die Zahl der unbesetzten Stellen ansteige. Ü bergangsfristen bei der Freizügigkeit seien nur in eng begrenzten Bereichen empfehlenswert, heißt es in einem Bericht der Arbeitsgemeinschaft der Wirtschaftskammern europäischer Grenzregionen. Dort wird geraten, diese nur im Dienstleistungsbereich anzuwenden, an die makroökonomische Entwicklung der jeweiligen Region zu knüpfen und dezentral auf Länderebene zu steuern.
Jahr für Jahr erhöht sich die Zahl der leer stehenden Wohnungen um 800. Es ist abzusehen, wann die Mieten so weit sinken, dass sie auch für Polen attraktiv werden. Doch vorerst geht der Trend in die andere Richtung: Frankfurter ohne Berührungsängste bauen ihre Eigenheime auf der anderen Seite der Oder. Folge: Kaufkraft, Kapital und Arbeitsplätze entstehen in Slubice statt in Frankfurt. Die polnische Kleinstadt verzeichnet seit Jahren eine höhere Dynamik an Existenzgründungen, ihre Einwohnerzahl wächst.
8. Voraussetzungen für den Beitritt zur EU
Sowohl die Beitrittskandidaten als auch die Europäische Union müssen für die Erweiterung bestimmte Kriterien erreichen, um den Zusammenhalt und das Funktionieren einer größeren Europäischen Union zu sichern.
8.1 Voraussetzungen für die Beitrittsländer
Die Maastricht - Kriterien Diese Kriterien muss ein Land erfüllen, das in die EU aufgenommen werden will. Die Kriterien wurden bereits 1990 auf der KSZE-Konferenz für mittel- und osteuropäische Staaten, die ihr Wirtschaftliches System wechseln wollten(von Planwirtschaft zur freien Marktwirtschaft), durch die Pariser Charta festgelegt. Im Maastrichter Vertrag wurden diese Ziele als Voraussetzung für den Beitritt zur EU.
- Demokratie und Rechtstaatlichkeit
- Einhaltung und Achtung der Menschenrechte
- Schutz von Minderheiten
- Funktionierende Marktwirtschaft
- Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten
- Fähigkeit , die aus einer Mitgliedschaft erwachsenen Verpflichtungen zu übernehmen und sich die Ziele der politischen Union und der Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen machen.
- Kriterien für die Einführung des Euro müssen erfüllt sein:
1. Inflation: Die Inflation darf nicht mehr als 1.5 Prozentpunkte über den drei EU-Staaten mit der niedrigsten Inflationsrate liegen.
2. Neuverschuldung: Die Neuverschuldung aller staatlichen Kassen darf im Referenzjahr (bei den momentanen Mitgliedstaaten der EU war 1997) einen Wert von 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nicht übersteigen. Eine punktgenaue Erfüllung dieser Kriterien sieht der Maastrichter-Vertrag nicht vor. Es reicht vielmehr, wenn das Defizit „erheblich und laufend zurückgegangen ist und eine Wert in der Nähe des Referenzwertes erreicht hat“.
3. Schuldenstand: Die staatliche Gesamtverschuldung darf 60 Prozent des BIP im Jahr 1997 nicht überschreiten. Auch hier verlangt der Maastricht-Vertrag keine Punktlandung. Es reicht vielmehr, wenn die Schulden „hinreichend rückläufig“ sind und sich „rasch genug“ dem Referenzwert nähern.
4. Die langfristigen Zinssätze dürfen höchstens zwei Prozent über dem Stand der drei Länder mit dem niedrigsten Inflationsniveau liegen.
5. Währung: Die nationale Währung muss seit mindestens zwei Jahren in den normalen Schwankungsbereichen des Europäisch Währungssystems geblieben sein
8.2 Voraussetzungen für die Europäische Union
Eine wichtige Aufgabe ist es, die EU selber erweiterungsfähig zu machen, d.h. ihre Institutionen gemeinsam zu reformieren.
- Der Europäische Rat in Nizza (7.-10. Dezember 2000) hat mit seinen Beschlüssen die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die EU auch nach der bevorstehenden Erweiterung handlungsfähig bleibt. In diesem Sinne wurden unter anderem die Ausweitung des Mehrheitsprinzips bei EU-Entscheidungen sowie eine Neuregelung der Stimmengewichtung im Rat beschlossen. Nach Ratifizierung der Reformen wird die EU somit planmäßig bis Ende 2002 in der Lage sein, neue Mitglieder aufzunehmen.
Eine EU mit 25 oder mehr Mitgliedern kann nicht mehr auf die gleiche Weise funktionieren wie die Europäischen Gemeinschaften zu ihrer Gründung 1958 mit 6 Mitgliedsstaaten. Die institutionelle Reform der EU wird gegenwärtig auf einer Regierungskonferenz verhandelt, die Ende 2000 abgeschlossen werden soll. Die Lösung der Hauptfragen (Frage der Ausdehnung von Mehrheitsentscheidungen, Stimmgewichte der Mitgliedsländer im Rat, Größe und Zusammensetzung des EP) hat das Ziel, die EU beitrittsfähig zu machen.
6.2.1. Besonderheiten der Länder berücksichtigen
Bei der Heranführung der Beitrittskandidaten müssen die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Besonderheiten der Länder berücksichtigt werden. Dafür muß die Heranführung den Ländern Spielraum für eine dynamische Neuorientierung lassen. Zudem muss beachtet werden, dass die Kostenvorteile der Beitrittsländer nicht zerstört werden dürfen, weil sonst den betreffenden Länder die wirtschaftliche Kraft für die integration in den Binnenmarkt fehlt. Protektionistische Zielsetzung (Protektionismus = Wirtschaftspolitik, die die einheimische Industrie durch Einfuhrverbote oder Einfuhrbeschränkungen und die Erhebung von Schutzzöllen auf sonst günstige Importprodukte zu schützen versucht) der Mitgliedsstaaten dürfen die wirtschaftlichen Wachstumspotentiale der Beitrittskandidaten und damit die Grundlage für die Integration in die Union nicht zerstören.
9. Der Stand des Beitrittsprozesses
Der Verhandlungsprozess mit Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Estland, Slowenien und Zypern Die Verhandlungen mit der sogenannten "Luxemburg-Gruppe" wurden auf Ministerebene (Beitrittskonferenzen) am 10. November 1998 eröffnet. Bisher wurden konkrete Verhandlungen in insgesamt 29 von 31 Kapiteln aufgenommen, offen sind nur noch die beiden Kapitel Institutionen und Sonstiges, die erst abschließend thematisiert werden können. Das letzte substantielle Kapitel (Landwirtschaft) wurde auf Ministerebene am 14. Juni 2000 eröffnet. Insgesamt sind pro Land zwischen dreizehn und siebzehn Kapitel vorläufig abgeschlossen. Die anderen Kapitel wurden wegen Anträgen auf Übergangsfristen durch Kandidatenländer oder zusätzlichem Informationsbedarf der EU zurückgestellt.
Es geht jetzt darum, leichtere Probleme aus dem Weg zu räumen und die Zahl der offenen Übergangsregelungen zu reduzieren. Die EU geht deshalb dazu über, die Gewährung einfacher Übergangsregelungen in der Substanz zu verhandeln und hat inzwischen einigen zugestimmt.
Der Verhandlungsprozess mir Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Slowakei Am 15. Februar 2000 wurde der Verhandlungsprozess mit der sogenannten "Helsinki-Gruppe" auf Ministerebene in Brüssel formell eröffnet.
Mit Rumänien wurden zunächst neun, mit Bulgarien elf und mit der Slowakei, Lettland, Litauen und Malta je sechzehn Kapitel eröffnet, von denen je nach Land sechs bis zwölf Kapitel bereits vorläufig abgeschlossen wurden. In Übereinstimmung mit den Beschlüssen des Europarats in Helsinki wird damit dem Grundsatz der Differenzierung Rechnung getragen.
Vor allem den baltischen Ländern, der Slowakei und Malta wird zudem die Möglichkeit eingeräumt, binnen eines vertretbaren Zeitraumes zu Staaten der bisherigen ersten Gruppe aufzuschließen.
In den Schlussfolgerungen des Vorsitzes hat das Europäische Gipfeltreffen in Nizza (7.-10. Dezember 2000) die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die ersten Kandidaten bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2004 als neue Mitglieder aufgenommen werden können. Das ist ein wichtiges politisches Signal, das den Beitrittsländern die erforderliche Planungssicherheit für die Finalisierung ihrer Beitrittsvorbereitungen gibt.
Zur Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels bedarf es allerdings fortgesetzter, intensiver Bemühungen, insbesondere auf Seiten der Beitrittsländer, bei der effektiven Anwendung des EU-Rechts und der Schaffung der notwendigen Verwaltungskapazitäten.
Die EU selbst hat beschlossen, sich in den Verhandlungen von der Wegskizze leiten zu lassen, die von der Kommission im November 2000 vorgeschlagen worden war.
9. Geschichte der EU ab 1987
1987
1. Juli: Die "Einheitliche Europäische Akte" tritt in Kraft (Festlegung der endgültigen Vollendung des Binnenmarkts auf den 1.1.1993).
1990
1. Januar: Die erste Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) beginnt (Liberalisierung des Kapitalverkehrs, bessere Annäherung der Wirtschafts- und Währungspolitiken der Mitgliedstaaten).
1993
1. Januar: Vollendung des EG-Binnenmarkts (Die EG ist ein Wirtschaftsraum, in dem der freie Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist).
1. November: Der Vertrag über die Europäische Union (Vertrag von Maastricht) tritt in Kraft. In ihm wird die Zusammenarbeit in weiteren Politikbereichen vereinbart (z.B. in Sachen Außenund Sicherheitspolitik, Entwicklungshilfe, Justiz und Inneres, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, u.a.). Bis zum Jahre 1999 soll eine Wirtschafts- und Währungsunion und eine Politische Union verwirklicht werden.
1994
1. Januar: Die zweite Stufe der WWU beginnt: die Mitgliedstaaten versuchen, die für die
Aufnahme in die WWU festgelegten Auflagen zu erfüllen (in der Preis- und Währungsstabilität, bei den Zinsen und in der Haushaltsdisziplin).
1. Januar: Das Europäische Währungsinstitut (EWI) mit Sitz in Frankfurt am Main wird errichtet, das den Aufbau einer Europäischen Zentralbank vorbereiten soll.
1995 "Europa der 15"
1. Januar: Finnland, Schweden und Österreich treten bei.
26. März: Das Übereinkommen zur Durchführung des Schengener Abkommens tritt im
Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, Belgiens, Luxemburgs, der
Niederlande, Spaniens und Portugals in Kraft. Seit 1995 traten Italien, Griechenland, Österreich, Dänemark, Finnland und Schweden dem SDÜ bei, das allerdings für die drei Nordischen Staaten noch nicht in Kraft gesetzt worden ist. Ihre volle Teilnahme einschließlich der vollständigen Abschaffung der Binnengrenzkontrollen wird von den übrigen Vertragsparteien nach einem Prüfungsverfahren durch einstimmigen Beschluss festgestellt. Mit den nicht der EU angehörenden Mitgliedern der Nordischen Passunion (Norwegen und Island) wurden 1996 Schengen- Kooperationsabkommen geschlossen.
1996
Eine Regierungskonferenz prüft, ob weitere Vertragsänderungen notwendig sind, um die Ziele der EU zu erreichen.
1997
2. Oktober: Unterzeichnung des "Vertrags von Amsterdam".
Er sieht die weitere Reform der EU-Institutionen vor, so eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Gebiet Justiz und Inneres und die weitere Stärkung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Die Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parlaments werden erweitert.
1998
2. Mai: Die Staats- und Regierungschefs beschließen, dass die Europäische Währungsunion am 1. Januar 1999 mit 11 Mitgliedsstaaten (Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Spanien) beginnt.
31. März: Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Ungarn, Polen, Estland, der Tschechischen Republik, Slowenien und Zypern. ("Luxemburg-Gruppe")
1999
1. Januar: Die dritte Stufe der WWU beginnt: Einführung des Euro im bargeldlosen Zahlungsverkehr.
24./25.März: Auf der Sondertagung des Europäischen Rats in Berlin einigen sich die Mitgliedstaaten auf das Reformpaket "Agenda 2000" zur Reform der internen EU-Politiken.
1. Mai: Der Amsterdamer Vertrag tritt in Kraft.
2000
15. Februar: Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Slowakei. ("Helsinki-Gruppe")
2000
1. Januar Griechenland tritt der europäischen Währungsunion bei und führt den Euro ein.
7.- 10. Dezember: Auf dem Europäischen Rat von Nizza einigen sich die fünfzehn Staats- und Regierungschefs auf den Vertragsentwurf, der die notwendigen inneren Reformen vorsieht, welche die Voraussetzungen für die spätere Erweiterung schaffen.
Strategien und Vorhaben zur Erweiterungsfähigkeit der EU
12.1. Reformen
Um die Europäische Union für die Aufnahme weiterer Mitglieder fit zu machen ist es notwendig, die europäischen Institutionen und Formen der Zusammenarbeit zu reformieren. Im Rahmen einer Regierungskonferenz, die im Februar 2000 von den Außenministern eröffnet wurde, werden zurzeit die notwendigen Reformen ausgearbeitet. So soll sicher gestellt werden, dass die Europäische Union auch nach der Erweiterung effizient arbeiten kann. Damit die Dynamik des Beitrittsprozesses nicht verzögert wird, wurde die Regierungskonferenz auf dem Europäischen Rat in Nizza Ende 2000 abgeschlossen.
12.2. Der Plan für die EU- Erweiterung
In dieser zeitlichen Reihenfolge könnten nach derzeitigem Stand ab dem Jahr 2004 neue Mitglieder in die EU aufgenommen werden:
Beitrittsstufe 1: Malta, Zypern, Estland, Ungarn, Polen. Hohes Wachstum mit 4,5 bzw. 4,2 Prozent auf Malta und Zypern. Geringe Arbeitslosigkeit mit 5,3 bzw. 3,6 Prozent. Beide Länder haben die Gesetzgebung nach EU-Regeln weit vorangebracht, können dem Wettbewerbsdruck in der EU gut standhalten. In Estland, Ungarn und Polen Steigerung des Bruttoinlandsprodukts bis zu sechs Prozent, aber noch Struktur-Mängel. Handel zwischen Polen und EU intensiv. Kapitalverkehr in Estland nach EU-Regeln. Ungarn führend bei ausländischen Direktinvestitionen.
Beitrittsstufe 2: Slowenien, Tschechien. Stabiles Wachstum in beiden Ländern bei drei bis fünf Prozent. Mit 7,9 bzw. 6,5 Prozent mäßige Arbeitslosigkeit. Warenverkehr positiv. In beiden Ländern werden aber die Grenzkontrollen und der Kampf gegen Korruption als mangelhaft bewertet.
Beitrittsstufe 3: Lettland, Litauen, Slowakei, Bulgarien. Schwankende Wachstumsraten um zwei Prozent. Hohe Arbeitslosigkeit mit 13,8 (Lettland), 13,3 (Litauen) und 12,5 Prozent (Slowakei). Diese drei Länder könnten dem EU-Wettbewerbsdruck nur nach drastischen Wirtschaftsreformen standhalten. Bulgarien hat mit minus 12,7 Prozent eine sinkende Industrieproduktion. Reformbedürftige Verwaltung, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit.
Beitrittsstufe 4: Rumänien. Mit minus 17 Prozent sinkende Industrieproduktion. Dramatische Inflationsrate von 45,8 Prozent. Grassierende Korruption und schlechte Verwaltung. Noch nicht wettbewerbsfähig.
12.3. Finanzielle Unterstützung
PHARE ist das Hilfsprogramm der EU für Mittel- und Osteuropa. Es wird von der europäischen Kommission koordiniert. Die EU hat von 1990 bis 1994 im Rahmen von PHARE den Partnerländern in Mittel- und Osteuropa insgesamt 4,25 Milliarden ECU (Abkürzung für European Currency Unit: Europäische Währungseinheit) zur Verfügung gestellt. Das PHARE- Programm soll neben der Beteiligung der Beitrittsländern an den Struktufonds und einem Sonderprogramm für die Landwirtschaft die Finanzierungsgrundlage von Fördermaßnahmen im Rahmen der „Partnerschaft für den beitritt bilden. Es fördert die Reformen in Kernbereichen der Wirtschaft wie Energie, Industrie, Ausbildung, Finanzdienstleistungen, Landwirtschaft und Umweltschutz und Maßnahmen zur Umsetzung des Acquis. Dazu gehören die Umstrukturierung und Privatisierung von Staatsbetrieben, die Förderung der unternehmerischen Initiative und die Reform der Gesetzgebung und des Steuerrechts. Auf dem Gipfel des Europäischen Rats in Cannes im Juni 1995 wurde beschlossen, PHARE neu auszurichten: Das Programm wird künftig für mehrere Jahre aufgelegt und um Investitionshilfen im Infrastrukturbereich erweitert. PHARE ist damit nicht mehr nur das größte Hilfsprogramm für Drittstaaten unserer Zeit, sondern auch ein wichtiges Werkzeug der Union zur Vorbereitung der mittel- und osteuropäischen Ländern auf den Beitritt zur EU.
Ergebnisse des EU- Gipfels in Nizza
In den frühen Morgenstunden des 11. Dezembers, nach viertägigen Verhandlungen, endete in Nizza der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs der fünfzehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Es war der längste Gipfel in der Geschichte der Union. Auf ihm lastete ein hoher Erwartungsdruck. Thema war die Reform der EU, um die Voraussetzungen für die geplante Erweiterung der EU zu schaffen.
Bundeskanzler Gerhard Schröder resümierte in der Abschlusspressekonferenz in Nizza, dass das strategische Ziel einer Integration Europas in Nizza erreicht worden sei. Diesem Ziel habe man alles andere untergeordnet. Es sei ein Stück harter Arbeit gewesen. Nizza habe kein Traumergebnis gebracht, aber die EU sei jetzt "aufnahmefähig für neue Mitglieder". Der Gipfel habe "das hinbekommen, was zu machen war", sagte der Kanzler.
Zähester Verhandlungspunkt war die Neugewichtung der Stimmen im Rat der Europäischen Union ("Rat" oder "Ministerrat"). Im Ergebnis wurden die Stimmen der einzelnen Mitgliedstaaten in diesem Gremium neu gewichtet und die Mehrheitsentscheidungen ausgeweitet. Deutschland hat künftig die selbe Stimmenzahl (nämlich 29) wie die drei anderen großen Länder Frankreich, Italien und Großbritannien. Spanien und - nach einem Beitritt - Polen erhalten beide 27 Stimmen. Die Niederlande werden mit 13 über eine Stimme mehr als Belgien verfügen. Ferner müssen Mehrheitsentscheidungen bis zur Erweiterung der Union mit mindestens 71 Prozent aller Stimmen getroffen werden, nach der Erweiterung dann mit 73 Prozent. Es konnte eine Form des von Deutschland favorisierten demografischen Faktors durchgesetzt werden: So können die Mitgliedstaaten beantragen, dass eine Entscheidung erst dann gültig sein soll, wenn die dahinter stehende Bevölkerungszahl der zustimmenden Länder zusammen mindestens 62 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmacht. Der demografische Faktor soll zudem bei der Sitzverteilung im Europäischen Parlament eine größere Rolle spielen. Mit der Erweiterung um weitere Mitgliedstaaten werden dort die Sitze neu verteilt. Alle bisherigen Mitgliedstaaten erhalten zukünftig weniger Sitze. Nur die Anzahl der Sitze Deutschlands bleibt mit 99 unverändert.
In der Abschluss-Pressekonferenz befand der Kanzler, das in Nizza erzielte Ergebnis könne sich sehen lassen. Deutschland habe - auch mit Rücksicht auf das gute deutsch-französische Verhältnis - auf eine Auseinandersetzung mit der französischen Präsidentschaft verzichtet. Die Einigung auf eine verstärkte Zusammenarbeit einzelner Mitgliedstaaten der EU st ein wichtiger Beschluss des Europäischen Rates. Sie soll es einer Gruppe von EU-Mitgliedern ermöglichen, in Einzelfragen intensiver zusammenzuarbeiten. Das werde immer wichtiger in einem größeren Europa, sagte Bundeskanzler Schröder. Mitmachen könne jeder, der mitmachen wolle. Diese Form der Zusammenarbeit kann künftig nicht mehr an einem Veto eines einzelnen Staates scheitern.
Der Rat begann mit der Europakonferenz, an der die Beitrittsstaaten teilnahmen. Dort wurde bekräftigt, dass die EU bis zum 1.1.2003 aufnahmefähig für Beitrittskanidaten sein will. Die Beitrittskandidaten müssten ihre Länder ihrerseits bis zu diesem Termin beitrittsfähig machen. Anschließend tagte der Europäische Rat. Einer seiner ersten Tagesordnungspunkte war die feierliche Proklamation der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Der Rat gab hofft, dass die ersten Beitrittsländer bereits 2004 an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen könnten. billigend zur Kenntnis.
Ungarn drückt beim EU- Beitritt aufs Tempo9
Budapest - Im ungarischen "Staatssekretariat für Integration" geht es dieser Tage noch betriebsamer zu als sonst. Der EU-Gipfel von Nizza und die neue schwedische Ratspräsidentschaft eröffnen neue Möglichkeiten für raschere Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen, und die ungarische Regierung ist entschlossen, sie voll auszunutzen. "Was die Schweden wollen, hat es seit Beginn des Verhandlungsprozesses noch nie gegeben", sagt Hauptabteilungsleiter Peter Györkös. "Zum ersten Mal hat ein Land seine EU- Präsidentschaft unter das Zeichen der Osterweiterung gestellt." Tatsächlich steht unter den vorrangigen Zielen des schwedischen Präsidentschaftsprogramms die Osterweiterung an erster Stelle. Die Ideen aus Stockholm, wie man schneller und besser mit den Beitrittskandidaten verhandeln könnte, verbinden sich mit den Entscheidungen des EU-Gipfels in Nizza vergangenen Dezember zu einer Durchbruchsstimmung, die die Ungarn genießen. "Wir sind optimistischer als früher, dass es jetzt gelingen kann, den Verhandlungsprozess zu beschleunigen", sagt Györkös. Ungarn liegt ohnehin ganz gut im Rennen. Im November hatte Brüssel die bisherigen Leistungen bei den Vorbereitungen auf die EU-Mitgliedschaft als gut bewertet. Was dennoch bemängelt wurde, soll gr öß tenteils noch in diesem Monat und spätestens bis Ende März korrigiert werden. Dabei geht es vor allem um Rechtsharmonisierungen in den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft und Transport. Die EU hat sich verpflichtet, bis Ende 2002 für neue Kandidaten aufnahmefähig zu sein. Ungarn, sagt Gyökrös, habe nun seinerseits die Pflicht, bis zu diesem Datum beitrittsfähig zu sein. Besondere Bedeutung misst man in Budapest der Tatsache bei, dass von Seiten der EU immer häufiger eine zeitlich differenzierte Aufnahme der Kandidaten erwogen wird, auf der Grundlage der Leistungen jedes einzelnen.
12. Quellenangabe:
- BPA - Broschüre "Europa 2000“
- Europa von A-Z
- Facharbeit des Erkunde - LK des 12. Jhrg. der KTS über „Die Auswirkungen der Euroeinführung auf Flensburger Betriebe, die auch in anderen Währungsräumen Handel betreiben“
- Aktuell 2001 Harenbergverlag
- Die Welt
- Frankfurter Rundschau
- Verschiedene Ausgaben des „Spiegels“
- Berliner Morgenpost
13. Anhang
Mehr Nutzen als Schaden 10
DIW: EU- Osterweiterung stützt das deutsche Wachstum - Kaum Arbeitsplätze in Gefahr
AvG Berlin - Die Erweiterung der Europäischen Union nach Osten wird keine Einwanderungsflut aus den betreffenden Staaten auslösen. Auch sei nicht mit einem Druck auf deutsche Arbeitsplätze zu rechnen. Im Gegenteil könnten osteuropäische Arbeitnehmer in Zukunft zunehmend Lücken auf dem deutschen und westeuropäischen Arbeitsmarkt füllen und damit zum Wirtschaftswachstum beitragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die deren Präsident Klaus Zimmermann gestern in Berlin vorstellte.
Die Erweiterung der Europäischen Union ist derzeit für das Jahr 2003 geplant. Im ersten Jahr kommen nach den Berechnungen des DIW 350 000 Menschen aus Osteuropa in die EU. Nach Deutschland kommen mit 220 000 allein zwei Drittel, davon mit je 66 000 die meisten aus Polen und Rumänien. Um oder unter 20 000 Personen wandern aus Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn ein. Eine Verschiebung der Erweiterung würde die Zahlen kaumändern, sagte Zimmermann.
Die Zahl der Einwanderer aus dem Osten nimmt in den Folgejahren rapide ab; im Jahr 2030 sind es nur noch etwa Tausend. Bis dahin leben dann etwa 2,5 Millionen Osteuropäer in Deutschland; das macht etwa 3,5 Prozent der Bevölkerung aus. Derzeit beträgt der Ausländeranteil bereits neun Prozent.
Das deutsche Wirtschaftswachstum verändert sich durch die Osteuropäer im schlechtesten Fall entweder gar nicht oder steigt in den ersten fünf Jahren nach der Osterweiterung der EU um zusätzlich 0,5 Prozentpunkte im Jahr, wenn gut qualifizierte Einwanderer kommen sogar um zwei Prozentpunkte. Die Löhne könnten laut Zimmermann binnen fünf Jahren durch den Zuwanderungsdruck um 0,6 Prozentpunkte niedriger ausfallen: « In einem Fünfjahreszeitraum ist das eine kaum bemerkbare Gr öß e » . Bis zu 7500 Deutsche würden durch Osteuropäer zu einem Jobwechsel gezwungen. Auch das sei nicht viel: Bei etwa 30 Millionen Beschäftigten sind das 0,00 025 Prozent.
Die Zuwanderung sei eher zu niedrig als zu hoch, stellte Zimmermann fest. Denn um die Lücke auf dem Arbeitsmarkt zu füllen, die durch den Schwund der deutschen Bevölkerung in den Jahren nach 2010 entsteht, wäre eine Einwanderung von 200 000 Arbeitnehmern pro Jahr nötig. « Das ist nur eine theoretische Zahl und heißt nicht, dass wir wirklich so viele brauchen. Aber es gibt doch die Richtung vor. » Die Bevölkerung in Deutschland nimmt nach geltenden Prognosen von derzeit 82 Millionen auf etwa 65 Millionen im Jahr 2030 ab.
Zimmermann stützt sich bei seinen mathematischen Prognosen auf Erfahrungswerte mit Südeuropa. Soübertrifft schon seit den 1970er-Jahren die Rückwanderung aus Deutschland nach Portugal, Spanien und Italien die Zuwanderung hierher - trotz des Wohlstandsgefälles. Um dennoch Sorgen vor einer Ü berfremdung zu begegnen, schlägt Zimmermann befristete Einwanderungsquoten vor. « Ich gehe aber davon aus, dass diese Quoten, egal wie niedrig sie gesetzt werden, eher unterschritten werden. »
Unter dem Eindruck erfolgreicher, wachstumsfördernder Einwanderungspolitik in anderen EU- Staa ten hat die deutsche Politik in jüngster Zeit einen leichten Kurswechsel vollzogen. So sprach sich der Unions-Fraktionschef Friedrich Merz jüngst dafür aus, künftig mehr « qualifizierte Einwanderer » ins Land zu lassen, « die an geeigneter Stelle in Wirtschaft und Wissenschaft tätig sind » . Die SPD vermeidet das Thema derzeit aber noch und lehnt auch eine Debatte um ein Einwanderungsgesetz ab
[...]
1 Deutsches Institut für Weltwirtschaftsforschung
2 Quelle: Aktuell 2001
3 EU- Durchschnitt = 100
4 Quelle: Wirtschaftsministerium der BRD
5 MOE - Staaten: mittel - osteuropäische Staaten
6 Ausschnitte aus der „Berliner Morgenpost“ vom 17.08.00
7 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
8 Ausschnitte aus der „Berliner Morgenpost“ vom 17.08.00
9 Artikel aus der Zeitung „Die Welt“
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der EU-Osterweiterung-Sprachvorschau?
Die Sprachvorschau zur EU-Osterweiterung umfasst eine umfassende Inhaltsübersicht, darunter Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Stichwörter, um ein tiefes Verständnis der Materie zu ermöglichen.
Welche Länder sind Beitrittskandidaten zur Europäischen Union?
Die Beitrittskandidaten werden in die "Luxemburggruppe" (Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Estland, Slowenien, Zypern) und die "Helsinkigruppe" (Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta) unterteilt. Die Türkei hat ebenfalls den Kandidatenstatus.
Welche Gründe sprechen für eine Erweiterung der Europäischen Union?
Die Erweiterung wird durch das strategische und wirtschaftliche Interesse sowohl der jetzigen als auch der zukünftigen Mitglieder angetrieben und zielt darauf ab, Frieden, Stabilität und Demokratie zu exportieren, die wirtschaftliche Integration zu fördern und die kulturelle Vielfalt zu bereichern.
Welche wirtschaftlichen Vorteile bietet die EU-Osterweiterung?
Die EU-Osterweiterung bietet vielfältige wirtschaftliche Vorteile, darunter das Entstehen des größten einheitlichen Marktes der Welt, Wirtschaftswachstum, neue Beschäftigungsmöglichkeiten, gestärkte Wettbewerbsfähigkeit und die Erschließung von Zukunftsmärkten in Osteuropa.
Welche Umweltvorteile sind mit der EU-Erweiterung verbunden?
Die Erweiterung bietet eine Chance zur Schaffung einer gesamteuropäischen Umweltpolitik und zur Durchsetzung von EU-Umweltstandards, wodurch die grenzüberschreitende Luft- und Wasserverschmutzung reduziert und gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Umweltindustrie geschaffen werden.
Welche Verbesserungen in Justiz und Inneres sind durch die EU-Erweiterung zu erwarten?
Die Erweiterung ermöglicht einen gemeinsamen Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts durch ein gemeinsames europäisches Asylsystem, verstärkten Kampf gegen Kriminalität, Geldwäsche, Drogen- und Menschenhandel sowie Terrorismus.
Welche Probleme und Risiken sind mit der Erweiterung verbunden?
Zu den Problemen und Risiken gehören möglicher Druck auf den Arbeitsmarkt, Konkurrenzdruck für lohnintensive Branchen, Abwanderung von Betrieben und Zunahme der Kriminalität. Diese Risiken werden jedoch durch die Vorteile relativiert.
Welche Voraussetzungen müssen für einen Beitritt zur EU erfüllt sein?
Beitrittskandidaten müssen die Maastricht-Kriterien erfüllen, darunter Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, eine funktionierende Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck standzuhalten. Auch die EU selbst muss erweiterungsfähig sein und ihre Institutionen reformieren.
Wie ist der aktuelle Stand des Beitrittsprozesses?
Die Verhandlungen mit den verschiedenen Kandidatengruppen (Luxemburg- und Helsinki-Gruppe) sind in unterschiedlichen Stadien. Die EU strebt an, bis Ende 2002 aufnahmefähig zu sein und hofft, die ersten Kandidaten 2004 aufnehmen zu können.
Welche wesentlichen Ereignisse in der Geschichte der EU sind ab 1987 zu nennen?
Wichtige Ereignisse sind die Einheitliche Europäische Akte (1987), die Vollendung des Binnenmarktes (1993), der Vertrag von Maastricht (1993), die Erweiterung um Finnland, Schweden und Österreich (1995), der Vertrag von Amsterdam (1997), die Einführung des Euro (1999) und der Vertrag von Nizza (2000).
Welche Strategien und Vorhaben zur Erweiterungsfähigkeit der EU gibt es?
Zu den Strategien gehören Reformen der EU-Institutionen, ein Plan für die EU-Erweiterung (Beitrittsstufen) und finanzielle Unterstützung durch Programme wie PHARE.
Was waren die Ergebnisse des EU-Gipfels in Nizza?
Der EU-Gipfel in Nizza führte zur Neugewichtung der Stimmen im Rat, zur Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen und zur Einigung auf eine verstärkte Zusammenarbeit einzelner Mitgliedstaaten. Die EU erklärte sich bereit, bis zum 1.1.2003 aufnahmefähig zu sein.
Welche Quellen wurden für diese Sprachvorschau verwendet?
Verwendete Quellen sind unter anderem BPA-Broschüren, Europa von A-Z, Facharbeiten, aktuelle Nachrichtenquellen wie Die Welt, Frankfurter Rundschau, Spiegel und Berliner Morgenpost.
Was sind die Kernaussagen des DIW-Artikels zur EU-Osterweiterung im Anhang?
Der DIW-Artikel besagt, dass die EU-Osterweiterung das deutsche Wachstum stützt und kaum Arbeitsplätze gefährdet. Eine Einwanderungsflut wird nicht erwartet, stattdessen könnten osteuropäische Arbeitnehmer Lücken auf dem deutschen Arbeitsmarkt füllen.
- Quote paper
- Christoph Petersen (Author), 2001, EU Osterweiterung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101884