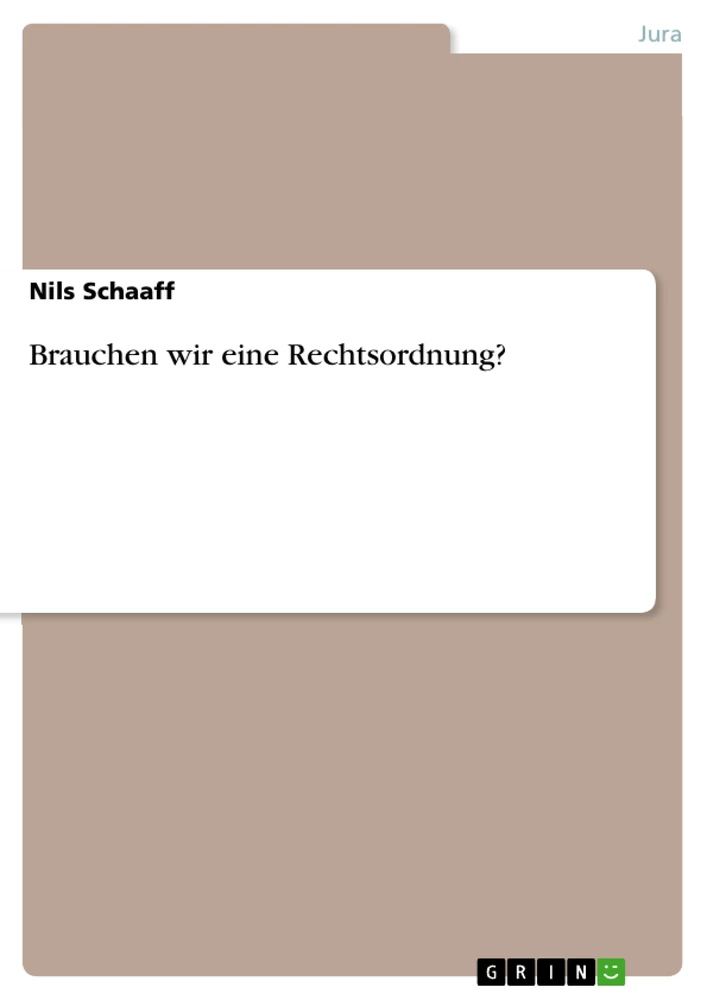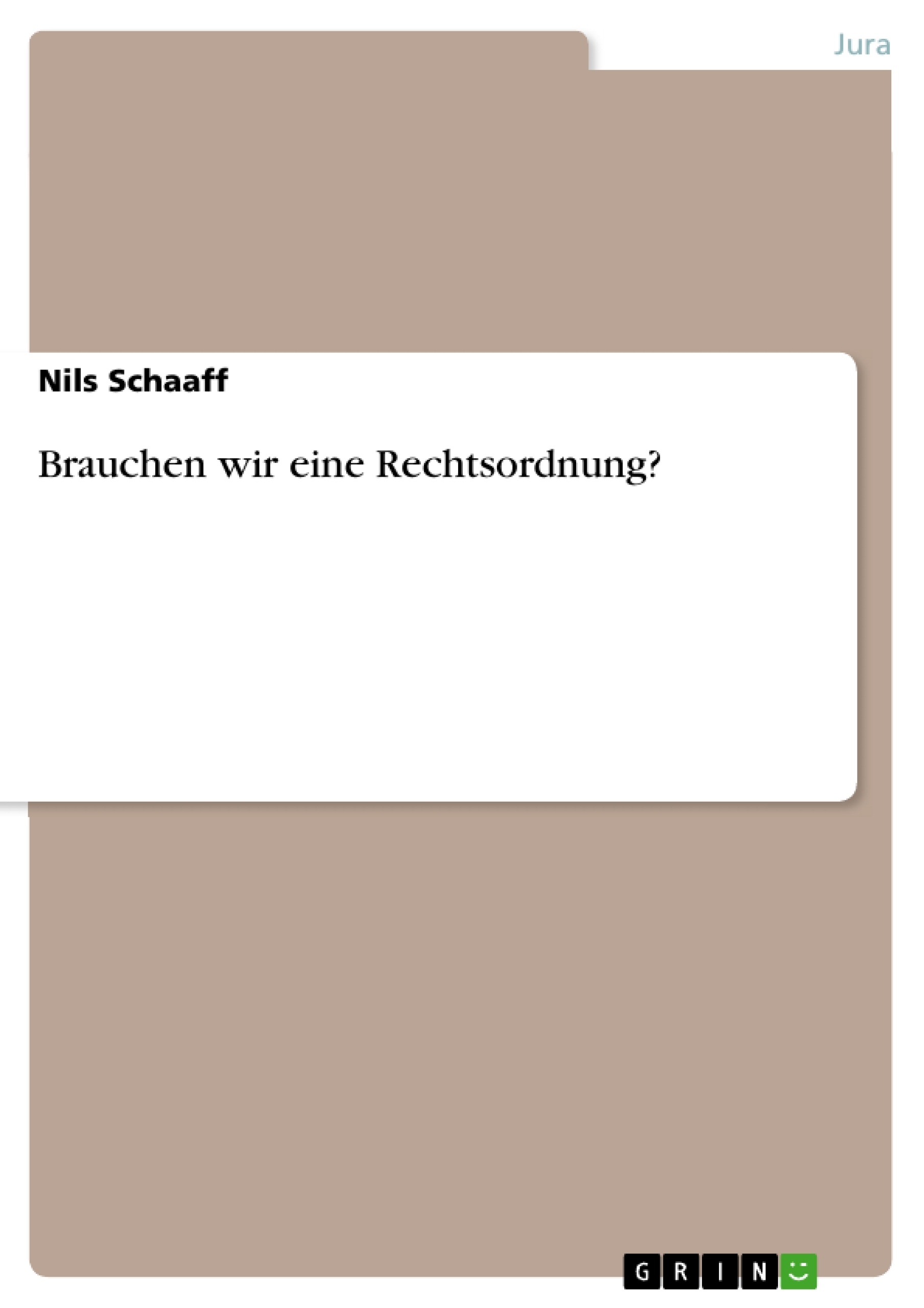Brauchen wir eine Rechtsordnung?
Was alles für eine Rechtsordnung spricht
Robinson Crusoe lebte allein auf einer Insel und brauchte daher auch keine Rechtsordnung. Mit wem hätte er schon in Konflikt geraten können? Heute leben so viele Menschen auf der Erde, daß man ohne Regeln nicht mehr auskommt. Sie ermöglichen erst das friedliche Zusammenleben in der Gemeinschaft, indem sie das Verhalten bestimmen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, dem einzelnen die Entscheidung - richtig oder falsch - abnehmen und ihm gleichzeitig die Konsequenzen für sein Tun ankündigen. Ihre Aufgabe ist die Sozialkontrolle, da sie auf abweichendes Verhalten reagieren und Verhaltenskonformität anstreben. Verhaltenserwartungen der Gesellschaft an den einzelnen werden als Normen bezeichnet, wozu Sitte, Religion, Moral und Recht zählen. Diese Normen können je nach Einhaltung oder Verletzung positive oder negative Sanktionen nach sich ziehen.
Die Rechtsnormen unterscheiden sich von den sozialen Normen insbesondere durch ihre zwangsweise Durchsetzbarkeit. Die Rechtsdurchsetzung erfolgt in einem geregelten (Verwaltungs- oder Gerichts-) Verfahren, an dessen Abschluß eine gerechte Entscheidung stehen soll.
Was "gutes" Recht ausmacht
Das Recht muß drei Ansprüchen genügen: Es muß gerecht, nützlich und verläßlich sein. Im Idealfall ergänzen sich Gerechtigkeit, Nützlichkeit und Rechtssicherheit und führen alle in dieselbe Richtung, wobei man von der Trinomie des Rechts spricht. Allerdings besteht die Gefahr, daß ein rein an Nützlichkeitserwägungen und Zweckmäßigkeitsüberlegungen orientiertes Recht ausgenutzt wird und zu Unrecht entartet. So darf z.B. niemand bestraft werden, ohne daß er ein entsprechendes Gesetz verletzt hat: nulla poena, nulla crimen sine lege.
Die Rechtsquellen
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Recht und Gesetz, denn nicht alles was Recht ist, ist auch Gesetz; die Gesetze sind nur eine Teilmenge vom Recht. Man unterscheidet das geschriebene Recht, auch gesetztes Recht (positives Recht) genannt. Darunter fallen Gesetze im formellen Sinn sowie Verordnungen und Satzungen, wobei sich diese im Zweifelsfall dem Gesetz beugen müssen. Gesetze im formellen Sinn beinhalten Verfassungs-, Bundes- oder Ländergesetze. Während die Gesetze von der Legislative, also vom Parlament, beschlossen werden, werden Verordnungen von der Regierung oder Ministerien erlassen. Satzungen sind Rechtsvorschriften autonomer Körperschaften (z.B. der Kommunen, Hochschulen etc.), daneben werden als Satzungen auch die Organisationsstatuten privat- und handelsrechtlicher Personenvereinigungen bezeichnet. Weitere geschriebene Quellen sind das Staatengemeinschaftsrecht, Tarifverträge und gerichtliche Normenkontrollentscheidungen. Nicht als Rechtsquellen gelten hingegen Gerichtsentscheidungen, Verwaltungsvorschriften und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB).
Aus dem Rahmen fällt das Gewohnheitsrecht, das nicht schriftlich fixiert ist. Es beruht auf langanhaltender Übung, die auf einer entsprechenden Rechtsüberzeugung gründet. So ist etwa das Pilzesammeln im (staatlichen) Wald kraft Gewohnheitsrechts erlaubt. Das Gewohnheitsrecht ist das flexibelste Recht, da es nicht schrifltich vorliegt und sich so leichter wandeln kann.
Recht und Unrecht
Die Frage, ob es "ungerechte Gesetze" gibt, wird verschieden beurteilt. Im Rechtspositivismus wird alles, was formell auf dem dafür vorgesehenen Weg entstanden ist, als gesetztes, festgeschriebenes Recht und damit als verbindlich angesehen. Problematisch ist diese Ansicht im Hinblick auf den nationalsozialistischen Unrechtsstaat, da demnach alles vorschriftsgemäß verabschiedete Recht, selbst wenn es eklatantes Unrecht darstellte, als Recht zu befolgen gewesen wäre. Dem stehen die Naturrechtler gegenüber und behaupten, daß Bürger nur dann die Gesetze befolgen müssen, wenn diese dem Naturrecht nicht widersprechen. Auch hier gibt es aber einen Haken: Naturrecht ist nicht näher definiert als das Recht, das der Natur oder Vernunft des Menschen entspricht. Und das ist natürlich viel zu allgemein formuliert. Gleichwohl wird im Hinblick auf die Rechtsperversion im Nationalsozialismus vertreten, daß Gesetze, die im unerträglichen Maße im Widerspruch zur Gerechtigkeit stehen als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen haben (sog. Radbruch'sche Formel).
Recht und Macht sind eine explosive Kombination: Sowohl Recht ohne Macht als auch Macht ohne Recht sind schädlich. Im ersten Fall fehlt die durchsetzende Kraft, im zweiten wäre die Konsequenz das Faustrecht (der Stärkere gewinnt) oder Leben in einem totalitären Staat.
Die Rechtsordnung - wie sieht sie aus?
Grundsätzlich unterscheidet die Rechtsordnung zwischen zwei Rechtsgebieten: dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht (Ö-Recht). Bei der Frage, nach welchen Kriterien die einzelnen Rechtsbeziehungen den beiden Bereichen zugeordnet werden, scheiden sich allerdings die Geister. Tatsächlich gibt es keine plausible Erklärung, die immer anwendbar wäre. Einige Juristen argumentieren mit der Interessentheorie, ob private oder öffentliche Interessen im Vordergrund stehen. Andere stellen auf die beteiligten Rechtssubjekte ab und fragen danach, ob diese sich gleichgeordnet (dann Privatrecht) oder in einem Über-/Unterordnungsverhältnis gegenüberstehen (dann Ö-Recht). Wohl vorherrschend ist die Sonderrechtstheorie, die darauf abstellt, ob Zuordnungssubjekt der Rechtssätze der einzelne Private oder der Staat ist.
Privatrecht - Öffentliches Recht
Das Privatrecht basiert im wesentlichen auf dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), welches einen Allgemeinen Teil, das Schuld-, Sachen-, Familien- und Erbrecht beinhaltet. Das BGB gilt für jeden und regelt die Beziehungen zwischen den Bürgern. Handelsrecht und Arbeitsrecht sind weitere Bestandteile des Privatrechts. Dem Ö-Recht wird das Verfassungsrecht, das Verwaltungsrecht, das Strafrecht und das Prozeßrecht zugeordnet.
Materielles Recht - Formelles Recht
Häufig gestellte Fragen
Wozu brauchen wir eine Rechtsordnung?
Eine Rechtsordnung ermöglicht das friedliche Zusammenleben in der Gemeinschaft, indem sie das Verhalten bestimmt, ein Zusammengehörigkeitsgefühl schafft, dem einzelnen die Entscheidung - richtig oder falsch - abnimmt und ihm gleichzeitig die Konsequenzen für sein Tun ankündigt. Sie dient der Sozialkontrolle, reagiert auf abweichendes Verhalten und strebt Verhaltenskonformität an.
Was unterscheidet Rechtsnormen von sozialen Normen?
Rechtsnormen unterscheiden sich von sozialen Normen insbesondere durch ihre zwangsweise Durchsetzbarkeit. Die Rechtsdurchsetzung erfolgt in einem geregelten Verfahren, an dessen Abschluß eine gerechte Entscheidung stehen soll.
Was macht "gutes" Recht aus?
Das Recht muss gerecht, nützlich und verlässlich sein. Im Idealfall ergänzen sich Gerechtigkeit, Nützlichkeit und Rechtssicherheit (Trinomie des Rechts). Es darf niemand bestraft werden, ohne dass er ein entsprechendes Gesetz verletzt hat (nulla poena, nulla crimen sine lege).
Welche Rechtsquellen gibt es?
Man unterscheidet das geschriebene Recht (Gesetze im formellen Sinn, Verordnungen, Satzungen), Staatengemeinschaftsrecht, Tarifverträge und gerichtliche Normenkontrollentscheidungen. Nicht als Rechtsquellen gelten Gerichtsentscheidungen, Verwaltungsvorschriften und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Das Gewohnheitsrecht ist eine weitere Rechtsquelle, die nicht schriftlich fixiert ist und auf langanhaltender Übung beruht.
Was ist der Unterschied zwischen Recht und Gesetz?
Nicht alles, was Recht ist, ist auch Gesetz. Die Gesetze sind nur eine Teilmenge vom Recht. Das geschriebene Recht (positives Recht) umfasst Gesetze, Verordnungen und Satzungen.
Was ist das Problem mit "ungerechten Gesetzen"?
Der Rechtspositivismus sieht alles, was formell auf dem dafür vorgesehenen Weg entstanden ist, als verbindlich an. Naturrechtler behaupten, dass Bürger nur Gesetze befolgen müssen, die dem Naturrecht nicht widersprechen. Die Radbruch'sche Formel besagt, dass Gesetze, die im unerträglichen Maße im Widerspruch zur Gerechtigkeit stehen, der Gerechtigkeit weichen müssen.
Welche Rolle spielen Recht und Macht?
Recht ohne Macht fehlt die durchsetzende Kraft. Macht ohne Recht führt zum Faustrecht oder zum Leben in einem totalitären Staat. Beide Konstellationen sind schädlich.
Wie ist die Rechtsordnung aufgebaut?
Die Rechtsordnung unterscheidet zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht (Ö-Recht). Es gibt verschiedene Theorien zur Unterscheidung (Interessentheorie, Subjektstheorie, Sonderrechtstheorie).
Was gehört zum Privatrecht und was zum öffentlichen Recht?
Das Privatrecht basiert im Wesentlichen auf dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Handelsrecht und Arbeitsrecht sind weitere Bestandteile. Zum Ö-Recht gehören Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht und Prozessrecht.
Was ist der Unterschied zwischen materiellem und formellem Recht?
Das materielle Recht regelt die Rechtsverhältnisse (z.B. Zivilrecht), während das formelle Recht die Durchsetzung dieser Regelungen regelt (z.B. Zivilprozessrecht).
- Citar trabajo
- Nils Schaaff (Autor), 2001, Brauchen wir eine Rechtsordnung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101806