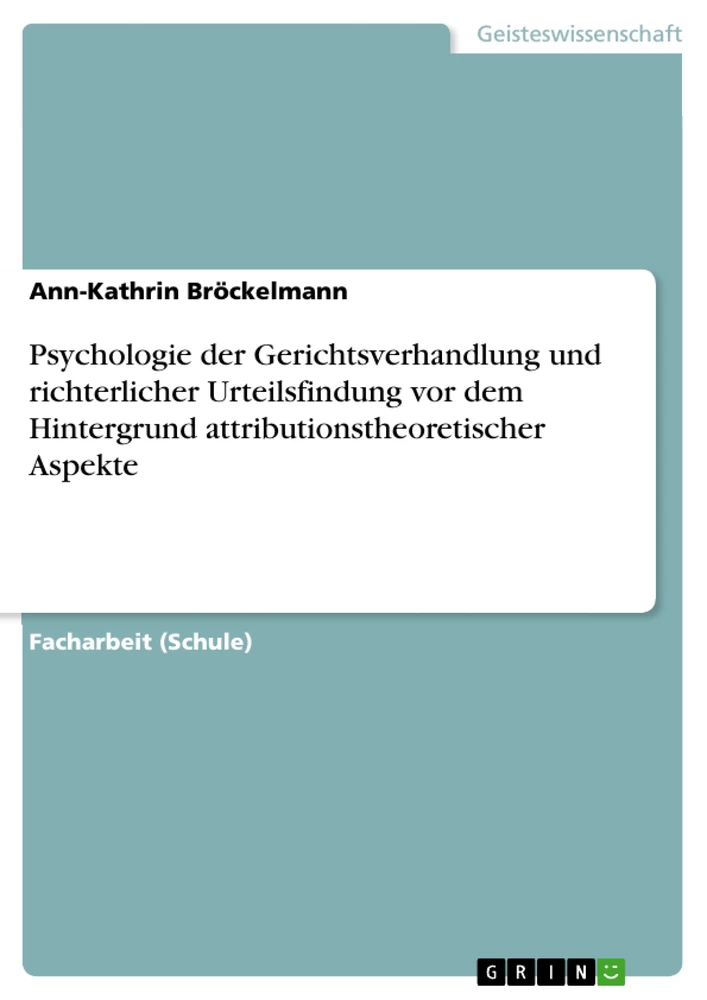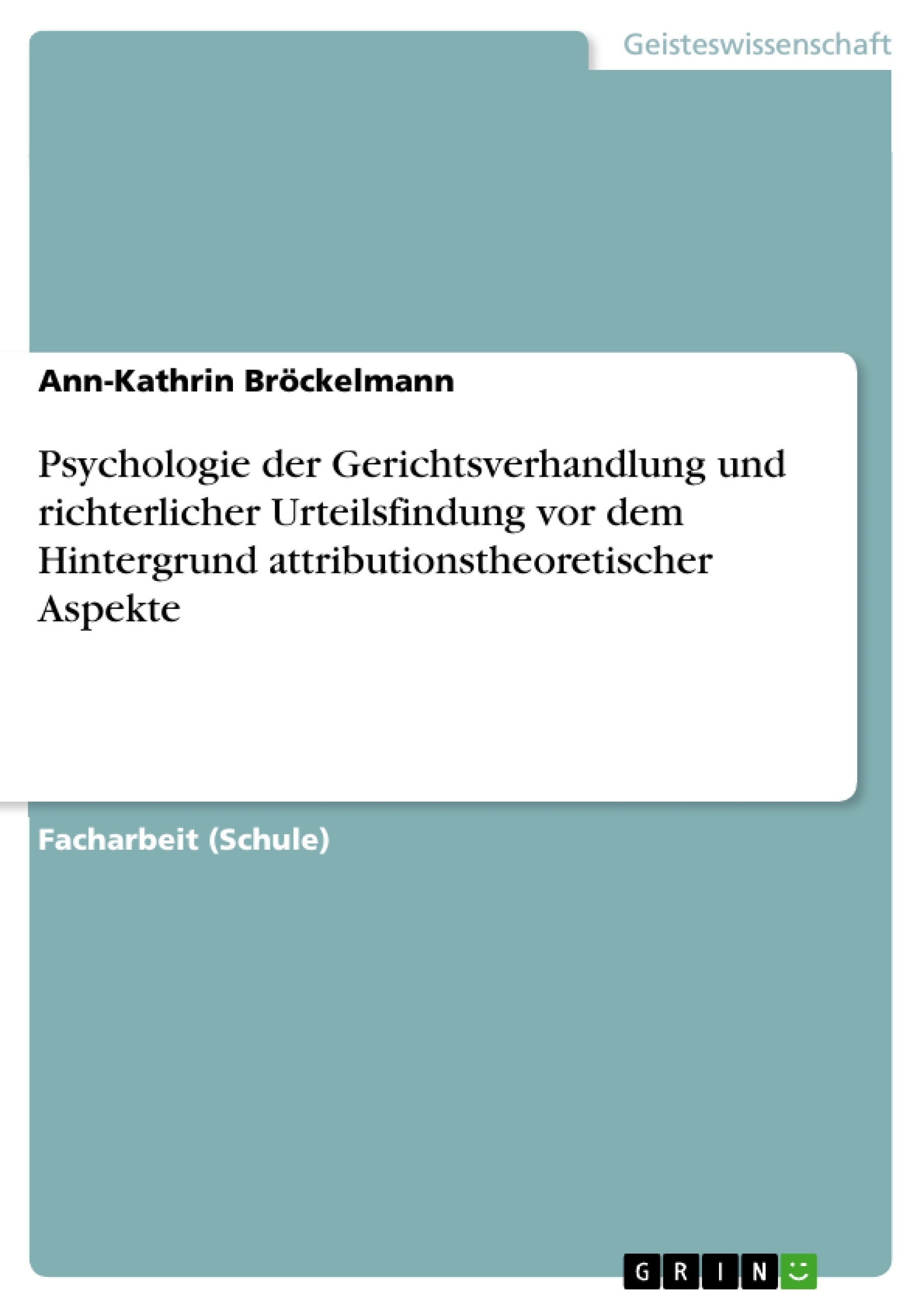Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Innerer Monolog einer fiktiven Richterin
1.2 Thematik
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Hauptteil
2.1 Attribution
2.1.1 Was sind eigentlich Attributionen?
2.1.2 Attributionsforschung - drei Theorieansätze
2.1.2.1 Heiders Anfänge
2.1.2.2 Die Interferenztheorie nach Jones & Davis
2.1.2.3 Das multidimensionale Attributionsmodell nach Kelley
2.2 Wodurch werden Attributionen verzerrt?
2.2.1 Verzerrungen von Attribution durch fehlerhafte Wahrnehmung und Informationsverarbeitung aufgrund begrenzter Kognitionsfähigkeit des Menschen
2.2.1.1 Der fundamentale Attributionsfehler
2.2.1.2 Die Akteur-Beobachter-Verzerrung
2.2.1.3 Verzerrung kontra Konsens-Information
2.2.1.4 Verzerrung durch falschen Konsens
2.2.1.5 Verzerrung zugunsten von Kausalität
2.2.2 Motivational bedingte Verzerrungen
2.3 Der Attributionsprozess beim Richter
2.3.1 Das Attributionsmodell im Strafrecht
2.3.2 Einflüsse der drei Dimensionen auf die Attribution von Schuldfähigkeit
2.4 Wahrnehmungsverzerrung beim Richter
2.4.1 Hypotheseneffekt: Der vorinformierte Richter
2.4.2 Hypothesenkonforme Wahrnehmung und Vermeidung kognitiver Dissonanz
2.5 Verzerrung der richterlichen Attribution
2.5.1 Sozialkategorie des Angeklagten
2.5.2 Fundamentaler Attributionsfehler und Akteur-Beobachter-Verzerrung
2.5.3 Vernachlässigung von Konsensinformation - Konsensüberschätzung
2.5.4 Kovariation: Verzerrung zugunsten von Kausalität
2.5.5 Konfiguration: Verzerrung aufgrund von Schemata
2.5.6 Weitere Faktoren der Beeinflussung
3 Schlussteil
3.1 Was denkt unsere fiktive Richterin jetzt?
3.2 Weiterführende Gedanken
Literaturverzeichnis
EINLEITUNG
Das Thema meiner Facharbeit lautet ,,Psychologie der Gerichtsverhandlung und richterlicher Urteilsfindung". Die Kernproblematik ist, wie ein Richter zu seinem Urteil findet. Der folgende Abschnitt soll einen Einblick in die Gedankenwelt einer Richterin geben.
1.1 Innerer Monolog einer fiktiven Richterin
Vor vier Jahren habe ich mein Staatsexamen bestanden, seitdem übe ich den Beruf der Richterin aus - nach meinen Einschätzungen immer mit der Motivation, gewissenhaft und verantwortungsbewusst zu urteilen. Doch im Laufe der Zeit, in der ich ständig mit neuen Fällen konfrontiert wurde, gab es natürlich auch Momente, in denen ich mich fragte, ob ich die richtige Entscheidung, das gerechte Urteil treffe. An so einem Punkt in meinem Leben bin ich nun schon wieder angelangt und ich muss mir wiederum bewusst darüber werden, welch einflussreiche Rolle ich im Leben anderer Menschen spiele und dass auch ich, als Mensch, nur begrenzte Fähigkeiten besitze.
Der Grund, warum ich mich entschloss, Richterin zu werden, war sicherlich mein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und der Wunsch, selbst etwas an der Welt zu verändern.
Der Richterberuf erschien mir dazu perfekt: Als verfahrensbestimmendes Glied des deutschen Justizsystems würde ich bei der Ausübung meiner Tätigkeit strengen Normen folgen und mich zur gerechten Beurteilung an festgelegten Regeln und Gesetzen orientieren. Ich glaubte, keine Schwierigkeiten zu haben, eine Problematik aus einer objektiven Perspektive zu betrachten und zu bewerten; außerdem hatte ich das Bild eines immer sicher und selbstbewusst auftretenden Richters im Kopf. Wie könnte solch ein Verantwortungsträger unter Selbstzweifeln leiden oder persönliche Ansichten in sein Urteil einfließen lassen? Heute weiß ich, dass meine damaligen Vorstellungen illusorisch waren. Ich hatte mir ein zu einseitiges Bild gemacht. Ich vergaß, dass ich ein Mensch bin. Ein Mensch, der Gefühle hat und nicht rein rational denkt.
Es muss da noch andere Faktoren, als die rechtlichen Normen geben, die Einfluss auf mein Urteil haben und an denen ich mich orientiere. Doch was beeinflusst mich, was lässt mich emotional urteilen? Warum gelingt es mir nicht, jeden Angeklagten nur als Objekt anzusehen? Dies und viele andere Fragen quälen mich. Ich beginne, anzuzweifeln, ob ein Richter als Mensch überhaupt fähig ist, ein gerechtes Urteil zu finden.
1.2 Thematik
Hier deutet sich bereits die Reichweite der Problematik an: Unterliegt der Richter wirklich nur den gesetzlichen Normen während der Verhandlung? Oder wird er durch bestimmte kognitive Prozesse, persönliche und soziale Faktoren in erheblichem Maße beeinflusst? Aus diesem Grunde habe ich das Thema mit einem Zusatz formuliert. Ich möchte die Urteilsfindung nicht mit Hilfe von Paragraphen und dem deutschen Justizsystem erklären, sondern den Schwerpunkt auf die Betrachtung des Richters als System Mensch aus einem psychologischen Blickwinkel legen. Konkreter gesagt, werde ich den richterlichen Entscheidungsprozess vor dem Hintergrund Attributionstheoretischer Aspekte analysieren und bewerten.
Diese Teildisziplin der Sozialpsychologie wurde von mir ausgewählt, weil sie hilft, die Prozesse der Ursachenzuschreibung und die dabei auftretenden Verzerrungen, denen der Richter bei der Entscheidung über Schuld oder Nicht-Schuld des Angeklagten unterliegt, zu beschreiben und zu erklären.
Obwohl aus rechtlichem Blickwinkel allgemeine Variablen wie Situation, Beurteiler oder Objekt für die Urteilsbildung keine Rolle spielen dürften, da sie strengen Regeln und exakter Normierung unterliegen, haben sie Einfluss auf die richterliche Urteilsbildung. Deshalb kann diese ebenfalls mit allgemeinen Theorien erklärt werden: Unter psychologischem Blickwinkel gilt nämlich, dass sich solche Variablen in keinem Fall vollständig normieren lassen. Der Richter wird von ihnen genauso beeinflusst, wie jeder andere Mensch auch.1
1.3 Aufbau der Arbeit
Zunächst werde ich einen allgemeinen, wissenschaftlichen Erklärungsansatz zu Attributionstheorien formulieren, in dem ich mich sowohl mit den verschiedenen Theorien selbst, als auch mit den Verzerrungsmechanismen auseinandersetze. Nach der theoretischen Erläuterung folgt im zweiten Abschnitt die praktische Anwendung dieser Kenntnisse auf die spezifische Situation des Richters. Dazu ziehe ich Fallbeispiele und psychologische Untersuchungen aus der Fachliteratur heran, um so zu einer eigenen Synthese zu gelangen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Teil auf der Frage, durch welche Faktoren die richterlichen Attributionen in der Verhandlung verzerrt werden und welche Auswirkungen diese auf seine Urteilsfindung haben. Hier ist eine Verknüpfung mit Phänomenen der sozialen Wahrnehmung und Informationsverarbeitung sinnvoll, um die nötigen Erklärungen zu liefern. Im Schlussteil werde ich noch einmal auf die fiktive Richterin zurückgreifen, die mit Hilfe der psychologischen Betrachtungsweise der Problematik ihre Anfangsfragen beantworten kann und ihre Urteilsfähigkeit neu einschätzen wird.
Die Arbeit schließt mit einer persönlichen Stellungnahme, in der ich die Ergebnisse zur abschließenden Bewertung des deutschen Justizsystems und der richterlichen Urteilsbildung zusammenfasse. Außerdem werden Anregungen zur Verbesserung dieser Situation durch das Ausschalten von Verzerrungsmechanismen angeführt.
HAUPTTEIL
1.4 Attribution
1.4.1 Was sind eigentlich Attributionen?
Attributionen2 sind Gegenstand unserer alltäglichen kognitiven Prozesse, denen wir unbewusst unterliegen. Jedes in sozialem Kontakt stehende Individuum versucht Erklärungen durch Ursachenzuschreibung zu finden. Dabei sind, laut Attributionsforschern, vor allem zwei Aspekte von Bedeutung: (1) die kausalen Antezedenzien, also die Ursachen und (2) die Intentionalität der beobachteten Handlung.
Als Konsequenz der Attribution entsteht ein Eindruck von der handelnden Person. Dieser beeinflusst, welche Eigenschaften, Fähigkeiten und Einstellungen einem Menschen vom Beobachter zugeschrieben werden und somit auch, wie dieser sich gegenüber dem Handelnden letztendlich verhält. Die Erforschung von Attributionsprozessen in der Sozialpsychologie ist aus diesem Grunde von besonderem Interesse.
1.4.2 Attributionsforschung - drei Theorieansätze
Die Attributionstheorie ist keineswegs eine eindeutig formulierte Theorie, sondern setzt sich zusammen aus einer Vielzahl von Ideen, Regeln und Hypothesen. Ich werde im Folgenden auf die drei bekanntesten wissenschaftlichen Ansätze eingehen
1.4.2.1 Heiders Anfänge
Der erste Psychologe, der sich mit Kausalattribution , also mit der Attribution von Zusammenhängen zwischen Ursachen und Handlungen, beschäftigte, war Heider (1958). Er setzte voraus, dass ein Individuum danach strebt, seine Umwelt zu verstehen, vorherzusagen und zu kontrollieren, um erfolgreich in der Gesellschaft zu existieren. Zu diesem Zweck verhalte es sich wie ein naiver Wissenschaftler, der sich Prinzipien von Verursachung und Logik bedient, um genau dieses Verständnis zu erreichen. Nach Heider differenziert der Beobachter dabei zwischen äußeren, umgebungsbedingten und inneren, individuellen Einflüssen. Bei der Ursachenzuschreibung ergeben sich seinen Ansichten nach zwei Fragen:
(1) Wurde die Handlung innerlich oder äußerlich verursacht? Und (2) falls sie innerlich verursacht wurde, war sie intentional oder nicht-intentional? Falls sie äußerlich verursacht wurde, bedarf es keiner weiteren Nachfrage nach den Ursachen; sie sind in Umweltbedingungen zu finden, auf die der Handelnde selbst keinen Einfluss hat.3
In der Psychologie galt Heiders Modell jedoch noch als unspezifisch. Dies veranlasste spätere Psychologen zu tiefgreifenderer Forschung.
1.4.2.2 Die Interferenztheorie nach Jones & Davis
Jones & Davis (1965) entwickelten, anknüpfend an Heider, die Theorie der korrespondierenden Schlussfolgerungen, die auch als Interferenztheorie bezeichnet wird. Nach dieser Theorie ,,ist das Ziel des Attributionsprozesses zu schließen (Inferenz), dass beobachtetes Verhalten und die Absicht, die dazu geführt hat, mit einer zugrundeliegenden, stabilen Eigenschaft der Person korrespondieren. Im Prozess der Schlussfolgerung auf persönliche Dispositionen gibt es zwei hauptsächliche Stadien: die Attribution einer Absicht und die Attribution von Dispositionen." 4
Bei der Attribution einer Absicht verarbeitet der Beobachter die Informationen aus entgegengesetzter Richtung, also von den Konsequenzen zur Handlung. So gelingen ihm Schlussfolgerungen, in wieweit der Handelnde diese Konsequenzen vorher abschätzen konnte.
Als zweiter Schritt folgt die Attribution von Dispositionen: Schlussfolgerungen zugunsten innerer Disposition werden gemacht, je mehr sogenannte nicht-gemeinsame Effekte auftreten. Dies ist der Fall, wenn eine Handlung gewählt wird, obwohl Alternativen mit weniger extremen Konsequenzen zur Auswahl stünden oder wenn sie gewählt wird obwohl sie sozial unerwünscht ist, die Konsequenzen also allgemeinen Wertvorstellungen widersprechen. In solchen Fällen muss, aus dem Blickwinkel des Beobachters, die Handlung entscheidend von inneren Einflüssen bestimmt sein.5
Neben diesen Erklärungen für die Attributionsprozesse, führen die Wissenschaftler außerdem eine persönliche Involviertheit des Beobachters an, die ebenfalls die Ursachenzuschreibung beeinflusst.
Die Interferenztheorie wurde durch wissenschaftliche Experimente bestätigt und beschreibt den Attributionsprozess schon weitreichenderer als ihr Vorgänger. Trotzdem weist sie gewisse Schwachpunkte auf, beschäftigt sie sich beispielsweise nur mit solchen internal verursachten Handlungen, die vom Beobachter als intentional definiert wurden, nicht aber mit solchen, die als nicht-intentional gedeutet werden. Beispielhafte Dispositionen solcher Art sind Leichtsinnigkeit, Ungeschicklichkeit oder Vergesslichkeit.6
1.4.2.3 Das multidimensionale Attributionsmodell nach Kelley
Das dritte Modell ist das multidimensionale Attributionsmodell nach Kelley (1967, 1973). Es bezieht sich auf das Kovariationsprinzip, bei dem Attributionen auf Grundlage mehrerer Beobachtungen vorgenommen werden. Es hat als Kerngedanken, dass immer dann Kausalität attribuiert wird, wenn Ursache und Wirkung gekoppelt auftreten und auch gemeinsam wieder verschwinden.
Attributionsprozesse unterliegen nach Kelley drei Dimension:
1. Zum ersten stellt sich die Frage nach der Konsistenz der Handlung, also ob der Akteur
sich schon über einen längeren Zeitraum hin und in verschiedenen Situationen in dieser Weise verhält oder ob die Handlung einzigartig ist. Bei geringer Konsistenz wird der Beobachter das Verhalten des Akteurs äußeren Faktoren oder dem Zufall zuschreiben, während bei hoher Konsistenz innere Dispositionen als Ursache gedeutet werden..
2. Die zweite Dimension ist die Distinktheit einer Handlung. Der Beobachter entscheidet, ob die Handlung des Akteurs hoch distinktiv ist, also allein Reaktion auf eine bestimmte Person, Situation oder einen Reiz, oder ob der Akteur in dieser Weise auf viele Reize, Personen oder Situationen reagiert und es somit wenig distinktiv ist. Hoch distinktives Verhalten führt zu äußeren, situationsgebundenen Attributionen, während wenig distinktives Verhalten zu internaler Ursachenzuschreibung führt.
3. Drittens sammelt der Beobachter Informationen über den Konsens des beobachteten Verhaltens. Er entscheidet, ob andere Menschen in einer ähnlichen Situation genauso reagieren würden, oder ob die Handlung des Akteurs einzigartig und außergewöhnlich ist. Zeigt nur der Akteur das Verhalten, so ist der Konsens gering und es kann geschlossen werden, dass die Ursachen für das Verhalten von innerer Natur sind. Herrscht ein hoher Konsens, kann hingegen auf externale Handlungsursachen geschlossen werden. Wie die Vorgänger, so besitzt auch dieses Modell Schwachpunkte, beispielsweise wird vorausgesetzt, dass dem Beobachter mehrere Informationen zur Verfügung stehen. Oft liegt jedoch nur eine Information zur Ursachenzuschreibung vor. In diesem Fall findet Konfiguration mit Hilfe vorgefertigter kausaler Schemata statt. Konfigurationen sind für den Attributionsprozess ebenfalls entscheidend, werden aber in Kelleys Modell nicht berücksichtigt.
1.5 Wodurch werden Attributionen verzerrt?
Attributionstheorien setzen voraus, dass Ursachenzuschreibung ein rationaler, logischer und damit vorhersagbarer Prozess ist. Sie vernachlässigen jedoch den Aspekt, dass dieser Prozess im Alltag ,,unter unseren irrationalen, motivationsbedingten Verzerrungen oder unter unserer Unfähigkeit, mit der verfügbaren Information umzugehen" 7 , leidet. Auf genau solche Verzerrung der Attribution, die letztendlich zu Beurteilungsfehlern führen kann, möchte ich im weiteren Verlauf eingehen.
1.5.1 Verzerrungen von Attribution durch fehlerhafte Wahrnehmung und
Informationsverarbeitung aufgrund begrenzter Kognitionsfähigkeit des Menschen
1.5.1.1 Der fundamentale Attributionsfehler
Wissenschaftler haben in diesem Zusammenhang den Begriff des fundamentalen Attributionsfehlers eingeführt. Er bezeichnet den Effekt, dass bei der Attribution internale Ursachen gegenüber externalen bevorzugt werden, auch wenn offensichtlich die Umweltfaktoren das Verhalten eines Akteurs dominieren.
Ein Grund für diesen Effekt ist verzerrte Wahrnehmung und Informationsverarbeitung beim Beobachter: Das Verhalten des Akteurs ist eher salient, also auffällig, als die umgebende Situation, so dass die kausale Bedeutung der Person überschätzt, die der Situation unterschätzt wird. Es kommt zu einer fehlerhaften Ursachenzuschreibung. Eine zweite Erklärung des Effekts kann in der gesellschaftlichen Norm gefunden werden: Internale Attributionen werden in unserer Gesellschaft als vorteilhafter beurteilt und es scheint, dass ein Mensch gegenüber einer Situation als Verursacher eines Ereignisses die einfachere und zufriedenstellendere Erklärung ist.
1.5.1.2 Die Akteur-Beobachter-Verzerrung
Eine zweite Attribuierungstendenz ist die Akteur-Beobachter-Verzerrung. Sie besagt, dass Handelnde ihr Verhalten eher auf externale, die Situation bedingende Ursachen zurückführen, während der Beobachter der gleichen Situation dazu neigt, das Verhalten auf stabile innere Faktoren der Person zu attribuieren. Wie auch schon beim fundamentalen Attributionsfehler liegt eine Erklärung für den Effekt in der Wahrnehmung. Wissenschaftler haben experimentell nachgewiesen, dass die Salienz einer Person die Attribution auf innere Dispositionen beeinflusst. Ist sie wahrnehmungsmäßig besonders auffällig im Vergleich zu anderen, beispielsweise weil sie sich im Blickfeld des Beobachters befindet, wird sie von ihm als kausal wichtiger beurteilt und ihr internale Verhaltensursachen zugeschrieben.
1.5.1.3 Verzerrung kontra Konsens-Information
Weitere Verzerrungen entstehen durch die Unterschätzung des Konsens, welcher eine Aussage darüber macht, wie sich andere Personen in der gegebenen Situation verhalten würden. Obwohl diese wichtige Information nach Kelley mit in den Attributionsprozess einfließen sollte, wird sie nachweislich häufig ignoriert, wenn spezifisch auf das Verhalten der Person bezogene Informationen zur Beurteilung vorliegen. Dann ist die Wahrnehmung auf die Person fixiert und statistische Daten werden im Verarbeitungsprozess abgewertet bzw. ignoriert. Der Attributionsprozess unterliegt wiederum einer Verzerrung zugunsten innerer Dispositionen.
1.5.1.4 Verzerrung durch falschen Konsens
Die Konsensinformation wird vom Beobachter nicht in jedem Fall ignoriert. Wird sie jedoch herangezogen, so kann wieder ein Verzerrungseffekt der Effekt des falschen Konsens, eintreten. Er beruht auf der Annahme des Beobachters, dass die eigenen Einstellungen, Werte und Überzeugungen von der Mehrheit der Menschen geteilt würden, und somit den Konsens bildeten. So unterläuft dem Beobachter der Irrtum, dass er mit Hilfe des scheinbaren Konsens zu einem objektiven Urteil finden kann.
1.5.1.5 Verzerrung zugunsten von Kausalität
Auch eine Verzerrung der Attribution zugunsten von Kausalität kann auftreten: Der Mensch besitzt eine ausgeprägte Tendenz in kausalen Zusammenhängen zu denken. Ein Beobachter neigt dazu, selbst dann Kausalität, Regelhaftigkeit oder Intentionalität bei einer Handlung wahrzunehmen, wenn überhaupt gar keine Beweise für diese Annahmen vorliegen. Eine Erklärung liefert ein Gestaltmodell sozialer Wahrnehmung8. Das Gesetz der Geschlossenheit besagt, dass Menschen die Tendenz besitzen, unvollständige Figuren als vollständig zu sehen. Bezogen auf Attribution bedeutet dies, dass wir unsere Umwelt, selbst wenn nur Bruchstücke von Informationen über sie vorliegen, als kohärentes und bedeutungsvolles Muster wahrnehmen und Ursachen zuschreiben, die in Wirklichkeit für das Handeln der Person nicht relevant sind.
1.5.2 Motivational bedingte Verzerrungen
Die bereits dargestellten Verzerrungen von Attributionen sind auf fehlerhafte Wahrnehmung und Informationsverarbeitung aufgrund begrenzter Kognitionsfähigkeit des Menschen zurückzuführen.
Daneben gibt es motivational bedingte Verzerrungen. Der Beobachter unterliegt beispielsweise der Motivation, mit Hilfe von bestimmten Ursachenzuschreibungen, Vorwürfen aus dem Weg zu gehen oder gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Auch schreibt er sich selbst eher Ursachen für Erfolge zu, Umwelteinflüssen eher die Ursachen für Misserfolge. Solche selbstwertdienlichen Verzerrungen helfen, ein konsistentes und positives Selbstbild aufrechtzuerhalten, nach welchem jedes Individuum strebt. Sie treten auf, obwohl die wahren Ursachen übersehen oder vernachlässigt werden und führen somit zu verzerrter Attribution.
1.6 Der Attributionsprozess beim Richter
Bisher habe ich mich mit den theoretischen Aspekten des Attributionsprozesses befasst; im folgenden Kapitel werde ich mich mit Ursachenzuschreibung am Beispiel der richterlichen Urteilsfindung auseinandersetzen.
Ziel des Richters ist es, im Laufe der Verhandlung die Schuld des Angeklagten zu bewerten und ihn gemäß dieser Einschätzung zu bestrafen. Dazu muss er sich selbst die Frage beantworten, warum der Angeklagte das delinquente (straffällige) Verhalten gezeigt hat und welche Ursachen letztendlich dafür ausschlaggebend waren. Aus psychologischer Sicht bedeutet dies, dem Angeklagten Verantwortung und Schuldfähigkeit für die ihm vorgeworfenen Straftat zu attribuieren!
1.6.1 Das Attributionsmodell im Strafrecht
Zunächst werde ich auf das dreidimensionales Attributionsmodell nach Weiner9 eingehen, welches den Prozess der Kausalattribution im Strafrecht veranschaulicht. Es korrespondiert weitgehend mit Kelleys allgemeinen Modellvorstellungen und unterscheidet ebenfalls drei Dimensionen, die von Personen zur Erklärung von Ursachen herangezogen werden: (1) Lokation (intern / extern) - Sind die Ursachen der Tat innere, personenbedingte Faktoren, wie Stimmungslage oder Hormonspiegel? Oder wurde die Tat durch äußere Einflüsse, wie eine akute Notlage oder frühe Etikettierung ausgelöst? (2) Stabilität (stabil / variabel) - Sind das Verhalten des Angeklagten und die Ursachen dafür über einen längeren Zeitraum hinweg unverändert, oder traten sie einmalig auf? Als Beispiel für stabile Faktoren lassen sich schlechter gesellschaftlicher Umgang oder genetische Veranlagung anführen. Variable Faktoren können momentane Stimmungslagen oder Arbeitslosigkeit sein. (3)
Kontrollierbarkeit - Sind diese Faktoren vom Täter kontrollierbar? Der Täter hat keinen
Einfluss auf sein Genom, jedoch auf Faktoren wie schlechten Umgang oder Schulden..
Tabelle 1: Dreidimensionale Taxonomie kriminalitätserklärender Faktoren10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.6.2 Einflüsse der drei Dimensionen auf die Attribution von Schuldfähigkeit
Der Richter wird gemäß dieser Überlegungen dem Angeklagten ein unterschiedliches Maß an Verantwortung und persönlicher Schuld für die Tat zuschreiben. Zwei Beispiele richterlicher Attribution: sind: (1) Schätzt er die Auslöser der Tat als internale, kontrollierbare und gleichzeitig stabile Faktoren ein, so handelt der Täter in seinen Augen absichtlich und obwohl die Situation für ihn kontrollierbar war. Der Richter wird innere Dispositionen und eine dauernd existierende, stabile Veranlagung zum delinquenten Verhalten attribuieren. Nachweislich wird mit zunehmender Stabilität der Faktoren die vom Täter ausgehende Bedrohung und das Rückfallrisiko höher eingeschätzt. Auch die Art und Bemessung der Strafe fällt härter aus. (2) Der Richter sieht die Ursachen in externen, variablen und unkontrollierbaren Faktoren. In diesem Fall wird das Strafmaß weit geringer ausfallen, für den Richter ist nicht der Täter persönlich Ursache für das Verbrechen, sondern Umwelteinflüsse, die nicht vom Täter selbst beeinflusst werden konnten und anscheinend auch nur ein einmaliges Verhalten hervorgerufen haben.
1.7 Wahrnehmungsverzerrung beim Richter
Die Voraussetzung, dass eine Information vom Richter zur Ursachenzuschreibung überhaupt herangezogen werden kann, ist ihre Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung. Deshalb werde ich mich zunächst mit diesen Aspekten auseinandersetzen und darauf aufbauend eine Verknüpfung zu Attributionsverzerrungen beim Richter herstellen.
1.7.1 Hypotheseneffekt: Der vorinformierte Richter
Voraussetzung für das in Deutschland realisierte sog. inquisitorische Strafverfahrenssystem ist ein möglichst umfassend informierter und selbständiger Richter. Folglich verlangt es vom Richter schon im Vorfeld der Hauptverhandlung eine ausführliche Studie der Akten. Dieses gesetzlich festgelegte Prinzip jedoch birgt einen urteilsverzerrenden Effekt: die Bildung einer vorgefertigten, subjektiven Schuldhypothese aufgrund des Aktenstudiums. Diese verfälscht im weiteren Verlauf der Verhandlung die Informationsverarbeitung und Attributionsprozesse des Richters.11
Schünemann (1983)12 untersuchte, wie eine ausgeprägte Schuldüberzeugung die Verarbeitung nachfolgender Fallinformationen und die Beurteilung des Angeklagten beeinflusst. Seine Versuchspersonen (Vpn) waren 37 Berufsrichter. Ihre Aufgabe bestand darin, das Urteil in einem authentischen Straffall zu finden, in dem die Schuldfrage des Angeklagten bisher ungeklärt geblieben war. Der Wissenschaftler teilte die Vpn in zwei Gruppen auf: Gruppe A, die Experimentalgruppe, erhielt eine Strafakte, die vor allem belastendes Material enthielt; Gruppe B hingegen eine Akte mit sowohl be-, als auch entlastendem Material. Anschließend erhielten alle Vpn auch die schriftlichen Informationen, die während der Hauptverhandlung gesammelt worden waren.. So wurde gewährleistet, dass sich die Richter aus beiden Gruppen abschließend etwa auf dem gleichen Informationsniveau befanden. Trotzdem erklärten 82 % der Richter aus Gruppe A, aber nur 47% der Richter aus Gruppe B den Angeklagten für schuldig. Schünemanns Untersuchung bestätigt damit deutlich den Hypotheseneffekt auf Grund vorgefasster Schuldüberzeugung des Richters und deren Einfluss auf das Urteil.
1.7.2 Hypothesenkonforme Wahrnehmung und Vermeidung kognitiver Dissonanz
Als Konsequenz aus dem Hypotheseneffekt lassen sich Verzerrungen der weiteren Wahrnehmung und Verarbeitung von relevanten Informationen ableiten: Der Richter unterliegt dem Effekt der Urteilsperseveranz, d.h., er wird im Laufe des Verfahrens versuchen, seine einmal gefasste Meinung beizubehalten. Diese Motivation lässt sich aus psychologischer Perspektive mit Hilfe der Theorie Kognitiver Dissonanz (Festinger, Irle)13 erklären. Wenn der Richter mit Informationen und Kognitionen während der Verhandlung konfrontiert wird, die im Widerspruch zu seiner subjektiven Hypothese stehen, empfindet er kognitive Dissonanz. Jedes Individuum strebt nach Reduktion dieses aversiven, konflikthaften Gefühls. Dem Richter gelingt dies durch Anpassung der neuen Informationen und Kognitionen an die eigene Meinung, indem er Fallinformationen selektiv verarbeitet: Er nimmt nur hypothesenkonforme Informationen wahr und ruft auch nur diese wieder ab oder fügt selbst konsonante Kognitionen hinzu, so dass seine Hypothese bestätigt wird.
Es ist durchaus möglich, dass er nicht-hypothesenkonforme Informationen wahrnimmt. Diese werden jedoch im Laufe des Verarbeitungsprozesses als nicht relevant für die Beurteilung des Falles eingeschätzt oder verdrängt, so dass sie das Urteil nicht beeinflussen. Dies wird als Inertia-Effekt bezeichnet14.
1.8 Verzerrung der richterlichen Attribution
Die Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen stellt die Voraussetzung für den Attributionsprozess dar; die beschriebenen Fehler wirken sich also auch auf richterliche Attributionen aus. Im folgenden Abschnitt gehe ich auf Attributionsverzerrungen ein, die einmal durch eben diese Wahrnehmungsfehler, zum zweiten jedoch durch Attributionsfehler selbst entstehen.
1.8.1 Sozialkategorie des Angeklagten
Die Personenwahrnehmung beeinflusst die Entscheidung des Richters, die Ursachen der Tat entweder in internalen oder externalen Faktoren festzulegen. Diese Entscheidung wiederum beeinflusst das vom Richter gegebene Urteil und somit auch das Strafmaß. Peters (1970, 1973)15 führte eine Untersuchung durch, in der sie durch systematische Beobachtung von Gerichtsverfahren nachwies, dass die Sozialkategorie des Angeklagten ein Aspekt ist, der den Attributionsprozess beeinflusst. Lebte der Angeklagte in geregelten Verhältnissen, wurden variable, unkontrollierbare und externale Faktoren als Ursachen der Tat zugeschrieben und ein vergleichsweise niedriges Strafmaß verhängt. Anders verhielt es sich bei Angeklagten, die in offensichtlich ungünstigen sozialen Milieus lebten. Ihrem Handeln wurden tendenziell stabile, internale und kontrollierbare Ursachen zugeschrieben. Häufig wurden solche Angeklagten vom Richter als Gewohnheitsverbrecher typisiert. Ugwuegbu (1979) belegte, ,,dass ein Angeklagter von Geschworenen eher als schuldig eines Strafbestandes angesehen wird, wenn er eine schwarze Hautfarbe hat." 16 Obwohl von Richtern ein möglichst objektives und unparteiisches Urteil gefordert wird, zeigt seine Untersuchung, dass sogar ihr Attributionsprozess durch verinnerlichte Vorurteile, eigene Wertvorstellungen und Schemata beeinflusst werden kann.
Verstärkt wird dieser Effekt der Attributionsverzerrung durch selektive Wahrnehmung im Sinne des Hypotheseneffekts: Beispielsweise nimmt der Richter vorherrschend hypothesenkonforme Aspekte, wie geringe Attraktivität, Hautfarbe oder andere soziale Merkmale wahr, wenn er von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist.
1.8.2 Fundamentaler Attributionsfehler und Akteur-Beobachter-Verzerrung
Der fundamentale Attributionsfehler (siehe 2.2.1.1) unterläuft dem Richter aus zwei Gründen:
(1) Wahrnehmung: Der Richter nimmt den Angeklagten bedingt durch die Sitzordnung im Gerichtssaal als salient wahr. In einer Untersuchung zum Effekt der Akteur-Beobachter- Verzerrung17 wurden die Auswirkungen von verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven des Akteurs auf den Beobachter überprüft. Ergebnis war, dass Blickkontakt, den der Richter zum Angeklagten pflegt, zu erhöhter Attribution auf die Person führt. Außerdem ist der Angeklagte durch seine Anwesenheit Zentrum der richterlichen Wahrnehmung. Der Tathergang und mögliche Umwelteinflüsse auf den Angeklagten jedoch können nicht aktiv vom Richter wahrgenommen werden, sondern nur mit Hilfe von Protokollen und Zeugenaussagen rekonstruiert werden. Gemäß dieser Wahrnehmungsverzerrung wird die kausale Bedeutung des Angeklagten für den Fall gegenüber umweltbedingten Einflüssen als höher eingeschätzt, was zum fundamentalen Attributionsfehler führt. (2) Auch der Richter unterliegt unbewusst Einflüssen gesellschaftlicher Vorstellungen und Normen. Jellison und Green (1981)18 wiesen nach, dass ,, interne Attributionen [von Außenstehenden] vorteilhafter beurteilt werden als externe." Somit wird der fundamentale Attributionsfehler ebenfalls begünstigt.
1.8.3 Vernachlässigung von Konsensinformation; Konsensüberschätzung
Kelleys Attributionsmodell zeigt die zentrale Bedeutung des Konsens in Bezug auf personenbedingte Ursachenzuschreibung. Es lassen sich zwei Gründe aufführen, dass auch der Richter den Konsens häufig vernachlässigt.: (1) Kahnemann und Tversky (1973) formulierten, dass wir ,,von den konkreten Verhaltensdetails unseres Gegenübers so gefesselt zu sein scheinen, dass wir statistische Häufigkeiten darüber vergessen." 19 Weiterführend zeigten Feldman et al. (1976) in einem Experiment, dass die Vpn nur dann Konsensinformationen zur Beurteilung eines Sachverhalts hinzuzogen, wenn ihnen ,,lebendigere Informationen", hier in Form von Videoaufzeichnungen, nicht zur Verfügung standen. Im anderen Fall, in dem sie die Videoaufnahmen gesehen hatten, urteilten sie konkret auf das Verhalten des Akteurs bezogen und ignorierten den Konsens vollständig.20 Dies ist auf die Situation des Richters übertragbar, der den Angeklagten als lebendige Information wahrnimmt und deshalb die Bedeutung des Konsens unbewusst abwertet. Als Konsequenz daraus unterläuft dem Richter wiederum verstärkt die Attributionsverzerrung, auf
Dispositionen und internale Faktoren zu attribuieren. (2) Steht der Konsens im Widerspruch zur Schuldhypothese des Richters und erlebt dieser einen Zustand kognitiver Dissonanz, so wertet der Richter die Informationen ab und bezieht sie nicht in den Attributionsprozess mit ein.
In diesem Zusammenhang lässt sich der Effekt der Konsensüberschätzung anführen: Der Richter glaubt, seine persönliche Schuldhypothese bilde den Konsens, und vermeidet so das Gefühl kognitiver Dissonanz. Der fatale Irrtum, sein Urteil beruhe auf allgemeingültigen Annahmen und nicht auf persönlichen Ansichten, führt zu weiteren Verzerrungen.
1.8.4 Kovariation: Verzerrung zugunsten von Kausalität
Das Kovariationsprinzip, welches bereits im Zusammenhang mit Kelleys multidimensionalen Attributionsmodell beschrieben wurde, ist ebenfalls von Wichtigkeit, um Attributionsverzerrungen beim Richter zu erklären. Es besagt, dass ,,ein Effekt [...] auf eine Bedingung attribuiert [wird], die besteht, wenn der Effekt besteht, und die fehlt, wenn der Effekt fehlt." 21 Die Gefahr liegt aber darin, dass der Richter eine Korrelation von zwei Faktoren beobachtet und auf Grund des Kovariationsprinzips dazu neigt, ebenfalls Kausalität festzustellen. Eine Korrelation zweier Effekte ist jedoch nicht immer mit Kausalität zu begründen. Dieser Irrtum führt zur Herstellung falscher Kausalitätsbeziehungen und im Endeffekt zu einem verfälschten Urteil.
1.8.5 Konfiguration: Verzerrung aufgrund von Schemata
Falls dem Richter generell wenig Informationen über den Sachverhalt vorliegen, oder er wichtige Aspekte nicht wahrnimmt, weil sie im Widerspruch zu seiner Schuldhypothese stehen, unterliegen seine Attributionen dem Effekt der Konfiguration. Er attribuiert auf Grundlage von Einzelbeobachtungen, kausalen Schemata, Vorurteilen und Heuristiken (Alltagserklärungen). Deshalb ist der Richter besonders bei der Konfiguration der Gefahr ausgesetzt, stereotyp, subjektiv und verzerrt zu urteilen.
1.8.6 Weitere Faktoren der Beeinflussung
In meiner Arbeit habe ich gezeigt, welche attributionstheoretischen Aspekte letztendlich dazu führen, dass der Richter (a) zu seinem Urteil findet und (b) durch welche Einflüsse dieses Urteil besonders in negativer Hinsicht, d.h. zum Nachteil des Angeklagten, verzerrt wird. Meine Ausführungen enthalten nicht alle Faktoren, die einen Richter in seiner Urteilsfindung beeinflussen: Beispielsweise müssen Aspekte wie richterliches Pflichtbewusstsein, Rollenerwartungen, sowie persönliche Aspekte und Ziele der Bestrafung miteinfließen. Die Kommunikation und Interaktion im Gerichtssaal beeinflusst ebenfalls das Urteil, beispielsweise bei der Frage nach der Glaubwürdigkeit von Angeklagtem und Zeugen. Es lassen sich deshalb viele weitere Bereiche sowohl gesetzlicher als auch kognitiver Art finden, in denen der Richter unbewusst beeinflusst wird. Meine Arbeit legt jedoch bewusst den Schwerpunkt auf Attributionen, denn dieser Aspekt erscheint mir am signifikantesten in Bezug darauf, dass der Richter nicht rein normativ urteilen, sondern durchaus seine kognitiven Prozesse eine wichtige Rolle bei der Urteilsfindung spielen.
SCHLUSSTEIL
1.9 Was denkt unsere fiktive Richterin jetzt?
,,Ich hatte also Recht mit meiner Vermutung: Ich als Mensch und als Richterin bin nicht nur den gesetzlichen Normen, sondern komplizierten kognitiven Prozessen unterlegen, wenn ich täglich versuche, zu einem gerechten Urteil zu finden. Diese neue Perspektive beantwortet zwar viele meiner Fragen und hilft mir, mein Verhalten in bestimmten Situationen zu verstehen; sie lässt mich jedoch auch erneut anzweifeln, ob meine Rechtssprechung überhaupt Gültigkeit besitzt.
Ich persönlich habe bezüglich meiner Wahrnehmungs- und Beurteilungsfähigkeit von anderen Personen, insbesondere des Angeklagten, hinzugelernt. Das Wissen um meine eigenen Fehler wird mir hoffentlich in Zukunft helfen, sie selbst frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Nur hier sehe ich die Möglichkeit, die angeführten Verzerrungsprozesse durch bewusstere Einstellung und Wahrnehmung auszuschalten. Ich kann schließlich nicht unser deutsches Rechtssystem reformieren. Um mein Urteil wirklichkeitsnaher, gerechter und weniger verzerrt ausfallen zu lassen, muss ich bei meinen eigenen Kognitionen beginnen."
1.10 weiterführende Gedanken
Unsere Richterin hat also erkannt, worum es geht: Den größten verzerrenden Einfluss auf richterliche Urteilsfindung haben kognitive Prozesse, vor allem Attributionsprozesse. Psychologen, die dieses Problem untersuchten, haben Strategien zur Ausschaltung vieler Effekte ausgearbeitet. Abschließend möchte ich beispielhaft einige Techniken aufzeigen, die dem Richter helfen, sich in seinem Urteil weniger von kognitiven Verzerrungen beeinflussen zu lassen. Ein Training zur bewussteren Wahrnehmung und Informationsaufnahme wirkt nachweislich Verzerrungen im Bereich der Attribution entgegen22. Durch absichtliche Manipulation der Art und Weise, in der dem Richter Informationen präsentiert werden, kann der Hypotheseneffekt als beeinflussender Faktor bewusst wahrgenommen und ausgeschaltet werden.
Aber sicherlich ist die wichtigste und einfachste Methode, dem Richter eine Hilfe an die Hand zu geben, ihn, aus psychologischer Sicht betrachtet, über sich selbst und seine Rolle aufzuklären und ihn auf die verzerrenden Mechanismen aufmerksam zu machen.23
LITERATURVERZEICHNIS
Antaki,C. und Hewstone,M., Attributionstheorie und soziale Erklärung, in: Stroebe, Hewstone, Codol, Stephenson (Hrsg.), Sozialpsychologie - Eine Einführung, Berlin/ Heidelberg, 1990, S.112-136.
Forgas, J.P., Soziale Interaktion und Kommunikation, Weinheim 31995.
Haisch, Jochen, Psychologie der Gerichtsverhandlung und richterlichen Urteilsbildung, in: Lösel, Friedrich (Hrsg.), Kriminal-Psychologie: Grundlagen und Anwendungsbereiche, Weinheim/Basel, 1983, S.162-172.
Haisch, Jochen, Richterliche Urteilsbildung, in: Seitz, Willi (Hrsg.) , Kriminal- und
Rechtspsychologie: Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen, München/Wien/Baltimore,1983, S.178-182.
Oswald, Margit E., Richterliche Urteilsbildung, in: Steller, Max und Volbert, Renate (Hrsg.), Psychologie im Strafverfahren - Ein Handbuch, Bern/Göttingen/Toronto/Seattle,1997, S.248- 265.
[...]
[1] Vgl. Haisch (1983), S.178, in: Seitz
[2] Zimbardo (1988), S.569: ,, Sie sind Versuche gewöhnlicher Menschen, den inneren undäußeren Ereignissen, die sie wahrnehmen, Sinn zu verleihen. Dies bedeutet, dass sie nach Ursachen für Handlungen suchen, dass sie aus beobachtetem Verhalten auf innere Dispositionen [innere Veranlagung] schließen, und dass sie für die eigenen Handlungen und die anderer Menschen Zuschreibung von Verantwortung und Schuld vornehmen".
[3] Vgl. Forgas (1995), S.72f.
[4] Antaki und Hewstone (1990), S.114, in Stroebe, Hewstone, Codol, Stephenson.
[5] Vgl. Antaki und Hewstone (1990), S.114, in: Stroebe, Hewstone, Codol, Stephenson.
[6] Vgl. Antaki und Hewstone (1990), S.115, in: Stroebe, Hewstone, Codol, Stephenson.
[7] Forgas (1995), S.78
[8] Vgl. Forgas, S.38.
[9] vgl. Oswald (1997), S.257f.
[10] Tabelle: Oswald (1997), S.258.
[11] Vgl. Haisch (1983), S.169, in: Lösel
[12] Vgl. Oswald (1997),S. 252.
[13] Vgl. Haisch (1983), S. 163, in: Lösel
[14] Vgl. Haisch (1983), S. 166, in: Lösel
[15] Vgl. Haisch (1983), S.168 in: Lösel.
[16] Haisch (1983), S.179, in: Seitz.
[17] Vgl. Antaki und Hewstone, (1990), S.130, in: Stroebe, Hewstone, Codol, Stephenson.
[18] Vgl. Antaki und Hewstone,,(1990) S. 129, in: Stroebe, Hewstone, Codol, Stephenson.
[19] Forgas, S.87.
[20] Vgl. Forgas, S.87.
[21] Antaki,C. und Hewstone, M., S.116.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Das Thema der Facharbeit ist "Psychologie der Gerichtsverhandlung und richterlicher Urteilsfindung". Die Kernproblematik ist, wie ein Richter zu seinem Urteil findet.
Was sind Attributionen laut dieser Arbeit?
Attributionen sind Gegenstand unserer alltäglichen kognitiven Prozesse, denen wir unbewusst unterliegen. Jedes in sozialem Kontakt stehende Individuum versucht Erklärungen durch Ursachenzuschreibung zu finden.
Welche drei Theorieansätze der Attributionsforschung werden in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Heiders Anfänge, die Interferenztheorie nach Jones & Davis und das multidimensionale Attributionsmodell nach Kelley.
Welche Verzerrungen der Attribution werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Verzerrungen durch fehlerhafte Wahrnehmung und Informationsverarbeitung (fundamentaler Attributionsfehler, Akteur-Beobachter-Verzerrung, Vernachlässigung von Konsensinformation, falscher Konsens, Verzerrung zugunsten von Kausalität) und motivational bedingte Verzerrungen.
Wie beeinflusst der Hypotheseneffekt die richterliche Urteilsfindung?
Der Hypotheseneffekt beschreibt, wie eine vorgefertigte Schuldhypothese, die der Richter aufgrund des Aktenstudiums bildet, die Informationsverarbeitung und Attributionsprozesse im weiteren Verlauf der Verhandlung verfälscht.
Welche Rolle spielt die Sozialkategorie des Angeklagten bei der Urteilsfindung?
Die Sozialkategorie des Angeklagten (z.B. soziale Milieu, Hautfarbe) kann den Attributionsprozess beeinflussen, indem sie die Entscheidung des Richters, die Ursachen der Tat in internalen oder externalen Faktoren festzulegen, beeinflusst. Dies kann zu Vorurteilen und einer verzerrten Urteilsfindung führen.
Wie kann der fundamentale Attributionsfehler die richterliche Entscheidung beeinflussen?
Der Richter nimmt den Angeklagten als salient wahr und überschätzt die kausale Bedeutung der Person für den Fall gegenüber umweltbedingten Einflüssen, was zum fundamentalen Attributionsfehler führt. Er schreibt die Tat eher inneren Dispositionen zu als äußeren Umständen.
Was ist das dreidimensionale Attributionsmodell im Strafrecht?
Das dreidimensionale Attributionsmodell nach Weiner unterscheidet drei Dimensionen zur Erklärung von Ursachen im Strafrecht: Lokation (intern/extern), Stabilität (stabil/variabel) und Kontrollierbarkeit.
Welche Strategien gibt es, um kognitive Verzerrungen bei Richtern zu reduzieren?
Die Arbeit schlägt ein Training zur bewussteren Wahrnehmung und Informationsaufnahme, absichtliche Manipulation der Art und Weise, in der Informationen präsentiert werden, und Aufklärung der Richter über die verzerrenden Mechanismen vor.
- Quote paper
- Ann-Kathrin Bröckelmann (Author), 2001, Psychologie der Gerichtsverhandlung und richterlicher Urteilsfindung vor dem Hintergrund attributionstheoretischer Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101754