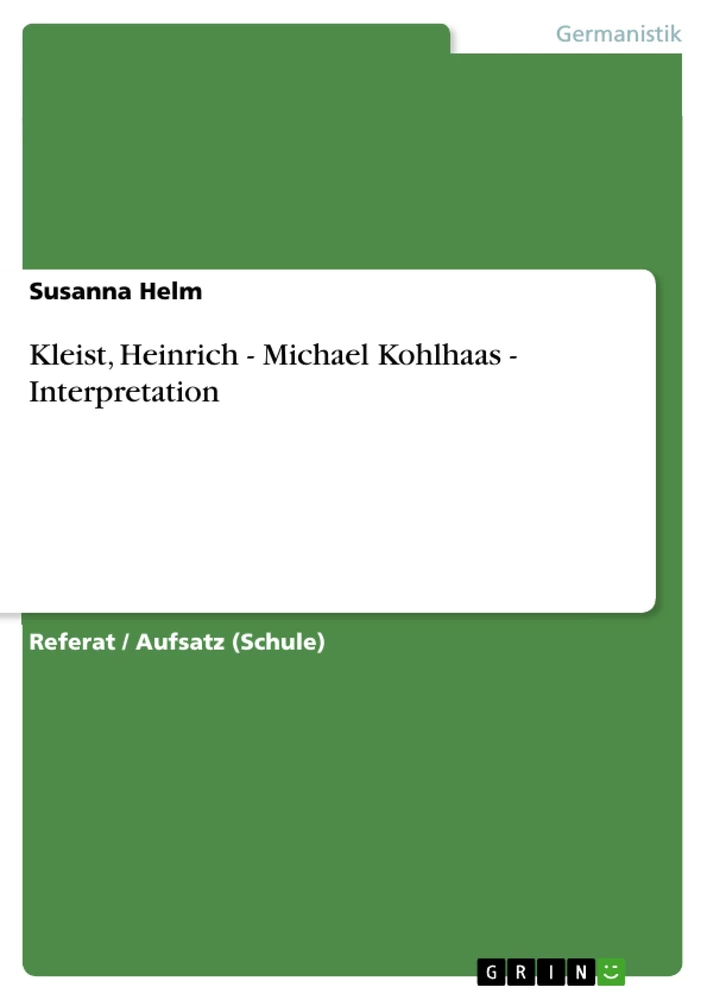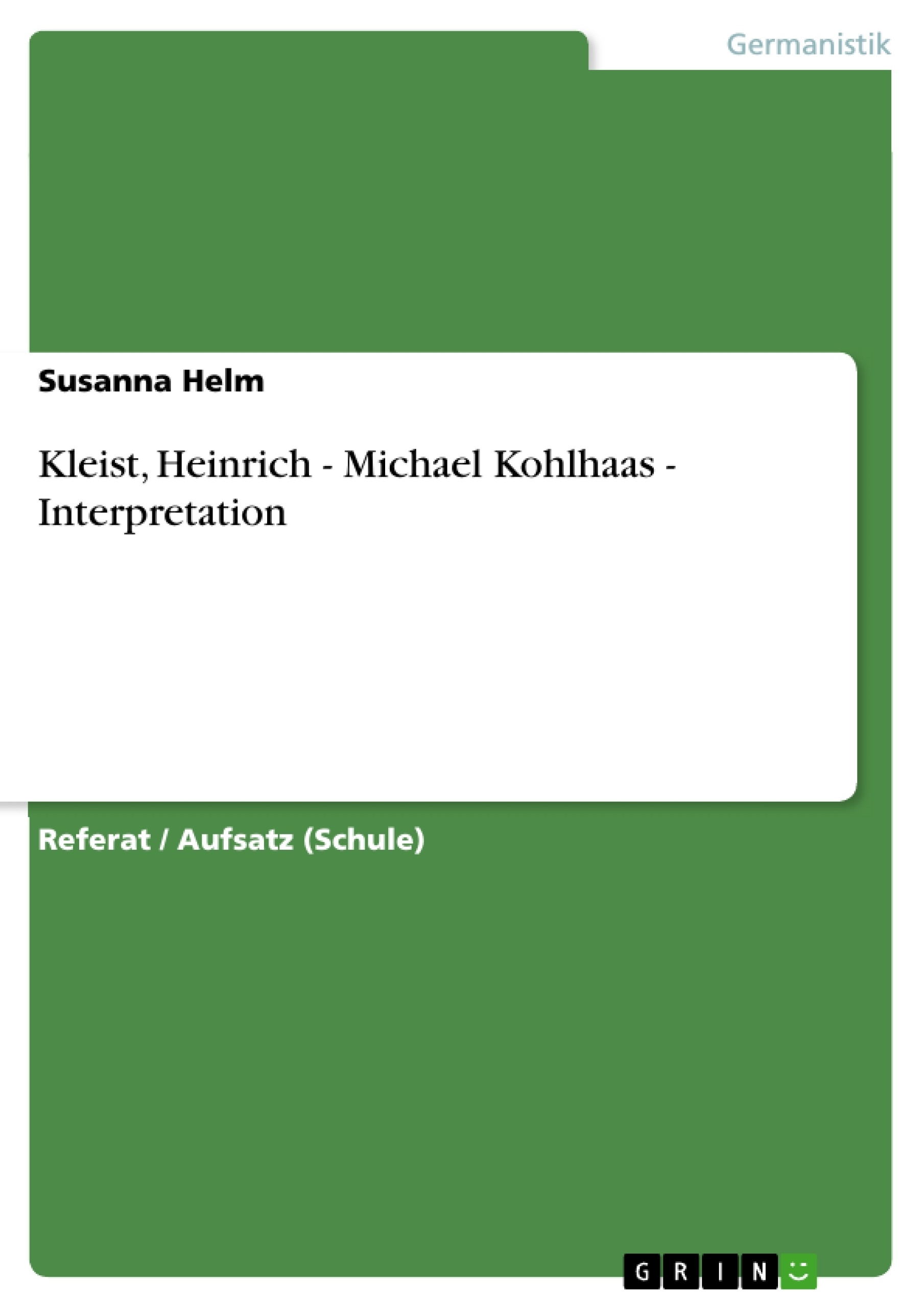Autor: Susanna Helm
Interpretation von Michael Kohlhaas
1. Einleitung
Autor: Heinrich Kleist Titel: Michael Kohlhaas Gattungsform: Novelle
Thema: Gerechtigkeit Zeit: Mitte des 16. Jhdt.
Raum: Potsdam, Sachsen, Wittberg, Leipzig, Dresden
2. Hauptteil
Produktionspoetik:
Zeitgeschichtlicher Hintergrund und biografische Gegebenheiten: Diese Novelle ist im Winter 1804/05 entstanden, in einer verhältnismäßig ruhigen Periode des Dichters, als er in Königsberg tätig war. Vollendet wurde das Werk für die Buchausgabe erst 1810, doch schon zwei Jahre vorher hatte Kleist Teile davon in seiner Zeitschrift "Phöbus" abgedruckt. Da diese Zeitschrift in Sachsen erschien, musste Kleist Teile des Werkes, die Sachsen stark angriffen, umschreiben. Er verlegte dabei das meiste der negativen Geschehnisse nach Brandenburg. Bei der späteren Buchausgabe in Brandenburg ging er nach dem gleichen Schema genau umgekehrt vor, indem er wieder Sachsen in den Mittelpunkt stellte. Teile der Novelle beruhen auf wahren Begebenheiten. Etwa im Jahre 1535 war ein Viehhändler namens Hans Kohlhaase mit seinem Vieh nach Sachsen unterwegs. In einer Schenke fiel er einigen Bauern auf, da er in Eile war. Die Bauern hielten ihn für einen Viehdieb, weil er in der Nacht weiterreiten wollte. Als ihn die Bauern zur Rede stellen wollten, zog Hans Kohlhaase sein Messer und bedrohte die Bauern. Deshalb nahmen ihm die Bauern die Pferde weg und verlangten, dass sie solange bei ihnen blieben, bis Kohlhaase genug Beweise gebracht hatte, dass die Pferde sein Eigentum wären. Als Hans Kohlhaase bei seiner Rückkehr erkannte, dass seine Pferde für die Feldarbeit benützt worden waren und er einen großen Betrag für die Fütterung bezahlen sollte, protestierte er bei verschiedenen Fürsten, die ihm jedoch nicht halfen. Als Rache plünderte er mehrere Orte und zündete sie an. Als er gefangen genommen und zum Tode verurteilt worden war, soll er auf dem Weg zu seiner Hinrichtung immer wieder gemurmelt haben: "Nunquam vidi iustum derelictum." - "Niemals habe ich einen Gerechten verlassen gesehen...
Werkpoetik:
Merkmale der Gattungsform: Novelle: Prosa-, selten auch Verserzählung von mittlerem Umfang, die sich durch straffe Handlungsführung, formale Geschlossenheit und thematische Konzentration auszeichnet. Gegenstand ist, nach einer Definition Johann Wolfgang von Goethes, "eine sich ereignete unerhörte Begebenheit", eine Begebenheit also, die einen gewissen Anspruch auf Wahrheit erhebt und von etwas Neuem oder Außergewöhnlichem erzählt. Als charakteristische Merkmale novellistischen Erzählens gelten, ohne jedoch normative Verbindlichkeit beanspruchen zu können, die Zuspitzung auf einen "Wendepunkt" hin (entsprechend der Peripetie im Drama) und die Strukturierung durch ein sprachliches Leitmotiv oder durch ein Dingsymbol (Paul Heyses "Falkentheorie"). Häufig werden Novellen zu Zyklen verbunden oder einzelne Novellen in Rahmenerzählungen eingebettet: Techniken, die es ermöglichen, die Erzählsituation sowie die jeweiligen zeitgeschichtlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge zu beleuchten.
Dies lässt sich auch recht einfach an dieser Novelle statuieren, da sich das ganze Buch um die ,,unerhörte Begebenheit" dreht, dass der Pferdehändler, dadurch weil ihm selbst Unrecht angetan wurde, zum Mörder wird. Dieses gesamte Buch geht, wie in drittens schon gesagt beruht auf die wahre Begebenheit mit Hans Kohlhaase
Gliederung: keine Kapitel, Abschnitte siehe unten
Aufbau der Handlung: Dieser gesamte Prosatext ,,Michael Kohlhaas" von Bernd Heinrich von Kleist lässt sich in 4 Abschnitte einteilen:
1. Abschnitt: (Seite 3 - Seite 28)
- Kohlhaas als Muster eines guten Staatsbürgers
- das Unrecht durch den Junker von Tronka
- das Unrecht durch die Gerichte
2. Abschnitt: (Seite 29 - Seite 54)
- Kohlhaas als ,,Outlaw"
- Kohlhaasens Rachefeldzug
- Eingreifen Luthers
3. Abschnitt (Seite 54 - Seite 80)
- Kohlhaas in Dresden
- Hoffnung auf einen guten Ausgang
- Abdeckerszene
- Bruch der Amnestie
- Todesurteil
4. Abschnitt: (Seite 80 - 100)
- Kohlhaas in Berlin
- Eingreifen des Fürsten von Brandenburg
- Amulett und Zigeunerin
- Bemühungen Kurfürsten von Sachsen um Zettel
- Hinrichtung
Die im Werk dargestellte Welt:
Personen: Die Hauptpersonen sind der Rosshändler Michael Kohlhaas, der Burgvogt und der Junker.
Ablauf des Geschehens / Handlungsschritte: Michael Kohlhaas ist die ersten 30 Lebensjahre ein vollkommen ehrlicher Mensch. Erst als ein Burgvogt ihn auffordert, einen Passschein vorzuzeigen, welchen er bis jetzt noch nie benötigt hatte ändert sich das. Der Rosshändler stellt nämlich fest, dass das alles nur erfunden gewesen ist und dass die Pferde und der Knecht, die er als Pfand hatte hinterlassen müssen, sehr schlecht behandelt und der Knecht sogar vertrieben worden war. Daraufhin schwört er ewige Rache. Auch seine Frau, die noch im Sterbebette darum bitte, dass er dem Burgvogt und dem Junker vergibt, kann nichts ändern. Er brennt zuerst das Schloss nieder und dann dreimal die Stadt, in der sich die beiden versteckten. Schließlich wird Kohlhaas gefasst und wird zum Tode verurteilt.
Sinngehalt des Textes: Dadurch, dass ihm selbst immer Unrecht getan wird, wird der Rosshändler Kohlhaas selbst zum Mörder, obwohl seine Frau versucht, ihn davon abzuhalten. Schließlich wird er gefasst und hingerichtet, und das nur aus dem soeben genannten Grund, nämlich, das er sich rächen will.
Sprache: Es ist, wenn man zuvor noch keine Werke Kleists gelesen hat, eine sehr komplizierte Sprache, da der Autor zum Beispiel manchmal bei direkten Reden Anführungszeichen setzt und manchmal nicht. Auch verwendet er ziemlich viele Ausdrücke, die heute nicht mehr im Gebrauch stehen.
In der Absicht dokumentarisch genau zu erzählen, greift Kleist oft zu verkürzten Sätzen. Er bevorzugt Latinismen, d. h. lateinische Ausdrücke, wie sie alte Chronisten und Juristen brauchen. So treten sehr häufig Partizipialsätze aller Art und eine ungewöhnliche Häufung von Nebensätzen auf, so dass schon diese beiden Besonderheiten eine eigene Interpunktion, mit viel Kommas, notwendig machen. Die verschiedensten Satzteile werden aneinandergereiht und miteinander verknüpft, der einzelne Satz bringt eine Fülle von Aussagen. Diese Häufung von Nebensätzen ist sehr verwirrend und man muss ein relativ großes Maß an Denkvermögen mitbringen um sich in diesen Buch zurechtzufinden und alles genau zu verstehen. Sprachliche Mittel und Satzbau: Kleist verwendet direkte Reden und Dialoge und wendet auch den Gedankenbericht an, wörtliche Rede eingebunden im Gefüge des gesamten Satzes, Nebensätze mit ständigen Unterbrechungen durch nähere Erläuterungen
Bilder und Symbole: Das Amulett der Zigeunerin: Als Kohlhaas unter Bewachung des brandenburgischen Ritters von Malzahn unterwegs war, traf es sich zufällig, dass er infolge einer Verzögerung, die durch die Erkrankung eines seiner Kinder verursacht war, in eine Gegend geriet, in der vom sächsischen Hof eine Jagd abgehalten wurde. Auf Veranlassung der Dame Heloise, die neugierig war, den ,,wunderlichen" Mann zu sehen, begab sich der Kurfürst mit ihr heimlich und unerkannt in die Meierei, in der Kohlhaas übernachtete. Da entdeckte der Kurfürst, dass Kohlhaas ein Amulett in einer Kapsel trug, von dem er erzählte, dass es unter geheimnisvollen Umständen in seinen Besitz gekommen sei und einen Zettel enthielte, der äußerst wichtige Nachrichten über die Zukunft des Herrscherhauses Sachsen enthielt.
Rezeptionspoetik:
Umstände der Veröffentlichung: Der Krieg: 1792 tritt Kleist in Potsdam ins Militär ein, hält jedoch nicht viel von der nur dem Staat dienenden und das Individuum vernachlässigenden Institution. Sein Abschied vom Militärdienst und die schnelle Aufgabe des anschließend aufgenommenen Studiums (Musik, Philosophie, Mathematik und Staatswissenschaften) führten im Verein mit der Problematisierung seines rationalistischen Weltbildes zur "Kantkrise". Sie markierten einen entscheidenden Wendepunkt in seinem Dasein, das fortan von unruhigem Oszillieren zwischen gegensätzlichen Polen geprägt war: familiären Ansprüchen und persönlichen Neigungen, dem Zwang zur Daseinsvorsorge und dem Wunsch nach freiem Ausleben seiner poet. Neigung, der Sehnsucht nach Partnerschaft und einer aus Selbstzweifeln genährten Bindungsunfähigkeit. So zieht Kleist 1802 in die Schweiz und trägt die Absicht, einen alten Bauernhof zu erwerben um auf dem Land sein Glück zu finden. Doch schon 1803 tritt Kleist wieder in die Armee ein, diesmal auf der Seite des ihm angeblich verhassten Napoleons, um den Tod zu finden. Die Novelle "Michael Kohlhaas" erscheint im Winter 1804/05. 1806 ist Kleist bei sehr schlechtem gesundheitlichem Zustand, mit der es allerdings nie so furchtbar stand, wie er glaubte.
Medium: Buch/Reclamtext
Rezipientenkreis: Dieser Text hat keine festgelegte Zielgruppe, denn Korruption und Ungerechtigkeit geht uns alles etwas an.
Persönliche Auseinandersetzung: Für mich war der Text schwer zu lesen, da der Autor viel mit der indirekten Rede arbeitet und man das nur schwer versteht. Ich bezweifle auf keinen Fall die Wichtigkeit des Werkes mit all dem was es in der Bevölkerung vielleicht hervorgerufen hat, aber mein Fall war es nicht. Aber wie gesagt Korruption ist ein Thema das uns alles etwas angeht und das uns früher oder später vielleicht wiederfahren wird.
3. Schluss
Häufig gestellte Fragen zu Michael Kohlhaas
Worum geht es in der Novelle "Michael Kohlhaas"?
Die Novelle "Michael Kohlhaas" von Heinrich Kleist thematisiert Gerechtigkeit, Rache und die Folgen von erlittenem Unrecht. Sie erzählt die Geschichte des Pferdehändlers Michael Kohlhaas, der durch einen Junker Unrecht erfährt und daraufhin zum Rächer und Mörder wird, um seine vermeintliche Gerechtigkeit durchzusetzen.
Wer ist der Autor von "Michael Kohlhaas"?
Der Autor von "Michael Kohlhaas" ist Heinrich von Kleist.
Wann und wo spielt die Geschichte von "Michael Kohlhaas"?
Die Geschichte spielt Mitte des 16. Jahrhunderts in Potsdam, Sachsen, Wittberg, Leipzig und Dresden.
Was sind die Hauptthemen der Novelle "Michael Kohlhaas"?
Die Hauptthemen sind Gerechtigkeitsempfinden, Rache, Recht und Unrecht, sowie die Frage, wie ein Mensch auf erlittenes Unrecht reagiert und ob Gewalt ein legitimes Mittel zur Durchsetzung von Gerechtigkeit ist.
Was ist die Produktionspoetik der Novelle?
Die Novelle entstand im Winter 1804/05 und wurde für die Buchausgabe 1810 vollendet. Kleist musste Teile des Werkes aufgrund der Veröffentlichung in Sachsen umschreiben. Die Novelle basiert teilweise auf wahren Begebenheiten um einen Viehhändler namens Hans Kohlhaase aus dem 16. Jahrhundert.
Welche Merkmale der Gattungsform Novelle weist "Michael Kohlhaas" auf?
"Michael Kohlhaas" ist eine Prosaerzählung mittleren Umfangs mit straffer Handlungsführung, formaler Geschlossenheit und thematischer Konzentration. Die Geschichte dreht sich um eine "unerhörte Begebenheit", nämlich die Wandlung eines rechtschaffenen Bürgers zum Mörder aufgrund von erlittenem Unrecht.
Wie ist die Handlung von "Michael Kohlhaas" aufgebaut?
Die Handlung lässt sich in vier Abschnitte einteilen: 1. Kohlhaas als Musterbürger und das erlittene Unrecht, 2. Kohlhaas als "Outlaw" und sein Rachefeldzug, 3. Kohlhaas in Dresden und der Bruch der Amnestie, 4. Kohlhaas in Berlin, das Amulett und die Hinrichtung.
Wer sind die wichtigsten Personen in "Michael Kohlhaas"?
Die Hauptpersonen sind Michael Kohlhaas, der Junker von Tronka und der Burgvogt.
Was ist der Sinngehalt des Textes?
Der Sinngehalt liegt darin, zu zeigen, wie erlittenes Unrecht einen Menschen verändern kann und wie der Wunsch nach Rache zu Gewalt und letztendlich zum eigenen Untergang führen kann.
Was ist das Amulett der Zigeunerin und welche Bedeutung hat es?
Das Amulett enthält einen Zettel mit wichtigen Nachrichten über die Zukunft des Herrscherhauses Sachsen. Es symbolisiert Schicksal und Vorhersehung und spielt eine wichtige Rolle im Konflikt zwischen Kohlhaas und dem Kurfürsten von Sachsen.
Was ist die Bedeutung des Textes "Michael Kohlhaas"?
Der Text soll verdeutlichen, wie sich erlittenes Unrecht auf einen Menschen auswirken kann. Ein ehrlicher Mensch kann sich durch Rache zum Mörder wandeln. Er zeigt die universelle Sehnsucht nach Gerechtigkeit und die zerstörerische Kraft von Rache.
- Citar trabajo
- Susanna Helm (Autor), 2001, Kleist, Heinrich - Michael Kohlhaas - Interpretation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101750