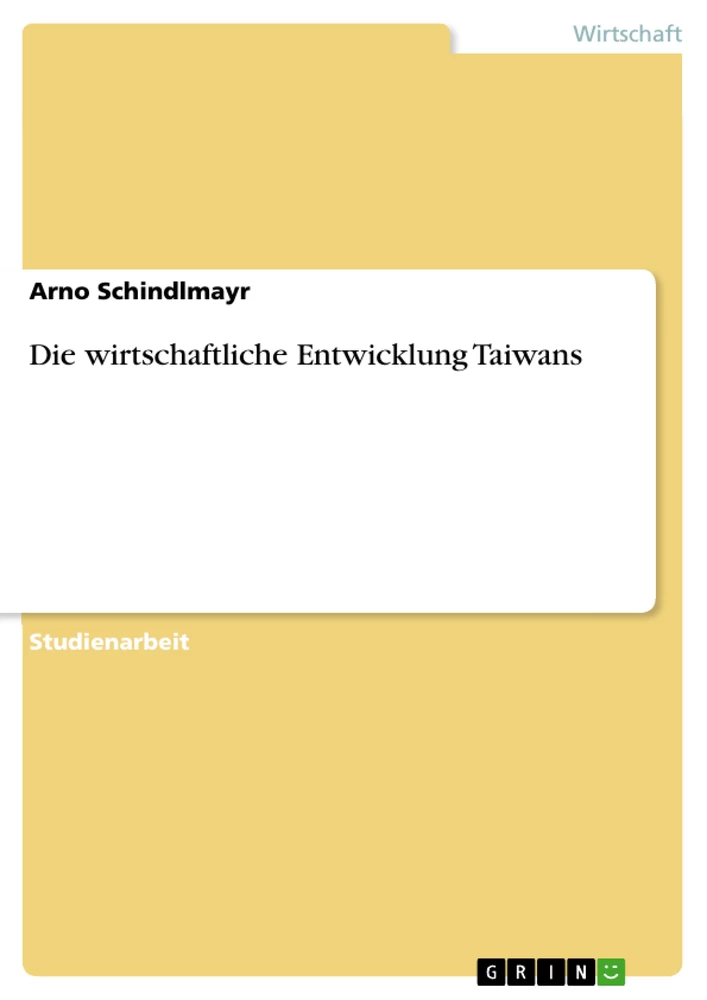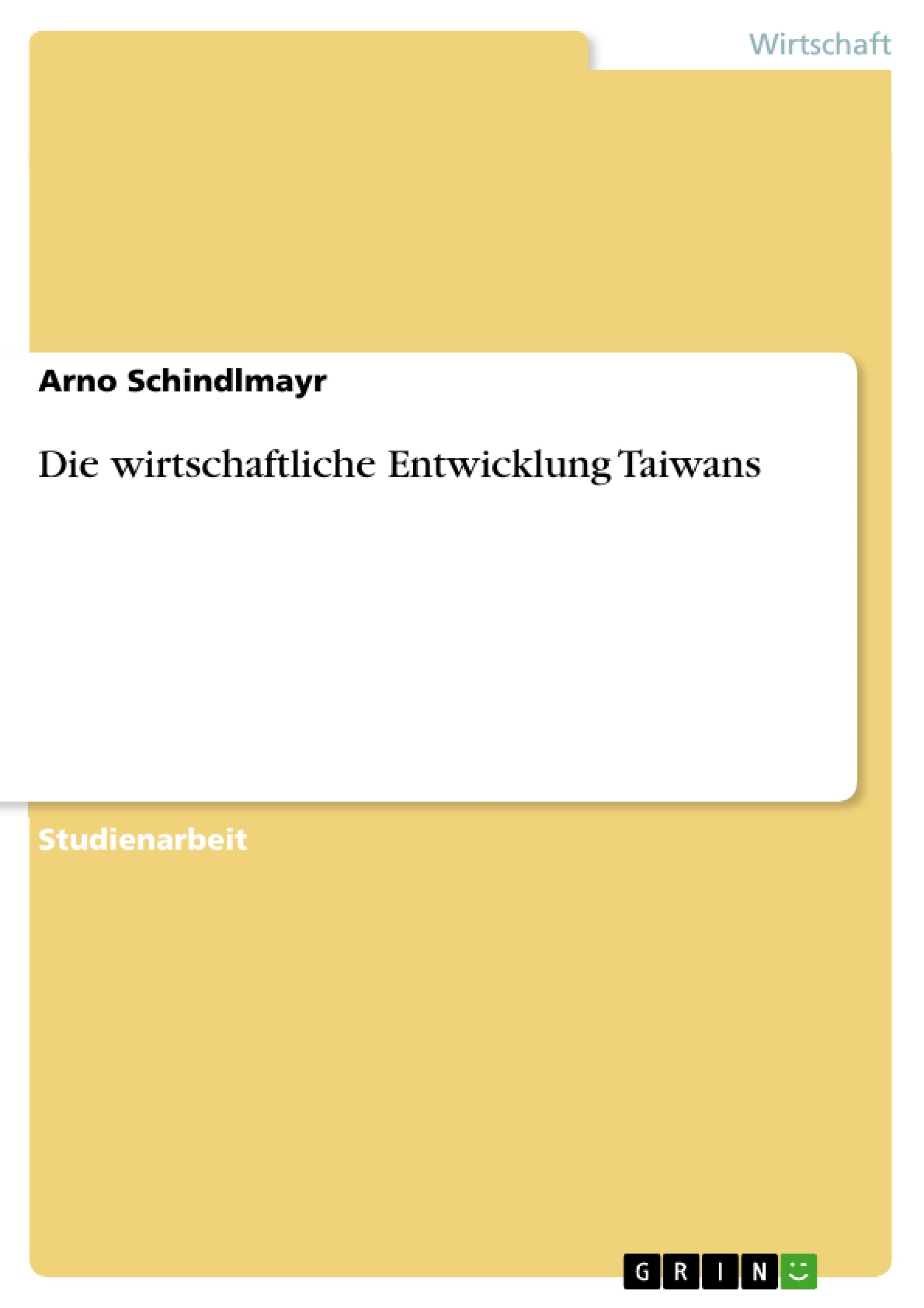Wie gelang es Taiwan, sich von einer Agrarwirtschaft zu einem globalen Technologieführer zu entwickeln? Diese fesselnde Analyse entführt den Leser auf eine Reise durch die bemerkenswerte wirtschaftliche Transformation Taiwans nach dem Zweiten Weltkrieg. Beginnend mit der traditionellen Exportsteigerung unter japanischer Kolonialherrschaft, beleuchtet das Werk die entscheidenden Phasen der Importsubstitution, Exportorientierung und des Aufbaus kapitalintensiver Industrien. Es wird untersucht, wie die Insel, gezeichnet von Kriegsschäden und dem Verlust japanischen Know-hows, durch strategische politische Entscheidungen, amerikanische Wirtschaftshilfe und die Opferbereitschaft ihrer Bevölkerung eine beeindruckende wirtschaftliche Renaissance erlebte. Die Studie ergründet die Rolle der Kuomintang-Regierung bei der Einführung von Landreformen, Währungsreformen und protektionistischen Maßnahmen, die den Grundstein für eine rasante Industrialisierung legten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einrichtung von Exportverarbeitungszonen wie Kaohsiung, die ausländische Investitionen anzogen und den Technologietransfer förderten. Die Analyse zeigt auf, wie Taiwan durch die gezielte Förderung der Leichtindustrie, später der Schwerindustrie und schließlich der Hightech-Branche seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt sicherte. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob Taiwans Erfolgsgeschichte als Modell für andere Schwellenländer dienen kann und welche Lehren aus den Unterschieden zu Japans und Südkoreas Wirtschaftsmodellen gezogen werden können. Diese tiefgreifende Untersuchung bietet faszinierende Einblicke in die wirtschaftspolitischen Strategien, gesellschaftlichen Veränderungen und globalen Einflüsse, die Taiwans Aufstieg zu einer bedeutenden Wirtschaftsmacht ermöglichten, und zeichnet ein lebendiges Bild eines Landes, das sich kontinuierlich neu erfand, um im globalen Wettbewerb zu bestehen – eine Inspirationsquelle für Ökonomen, Politiker und alle, die sich für die Dynamik des wirtschaftlichen Wandels interessieren. Die Entwicklung Taiwans, von der Agrarökonomie zur Hightech-Nation, wird detailliert und anschaulich dargestellt, was das Buch zu einer Pflichtlektüre für jeden macht, der die Triebkräfte des wirtschaftlichen Erfolgs verstehen will.
Die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans
Einleitung
Im ersten Teil dieses Referats wurden die bestimmenden Elemente der japanischen aufholenden Industrialisierung nach der erzwungenen Öffnung des Landes 1868 dargestellt. Hierbei wurden insbesondere die staatliche Lenkungsfunktion bei der Wirtschaftsplanung und gesellschaftlichen Modernisierung, die Opferbereitschaft der Bevölkerung sowie die Exportorientierung als Motor des wirtschaftlichen Wachstums hervorgehoben. Um die Frage zu beantworten, ob die erfolgreiche Industrialisierung Japans einen historischen Sonderfall darstellt oder als Modell für andere Schwellenländer der ostasiatischen Region angesehen werden kann, soll nun die Entwicklung Taiwans nach dem 2. Weltkrieg untersucht werden. Tatsächlich zeigt dieser Vergleich deutliche Parallelen nicht nur in den wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Begleitumständen, sondern auch in der Abfolge aufeinander aufbauender Entwicklungsphasen, die sich jeweils durch eine charakteristische Ressourcenallokation auszeichnen.1 Für die folgende Darstellung wurde daher ein chronologischer Ansatz mit Schwerpunkt auf den frühen Phasen gewählt. Eine grafische Darstellung des jeweiligen Ressourcenflusses findet sich im Anhang.
Phase 0: Traditionelle Exportsteigerung (vor 1950)
Trotz ihrer Nähe zum Festland wurde die Insel Taiwan, ehemals Formosa, erst unter der Ching-Dynastie im Laufe des 19. Jahrhunderts systematisch durch Chinesen erschlossen und besiedelt. Taiwan ist wie Japan arm an natürlichen Bodenschätzen, entwickelte sich aufgrund der günstigen landwirtschaftlichen Bedingungen jedoch rasch zu einem Nettoexporteur und konnte so bereits zu einem frühen Zeitpunkt einen Wohlstandsvorsprung gegenüber dem chinesischen Festland erzielen.2 Die bestehende Agrarwirtschaft wurde weiter ausgebaut, als Taiwan 1895 japanische Kolonie wurde. Auf diese Weise entstand eine klassische, vorindustrielle Kolonialwirtschaft, die landwirtschaftliche Produkte (Zuckerrohr, Reis) in das Mutterland Japan exportierte und im Gegenzug industriell gefertigte Verbrauchsgüter importierte. Der steigende Konsumbedarf ließ sich durch eine entsprechende Erhöhung dieser traditionellen Exporte finanzieren und schlug sich im wachsenden bilateralen Handel nieder. Allein zwischen 1926 und 1936 stiegen die Exporte nach Japan um 40,2% und die Importe im Gegenzug sogar um 120,5%.3
Für die nachfolgende Entwicklung schuf die fünfzig Jahre währende Kolonialzeit wichtige Voraussetzungen. Einerseits führte die prosperierende Wirtschaft zu einem Anwachsen der Bevölkerung und produzierte so einen Arbeitskräfteüberschuß, der später für die Industrialisierung abgeschöpft werden konnte. Andererseits bauten die Kolonialherren Infrastruktur und Transportwege aus, setzten effiziente Verwaltungsbehörden ein und schufen ein modernes Bildungssystem nach japanischem Vorbild, das in der Gründung einer kaiserlichen Universität in Taipei kulminierte.4
Im Zuge der Generalmobilmachung begann Japan seit den 30er Jahren auch mit dem Aufbau kriegsrelevanter Industrien in Taiwan. Da in den Schlüsselpositionen aber ausschließlich japanische Manager und Techniker eingesetzt wurden, fand hierdurch kein wirklicher Wissenstransfer statt. Ein großer Teil der industriellen Anlagen wurde darüber hinaus während des Kriegs zerstört.5
Phase 1: Importsubstitution (1950-1962)
Die erheblichen materiellen Kriegsschäden und der Abzug des japanischen Know-hows hinterließen Lücken, die erst wieder geschlossen werden konnten, als die nationalistische Kuomintang 1949 gegen die von Mao Tse-tung angeführten Kommunisten unterlag und sich vom Festland auf die vorgelagerte Insel zurückzog. In ihrem Gefolge wanderten zwei Millionen Angehörige des Militärs und der Eliten der chinesischen Republik nach Taiwan ein.6 Um ihre Position im Innern zu sichern und gleichzeitig die Voraussetzung für die Abwehr einer kommunistischen Invasion zu schaffen, führte die Kuomintang ein autoritäres Herrschaftssystem ein und begann umgehend mit einer wirtschaftlichen Modernisierung. Kernpunkte ihres Programms waren eine Landreform zur Stärkung der Agrarbasis, die Abkoppelung der Wirtschaft von der Abwärtsspirale des Festlands durch eine Währungsreform sowie der Aufbau einer verarbeitenden Industrie durch Substitution von entsprechenden Importen.7 Umfangreiche amerikanische Wirtschaftshilfen stützten diesen Prozeß finanziell.
Durch Rationalisierungsmaßnahmen und den Übergang zu höherwertigen Produkten (Spargel, Champignons, Gemüsemais, Blumen) konnten in der Landwirtschaft hohe Exporterlöse erzielt werden, die von staatlicher Seite abgeschöpft und ebenso wie der Arbeitskräfteüberschuß in den Aufbau der Industrie umgelenkt werden konnten. Wie Japan entschied sich Taiwan in dieser Phase für eine Förderung der arbeitsintensiven Leichtindustrie (Textilien) und die Substitution bestehender Importe durch eigene Produktion. Diese Wahl hatte den Vorteil, daß ein entsprechender Inlandsmarkt bereits existierte und die junge einheimische Industrie durch protektionistische Maßnahmen vor ausländischer Konkurrenz geschützt werden konnte. Sie ist jedoch keinesfalls zwingend, wie ein Blick auf das Festland zeigt. Aus ideologischen Gründen entschied sich die Volksrepublik zur gleichen Zeit für das sowjetische Entwicklungsmodell und konzentrierte sich auf die Förderung der Schwerindustrie, die zwar, wie beabsichtigt, ein Proletariat entstehen ließ, aber schon bald in die Katastrophe des "Großen Sprungs" führte.8
Obwohl im Rückblick erfolgreich, waren die Landreform und der autoritär gelenkte Umbau der Wirtschaft radikale Maßnahmen, die erheblich in die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und Eigentumsrechte eingriffen.9 Wie im Japan des 19. Jahrhunderts waren sie nur möglich, weil die Regierung nicht nur um das eigene Überleben, sondern auch gegen die Bedrohung durch einen übermächtigen äußeren Feind kämpfte. In dieser Ausnahmesituation konnte sie sich mit dem Hinweis auf ein übergeordnetes nationales Interesse über Partikularinteressen hinwegsetzen und überdies an die Opferbereitschaft der Bevölkerung appellieren.
Phase 2: Exportorientierung (1962-1970)
Nach der Sättigung des begrenzten Binnenmarkts konnte das Wirtschaftswachstum nur durch Export der Produktionsüberschüsse aufrecht erhalten werden. In den 60er Jahren änderte die taiwanische Regierung daher ihre bisherige protektionistische Politik und begann, den Außenhandel zu liberalisieren. Durch Steuererleichterungen und Kredithilfen wurde die Ansiedlung von Exportunternehmen gezielt gefördert.10 Von herausragender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Einrichtung der Exportverarbeitungszone Kaohsiung im Jahr 1966, die ausländischen Unternehmen ohne Zollbeschränkungen die Fertigung von Exportprodukten aus importierten Rohstoffen gestattete. Indem es so seine gut ausgebildeten, aber dennoch billigen Arbeitskräfte auf dem Weltmarkt anbot, schlug Taiwan Kapital aus seinem wichtigsten komparativen Vorteil und entwickelte sich rasch zu einem attraktiven Investitionsstandort. Trotz des Verzichts auf Zolleinnahmen spülten die Löhne der Exportarbeiter Devisen ins Land, und das wachsende Engagement ausländischer Unternehmen förderte den Technologietransfer. Als Folge dieser Entwicklung kletterte das Wirtschaftswachstum auf 10% pro Jahr, und der Produktionswert der Industrie überstieg im Jahr 1962 erstmals den des Agrarsektors.11 Das fortgesetzte Wirtschaftswachstum bot ein Ventil für die weiter steigende Bevölkerungszahl und sorgte für den Wohlstand breiter Schichten.
Phase 3: Aufbau kapitalintensiver Industrien (1970-1981)
Der Ausschluß aus den Vereinten Nationen 1970 zu Gunsten der Volksrepublik China brachte Taiwan in eine drohende außenpolitische Isolation und machte den Aufbau einer eigenständigen Schwer- und Rüstungsindustrie unumgänglich. Die beiden Ölkrisen von 1973/74 und 1979 forcierten diese Entwicklung, da sie die Abhängigkeit der bestehenden Wirtschaftszweige von importierten Rohstoffen und Energieträgern deutlich vor Augen geführt hatten. Exogene Krisen bedingten so eine Revision der bisherigen Konzentration auf die arbeitsintensive Leichtindustrie und erzwangen statt dessen die Errichtung einer kapitalintensiven Schwerindustrie, die aus den Erlösen des Exportgeschäfts finanziert wurde.12
Durch eine Reihe staatlicher Investitionsprogramme, namentlich die sogenannten "Zwölf Großprogramme", leitete die Regierung den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur ein. Stahlwerke, petrochemische Anlagen, Atomkraftwerke, Häfen, Werften, Flughäfen und die Nord-Süd-Autobahn entstanden in dieser Zeit, zudem wurde die Eisenbahn elektrifiziert. Diese zweite Importsubstitution auf dem Gebiet der Schwerindustrie führte vorübergehend zu einer stark erhöhten Staatsquote bei den Investitionen und protektionistischen Tendenzen.
Phase 4: Technologieorientierung (seit 1981)
Durch die endgültige Ausschöpfung des hohen Arbeitskräfteüberschusses und die zunehmende Konkurrenz südostasiatischer Billiglohnländer drohte Taiwan seit den 70er Jahren seine Wettbewerbsfähigkeit als Standort arbeitsintensiver Industrien zu verlieren.13 Ökonomische Gründe zwangen die Regierung daher zu einem erneuten Strukturwandel, der mit einer Prüfung der taiwanischen Wettbewerbsfähigkeit in zukunftsorientierten Schlüsselindustrien begann. Die darauf folgende Förderung der technologieintensiven Elektronik- und Computerindustrie geschah daher keinesfalls zufällig, sondern war das Ergebnis einer bewußten politischen Entscheidung. Wie in den vorausgegangenen Phasen wurden staatliche Anschubfinanzierungen aus dem Exportgeschäft zum Aufbau eines alsbald selbsttragenden Wachstumsprozesses eingesetzt. Die Errichtung des Technologieparks Hsinchu im Jahr 1981 stellt einen Meilenstein auf diesem Weg dar und ist in seiner Ausstrahlungskraft mit der der Exportverarbeitungszone Kaohsiung in den 60er Jahren vergleichbar. Die gezielte staatliche Förderung der Hochtechnologiebranche verschafften diesem jungen Industriezweig einen wichtigen internationalen Startvorteil und ließ Taiwan zu einem Weltmarktführer für Computerhardware aufsteigen. Mit Hilfe der Exportgewinne wurden staatliche Wirtschaftsprogramme zur Verbesserung von Bildung, Sozialwesen und Infrastruktur finanziert, um die Innovationskräfte zu fördern und den wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern. Während Taiwan sich so endgültig als moderner Industriestaat etablierte, wurde die arbeitsintensive Produktion zunehmend in südostasiatische Billiglohnländer und auf das chinesische Festland verlegt.14
Fazit
Trotz abweichender externer Rahmenbedingungen in verschiedenen historischen Epochen zeichnet sich die Industrialisierung Japans und Taiwans durch das Durchlaufen der gleichen Entwicklungsphasen aus, so daß man tatsächlich von einem japanischen Modell sprechen kann. Die im Vergleich erheblich beschleunigte Entwicklung Taiwans ist dabei vor allem auf die zu Beginn der Modernisierung bereits vorhandenen Import- und Exportkanäle sowie den weitgehend entwickelten einheimischen Markt für industrielle Verbrauchsgüter zurückzuführen, jedoch spielt auch die hohe Wirtschaftshilfe seitens der USA während der frühen Phasen eine wichtige Rolle.15 Ein auffälliger Unterschied zwischen beiden Ländern zeigt sich darin, daß Taiwan anders als Japan und Südkorea vorwiegend auf Kleinbetriebe statt auf monopolistische Großkonzerne (zaibatsu, chaebol) setzte. Dieser Unterschied betrifft jedoch lediglich ein Detail der Implementierung und impliziert keine Abweichung in der Steuerung des Ressourcenflusses zwischen verschiedenen volkswirtschaftlichen Sektoren oder dem Ziel der jeweiligen Entwicklungsphasen, namentlich der Importsubstitution und der nachfolgenden Exportorientierung. Während sich Klein- und Mittelbetriebe wegen ihrer geringeren Ressourcen schwerer international platzieren können, trug ihre große Flexibilität auf der anderen Seite aber entscheidend dazu bei, daß Taiwan am Ende der 90er Jahre sehr viel weniger von den negativen Auswirkungen der Asienkrise betroffen war als Südkorea und Japan.16
Anhang
Vergleichende schematische Darstellung der Entwicklungsphasen von Taiwan, Südkorea und Taiwan (Fei et al. (1985), S. 38).
Literaturliste
- Fei, John C. H.; Ohkawa, Kazushi; Ranis, Gustav (1985): Economic Development in Historical Perspective: Japan, Korea, and Taiwan, in: Ohkawa, Kazushi; Ranis, Gustav (Hrsg.): Japan and the Developing Countries, Oxford, S. 35-64.
- Halbeisen, Hermann (2000): Die chinesische Republik zwischen Modernisierung und Bürgerkrieg: 1911 bis 1949, in: Herrmann-Pillath, Carsten; Lackner, Michael (Hrsg.): Länderbericht China, Bonn, S. 135-153.
- Herrmann-Pillath, Carsten (2000): Wettbewerb der Systeme und wirtschaftliche Entwicklung im chinesischen Kulturraum, in: Herrmann-Pillath, Carsten; Lackner, Michael (Hrsg.): Länderbericht China, Bonn, S. 261-277.
- Laumer, Helmut (1977): Japans wirtschaftliche Verflechtung mit Südostasien (Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, Nr. 83), Hamburg. · Yu Tzong-shian (1999): Taiwan im Wandel: Wirtschaft, Taipei.
[...]
1 Fei, John C. H.; Ohkawa, Kazushi; Ranis, Gustav (1985): Economic Development in Historical Perspective: Japan, Korea, and Taiwan, in: Ohkawa, Kazushi; Ranis, Gustav (Hrsg.): Japan and the Developing Countries, Oxford, S. 37.
2 Herrmann-Pillath, Carsten (2000): Wettbewerb der Systeme und wirtschaftliche Entwicklung im chinesischen Kulturraum, in: Herrmann-Pillath, Carsten; Lackner, Michael (Hrsg.): Länderbericht China, Bonn, S. 265.
3 Laumer, Helmut (1977): Japans wirtschaftliche Verflechtung mit Südostasien (Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, Nr. 83), Hamburg, S. 15.
4 Ebenda, S. 18.
5 Ebenda, S. 19.
6 Halbeis en, Hermann (2000): Die chinesische Republik zwischen Modernisierung und Bürgerkrieg: 1911 bis 1949, in: Herrmann-Pillath, Carsten; Lackner, Michael (Hrsg.): Länderbericht China, Bonn, S. 152.
7 Laumer (1977), S. 22.
8 Herrmann-Pillath (2000), S. 266.
9 Ebenda, S. 269.
10 Ebenda, S. 270.
11 Yu Tzong-shian (1999): Taiwan im Wandel: Wirtschaft, Taipei, S. 7.
12 Ebenda, S. 8.
13 Ebenda, S. 10.
14 Herrmann-Pillath (2000), S. 275.
15 Fei et al. (1985), S. 53.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans"?
Der Text analysiert die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans nach dem Zweiten Weltkrieg und vergleicht sie mit der japanischen Industrialisierung. Er untersucht, ob Japans Erfolg ein historischer Sonderfall ist oder ein Modell für andere Schwellenländer sein kann.
Welche Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung Taiwans werden im Text beschrieben?
Der Text identifiziert und beschreibt fünf Phasen:
- Phase 0: Traditionelle Exportsteigerung (vor 1950)
- Phase 1: Importsubstitution (1950-1962)
- Phase 2: Exportorientierung (1962-1970)
- Phase 3: Aufbau kapitalintensiver Industrien (1970-1981)
- Phase 4: Technologieorientierung (seit 1981)
Was war die Rolle der japanischen Kolonialzeit für die spätere Entwicklung Taiwans?
Die japanische Kolonialzeit schuf wichtige Voraussetzungen: eine prosperierende Wirtschaft, Bevölkerungswachstum, den Ausbau der Infrastruktur und des Bildungssystems sowie die Einrichtung effizienter Verwaltungsbehörden.
Welche Bedeutung hatte die Kuomintang für die wirtschaftliche Modernisierung Taiwans?
Die Kuomintang führte ein autoritäres Herrschaftssystem ein und begann mit einer wirtschaftlichen Modernisierung, einschließlich einer Landreform, einer Währungsreform und dem Aufbau einer verarbeitenden Industrie durch Importsubstitution. Amerikanische Wirtschaftshilfen unterstützten diesen Prozess.
Welche Rolle spielte die Exportverarbeitungszone Kaohsiung?
Die Einrichtung der Exportverarbeitungszone Kaohsiung im Jahr 1966 ermöglichte es ausländischen Unternehmen, Exportprodukte ohne Zollbeschränkungen herzustellen. Dies trug wesentlich zur Exportorientierung Taiwans bei.
Warum erfolgte der Aufbau kapitalintensiver Industrien in den 1970er Jahren?
Der Ausschluss aus den Vereinten Nationen und die Ölpreiskrisen forcierten den Aufbau einer eigenständigen Schwer- und Rüstungsindustrie, um die Abhängigkeit von importierten Rohstoffen und Energieträgern zu verringern.
Was ist der Technologiepark Hsinchu und welche Bedeutung hat er?
Der Technologiepark Hsinchu wurde 1981 errichtet und ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Technologieorientierung Taiwans. Er förderte die Entwicklung der Elektronik- und Computerindustrie.
Gibt es Parallelen zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung Japans und Taiwans?
Ja, die Industrialisierung Japans und Taiwans zeichnet sich durch das Durchlaufen ähnlicher Entwicklungsphasen aus. Taiwans Entwicklung verlief jedoch schneller, was auf bereits vorhandene Import- und Exportkanäle sowie einen entwickelten Inlandsmarkt zurückzuführen ist.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Taiwan und anderen ostasiatischen Ländern wie Japan und Südkorea in Bezug auf Unternehmensstrukturen?
Taiwan setzte im Gegensatz zu Japan und Südkorea vorwiegend auf Kleinbetriebe statt auf monopolistische Großkonzerne (Zaibatsu, Chaebol). Die große Flexibilität der Klein- und Mittelbetriebe trug dazu bei, dass Taiwan weniger stark von der Asienkrise betroffen war als Südkorea und Japan.
- Quote paper
- Arno Schindlmayr (Author), 2001, Die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101715