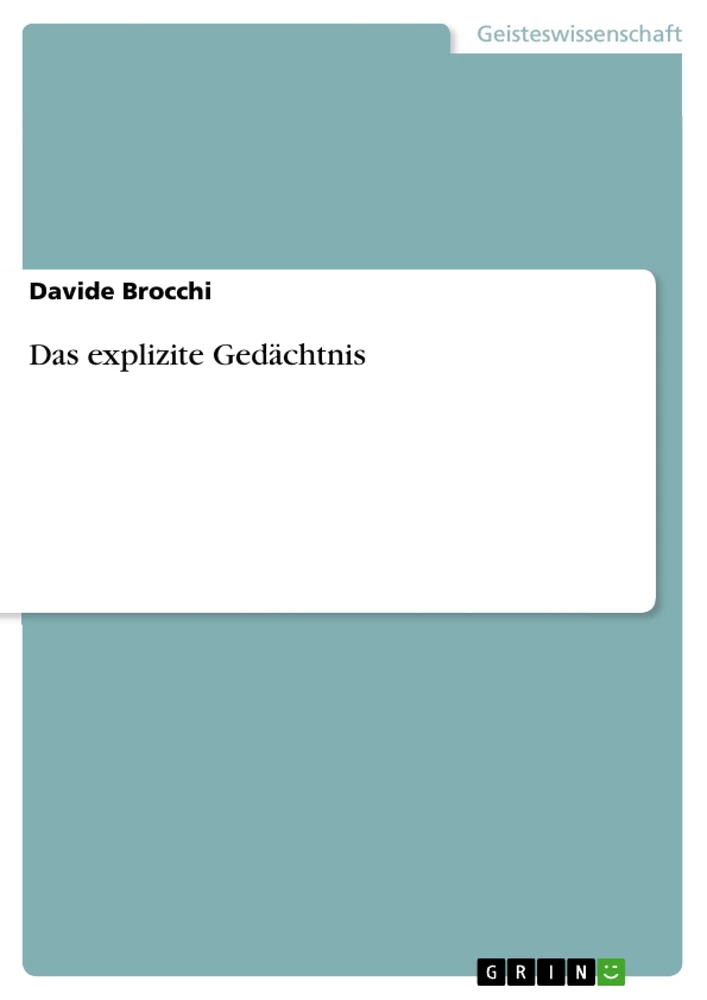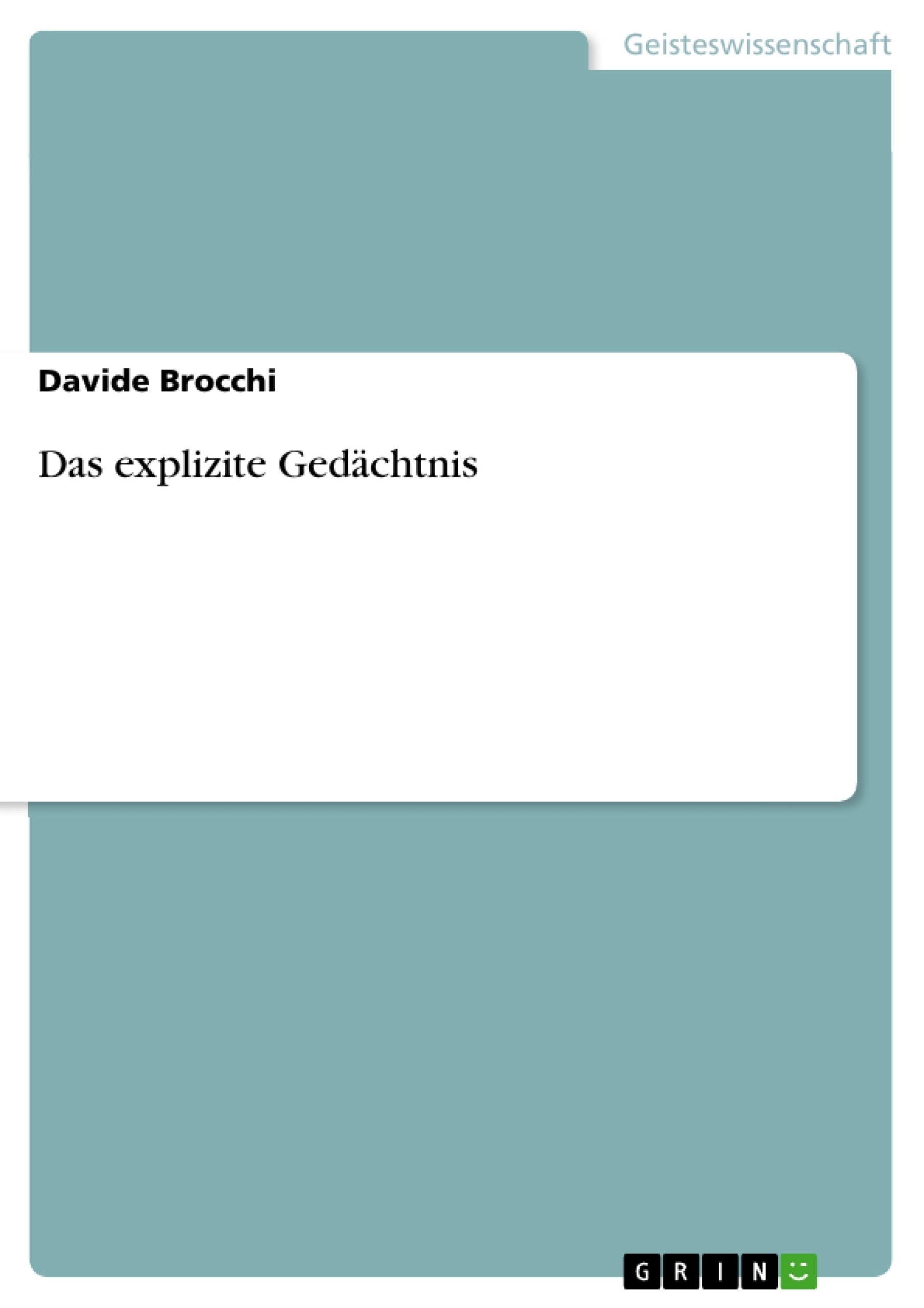Haben Sie sich jemals gefragt, wie Ihre Erinnerungen wirklich funktionieren? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Gedächtnisses und entdecken Sie die Mechanismen, die unser Erinnerungsvermögen bestimmen. Dieses Buch enthüllt die Geheimnisse des expliziten Gedächtnisses, von der Enkodierung und Speicherung von Informationen bis hin zum Abrufen und Behalten von Erinnerungen. Erfahren Sie mehr über die Theorien des Kurzzeit- und Langzeitgedächtnisses, die Rolle der Verarbeitungstiefe beim Lernen und die Bedeutung von Übung und Wiederholung für die Gedächtnisleistung. Entdecken Sie, wie assoziative Strukturen und Kontexteffekte unser Erinnerungsvermögen beeinflussen und wie wir Lernmethoden entwickeln können, um unsere Gedächtnisleistung zu verbessern. Anhand von Experimenten und Fallstudien werden die komplexen Prozesse des Erinnerns und Vergessens beleuchtet, wobei auch auf die Phänomene der Interferenz, des Abrufs und der Rekonstruktion von Erinnerungen eingegangen wird. Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die kognitive Psychologie des Gedächtnisses, sondern auch praktische Strategien und Techniken, um Ihr eigenes Gedächtnis zu trainieren und zu optimieren. Ob Studenten, Wissenschaftler oder einfach nur neugierige Leser – dieses Buch ist ein Muss für alle, die das Geheimnis unseres Gedächtnisses entschlüsseln und ihre Lernfähigkeiten verbessern möchten. Entdecken Sie die Kraft Ihres Geistes und maximieren Sie Ihr Potenzial durch ein besseres Verständnis des Gedächtnisses und der Lernprozesse. Tauchen Sie ein in die Welt der Erinnerungen, lernen Sie die effektivsten Lerntechniken kennen und entdecken Sie, wie Sie Ihr Gedächtnis optimal nutzen können. Ein unverzichtbarer Ratgeber für alle, die ihr Gedächtnis verbessern und ihr Lernpotenzial voll ausschöpfen wollen, fundiert und praxisnah.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Explizites Gedächtnis
3. Enkodierung und Speicherung
3.1 Die Theorie des Kurzzeitgedächtnisses
3.2 Memorieren und Arbeitsgedächtnis
3.2.1 Aktivation und Langzeitgedächtnis
3.3 Übung und Stärke
3.4 Die Tiefe der Verarbeitung
3.4.1 Die Rolle der Intentionalität beim Lernen
3.4.2 Entwicklung von Lernmethoden S
4. Behalten und Abruf
4.1 Abruf und Inferenzen
4.2 Abruf und Assoziative Strukturen
5. Schlußwort
Literatur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung
„Gedächtnis ist der Eindruck, den eine Erfahrung hinterläßt“. Diese Definition von Lefrancois1 möchte die untrennbare Beziehung zwischen Lernen und Gedächtnis ans Licht bringen, da „kein Lernen stattfinden kann, ohne daß irgendwas im Gedächtnis passiert“. Die folgende Recherche wird das Gedächtnis als Objekt betrachten, aber es wird am Ende klar, daß man eigentlich sehr viel über die Lernprozesse (und auch die Lerntechniken) hier geschrieben hat.
Insbesondere werde ich mich auf das sogenannte explizite Gedächtnis konzentrieren und im Folge auf die Mechanismen, die das Behalten und den Abruf von Gedächtnisinhalten beeinflussen.
2. Explizites Gedächtnis
Mehrere Forscher der Allgemeine Psychologie unterscheiden zwischen einem expliziten Wissen und einem impliziten Wissen, anderen zwischen einem deklarativen und prozeduralen Wissen 2.
Während man über ein explizites Wissen berichten kann, da es bewußt ist, kann man über implizites unbewußtes Wissen nicht berichten, obwohl es tatsächlich vorhanden ist. Beispiel für explizites Wissen ist ein Gedicht, das ich auswendig lerne und wiedergebe. Ein gutes Beispiel für implizites Wissen sind ausgebildete Schreibkräfte, die Briefe mit allen ihren Finger ständig und schnell möglichst tippen sollen. Sobald wir aber fragen, wo sich eine bestimmte Buchstabe auf der Schreibmaschine befindet, können diese Menschen nicht sofort beantworten, ohne mit den Finger so zu spielen, als ob sie die Antwort tippen mußten. Dieses Wissen ist sozusagen in den Finger vorhanden, wird nur durch die Ausführung einer Aufgabe bewiesen, aber ist nicht bewußt im Gedächtnis enthalten. Wir wissen etwas, aber wir können den Inhalt dieses Wissens nicht beschreiben.
In Bezug auf die Inhalten kann man von expliziten Gedächtnisinhalten bei dem expliziten oder deklarativen Wissen sprechen, und von impliziten Gedächtnisinhalten bei dem impliziten oder prozeduralen Wissen.
Verschiedene Untersuchungen haben versucht, eine Dissoziation zwischen diesen zwei Arten von Wissen zu beweisen:
A. Bei Amnesie- Patienten
Vollständige Dissoziationen von implizitem und expizitem Wissen sind bei gesunden Menschen selten. Sie treten hingegen bei bestimmten Formen von Amnesie auf, wie zum Beispiel bei dem Korsakoff- Syndrom.
Ein Synonym für die Korsakoff- Syndrom ist „amnestisches Psychosyndrom“. Diese Syndrom kann durch u.a. chronischen Alkoholismus verursacht werden. Die Patienten leiden an Desorientiertheit und Konfabulationen. Sie können sich an sehr wenig erinnern, da sie auch das vergessen, was eben gerade passiert ist. In diesen Fällen sind die neuronalen Strukturen auf dem frontalen Cortex und auf dem Hippocampus stark beschädigt. Diese Gehirnarealen sind besonders wichtig für die Gedächtnisleistung.
Die Forschung hat Hinweise erbracht, daß Amnesie- Patienten über implizites Wissen und Gedächtnis verfügen, selbst wenn sie es nicht bewußt wiedergeben können.
Graf, Squire und Mandler machten 1984 ein Experiment, wo die Gedächtnisleistung einer Gruppen von Amnesie- Patienten mit der einer Gruppe gesunder Menschen verglichen wurde.
Zuerst sollten beide Gruppen eine Wortliste lernen und dann später, bei der Testsituation, reproduzieren. Die Probanden mit einer Amnesie konnten viel weniger Worte wiedergeben als die Gesunde, also zeigten die letzteren eine viel höhere explizite Gedächtnisleistung. Die zweite Aufgabe für beide Gruppe war hingegen eine Liste zu ergänzen, in der nur die erste drei Buchstabe englischer Wörter standen. In dieser Übung zeigten die Probanden mit Amnesie eine bessere Leistung als die Gruppe der gesunden Probanden. Das war einen Beweis für eine noch effiziente implizite Gedächtnis bei den Amnesie- Patienten. Bei dieser zweiten Aufgabe des Experiments konnte man die Probleme ohne bewußtes Wissen lösen. Es gibt noch einen Fall, der eine Dissoziazion zwischen explizitem und implizitem Gedächtnis beweist. Der inzwischen berühmte Patient H. M. war ein Epileptiker. Um ihn zu heilen, wurden ihm der Hippocampus und die umgebenden Strukturen aus dem Gehirn vollständig entfernt. Der Patient litt danach zwar an eine starke Amnesie, allerdings zeigte er die Fähigkeit, sich implizite Gedächtnisinhalte anzueignen. Zum Beispiel könnte er sich bei verschiedenen perzeptiv- motorischen Aufgaben der Therapie verbessern. Ein Tag später hatte er aber die gerade geleisteten Übungen schon vergessen.
B. Bei gesunden Menschen
Bei gesunden Menschen sind die Dissoziationen nicht so stark wie bei Patienten mit Amnesie. Trotzdem haben Forschungsergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen die Existenz einer solchen Dissoziation auch hier bewiesen.
Jacoby hat Anfang der achtziger Jahren ein Experiment mit gesunden Menschen durchgeführt. Eine Reihe von Worten sollte von Probanden unter drei verschiedenen Bedingungen gelernt werden:
a) Man sollte isolierte Worte lernen (z.B. Frau).
b) Die Worte sollte im Kontext bzw. zusammen mit einem Antonym gelernt werden (z.B. Frau mit Mann).
c) Die Probanden bekamen ein Wort vorgelesen und sollten den dazu passenden Antonym finden (z.B. wenn sie Mann hören, sollen sie Frau dazu sagen). Sie generierten nämlich selbst das Wort.
Unter der ersten Bedingung sollte das explizite Gedächtnis die besondere Leistung erbringen, während unter den anderen zwei Bedingungen das Implizite.
Nun testete Jacobi in zwei verschiedenen Weisen, wie gut die verschiedene Worte gelernt wurden. Die Probanden wurden in zwei Gruppen getrennt. Der ersten Gruppe wurde eine Liste von Worte dargeboten. Die Probanden sollten die gelernte Worte hier wiedererkennen und so wurde das explizite Gedächtnis getestet.
Die zweite Gruppe bekam ein Wort nach dem anderen sehr kurz gezeigt und sollte sie dann wiedererkennen. So sollte das implizite Gedächtnis getestet werden.
Tatsächlich bewiesen die Ergebnisse unterschiedliche Verhaltensweise der zwei Gedächtnisse auch bei gesunden Menschen. In der ersten Gruppe wurde die beste Leistung bei den Worten gezeigt, die durch das Generieren gelernt wurden, während in der zweite Gruppe Test bei den Worten, die in isolierter Weise gelernt wurden.
3. Enkodierung und Speicherung
Hermann Ebbinghaus (1885) gilt als Urheber der Methode der (älteren) Gedächtnisuntersuchungen. In seinen Experimenten war er sein einzige Proband. Er versuchte Listen von Buchstaben auswendig zu lernen, bis er sie zwei mal nacheinander wiedergeben konnte. Zuerst testete er nach unterschiedlichen Zeitspannen, wie gut er diese Listen behalten hatte. Die Ergebnisse erbrachten eine Kurve , deren auffallendste Merkmal war, daß der Großteil dessen, was vergessen wurde, sehr schnell vergessen wurde, und zwar innerhalb eines Tage Dann setzte sich das Vergessen noch über 30 Tage auf einer sehr abgeschwächten Weise.
Das Experiment von Ebbinghaus endete aber nicht hier. Er testete noch, wie lange er lernen mußte, um die Listen von Buchstaben erneut so gut zu beherrschen, und er fand heraus, daß er weniger als die Hälfte der Zeit (als ganz am Anfang) brauchte, um sie genauso gut wiedergeben zu können.
Ebbinghaus fragte sich nun, was passieren würde, wenn er die Listen weitergelernt hätte, obwohl er sie schon beherrschen konnte. Auch hier waren die Ergebnisse interessant: nach 24 Stunden vom letzten Lernpunkt brauchte er 64,1% weniger Zeit, um die am Anfang überlernten Listen so gut zu lernen, daß er sie zwei Mal nacheinander ganz wiedergeben konnte. Ohne Überlernen wäre nur 33,8% weniger Zeit gewesen. Die zusätzlichen Lerndurchgänge führten somit bei einem nachfolgenden Behaltenstest zu einer erhöhten Ersparni Die Ergebnisse des Ebbinghauses Experiments werden in folgender Grafik dargestellt3:
Behaltensintervall (Tage)
In den nächsten Jahrzehnten wurden die Experimenten von Ebbinghaus mit anderen fortgeschrittenen Techniken wiederholt, aber die Bedeutung seiner Ergebnisse wurde immer wieder bestätigt.
Es gibt verschiedene Theorien, die mit mehr oder weniger Erfolg versucht haben, das von Ebbinghaus beschriebene Phänomen zu erklären.
3.1 Die Theorie des Kurzzeitgedächtnisses
Bei der Vergessenskurve von Ebbinghaus kann man zwei Momente unterscheiden: zuerst und bis zu dem 9- Stunde- Punkt ca., wird sehr schnell vergessen, während dann sehr langsam und für eine lange Zeit. Dieses Phänomen hat zu der Hypothese geführt, daß es zwei verschiedene Arten von Gedächtnis gibt: ein Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtni Der Begriff Kurzzeitgedächtnis bezieht sich auf den Abruf von Items, die nicht mehr abrufbar sind, sobald die Person mit deren Wiederholung aufhört.4
Dieses hat eine begrenzte Aufnahmekapazität, die nur den Informationen nutzt, die wir sofort brauchen können. Ein Gehirn kann nicht alle Informationen behalten, die man im Leben gelernt hat, brauchbare wie unbrauchbare. Deswegen gehen sie für immer verloren, wenn sie das Kurzzeitgedächtnis verlassen, ohne eine dauerhafte Repräsentation im Langzeitgedächtnis gebildet zu haben. Dieses gibt andere Informationen die Möglichkeit, aufgenommen zu werden.
Atkinson und Schiffrin (1968) haben die sogenannte Theorie des Kurzzeitgedächtnisses am systematischsten entwickelt.
Rundus zeigte Anfang der Siebziger durch ein Experiment, daß ein Item mit wachsender Anzahl an Wiederholungen besser erinnert werden kann (was Ebbinghaus eigentlich schon vorgesagt hatte). Diese Annahme ließ die Vertreter der Theorie des Kurzzeitgedächtnisses glauben, daß das Kurzzeitgedächtnis eine notwendige Durchgangsstation zum Langzeitgedächtnis sei:
Informationen müssen eine gewisse Verweildauer im Kurzzeitgedächtnis haben, um ins Langzeitgedächtnis zu gelangen. Je länger diese Verweildauer ist, desto länger kann erinnert werden.5
Craik und Lockhart brachen 1972 die Gültigkeit dieser Theorie. Für sie war nicht die Dauer des Memorierens der entscheidende Faktor, sondern deren Art und wie, d.h. die Verarbeitungstiefe der Informationen. Daher sprach man von der Theorie der Verarbeitungstiefe. Auch spätere Untersuchungen zeigten, daß Items besser behalten werden, wenn sie semantisch und in ihrer Bedeutung verarbeitet werden.
Genau dieses bewies aber, daß Informationen nicht unbedingt die Vermittlung des Kurzzeitgedächtnisses brauchen, um ins Langzeitgedächtnis zu gelangen. Die Theorie der Kurzzeitgedächtnisses verlor so ihre Gültigkeit. Gültig blieb nur die empirische Beobachtung, daß die Aufnahmekapazität des Gedächtnisses an Informationsmenge begrenzt ist.
3.2 Memorieren und Arbeitsgedächtnis
In seinem Buch Working Memory (1986) vertritt Baddeley folgende These: die Aufnahmekapazität (Gedächtnisspanne) sei nicht durch die Anzahl der memorierbaren Items bestimmt, wie die Theorie des Kurzzeitgedächtnisses behauptete, sondern durch die Geschwindigkeit, die gebraucht wird, um die Items zu memorieren.
Im Bezug auf verbales Material vermutet Baddeley die Existenz eine artikulatorische Schleife (En.: „articulatory loop“). In diesem Fall, begrenzt ist nicht mehr der Raum, sondern die Zeit der Aufnahmekapazität.
Untersuchungen haben gezeigt, daß Probanden mehr Worte memorieren können, wenn die Worte aus wenigen Silben bestehen bzw. kurz sind, als wenn sie lang sind (Wortlängeeffekt). Baddeley und Vallar (1982) haben Anfang der Achtziger vermutet, daß die Zeit, die man braucht, um ein Wort ganz auszusprechen, auch eine wichtige Rolle spiele. Die Leserate
(Worte, die pro Sekunde ausgesprochen werden) sei nämlich proportional zu dem Anteil korrekter Nennungen beim Wiedererkennungstest.
Conrad zeigte, daß nicht nur die Geschwindigkeit des Ausprechens der Worte eine Rolle spielt, sondern auch die Ordnung und die Reihenfolge des Buchstabes, die das Wort bilden. In der Tat ersetzten oft die Probanden vergessenen Buchstaben andere Buchstaben mit ähnlichem Klang.
Alles scheint so, als ob die artikulatorische Schleife nicht das einzige Hilfssystem beim Memorieren wäre. So schlägt Baddeley auch einen räumlich- visuellen Notizblock (En.: „visual sketchpad“) vor, der den Menschen erlaubt, das zu memorierende Material zu fotografieren. Neben diesen Hilfssystemen dürften es aber noch anderen geben. Eine Hypothese ist, daß alle diese Hilfssysteme von einer „Zentrale“ koordiniert seien. Baddeley spricht von zentrale Exekutive (En.: „central executive“), die Informationen in oder aus den Hilfssystemen speichert oder abruft. Diese zentrale Exekutive braucht eine eigene Speicherkapazität, um die Informationen zu behalten, zumindest für die Zeit, die benötigt wird, um eine Entscheidung über die Kontrolle der Hilfssysteme zu treffen.
In der gleichnamige Theorie war das Kurzzeitgedächtnis ein nötiger Übergang der Items zum Langzeitgedächtni In der Theorie von Baddeley (u.a.) wird diese Vermittlungsrolle von den Hilfssystemen übernommen. Dazu wird ein direkter Zugang der Items zum Langzeitgedächtnis nicht ausgeschlossen. Diese sind die wichtigsten Unterschieden zwischen den zwei Theorien.
Man hat grausame Tierexperimente durchgeführt, um die Präsenz der verschiedenen Funktionen in bestimmten Arealen des Gehirnes zu beweisen. Zum Beispiel wurde es geforscht, ob Affen die gleichen Aufgaben weiter ausführen, wenn man ihnen einen bestimmten Teil des Gehirnes absportierte.
3.2.1 Aktivation und Langzeitgedächtnis
Wer sich plötzlich in einer Fremdsprache ausdrucken muss, die man vor Jahren gelernt hat, braucht mehr Informationen, als die die in dem Augenblick verfügbar sind. Genauso funktioniert es mit dem Kopfrechnen und mit vielen anderen Aufgaben. Nun ist die Frage, wie viele Informationen müssen aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden, um diese Art von Aufgaben zu erfüllen? Wie funktioniert es?
Obwohl sich diese Frage viel mehr mit dem impliziten Gedächtnis zu beschäftigen scheint, werden wir versuchen eine Antwort zu finden. Zuerst benötigen wir, das Konzept der Aktivation innerhalb des Langzeitgedächtnisses zu definieren.
Einige Theorien gehen von der Annahme aus, daß Informationen aus dem Langzeitgedächtnis, in verschiedenen Zeitpunkten, nicht immer gleich verfügbar sind. Ein wichtiger Begriff ist hierbei der der Aktivationshöhe. Die Definition von Anderson lautet:
Die Aktivationshöhe bestimmt die Wahrscheinlichkeit des Zugriffs auf das Gedächtnis wie auch die Häufigkeit des Zugriff Häufigkeitseffekte können dadurch aufgezeigt werden, daß man die Geschwindigkeit bestimmt, mit der wir Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abrufen.6
Die Aktivationshöhe wird durch zwei Faktoren bestimmt:
a) Zeitabstand seit dem letzten Abruf eines Gedächtnisinhalte
b) Übungsgrad des Gedächtnisinhalt
Auf den ersten Faktor konzentriert sich die sogenannte SAM- Theorie, die den Gestaltpsychologen sehr nah steht.7 Sie behauptet, es gäbe Bildern (od. Gedächtnisspuren), deren Vertrautheit von den Hinweisreizen aus dem Kontext abhängt. Eine Information bleibt uns so lange verfügbar, bis wir sie immer wieder benutzen und gebrauchen. Ansonsten sinkt ihre Verfügbarkeit. Loftus sammelte am Anfang der siebziger Jahren Belege zu dieser Annahme.
Auf den zweiten Faktor der die Aktivationshöhe beeinflusst, d.h. den Übungsgrad des Gedächtnisinhaltes, konzentriert sich Anderson. Durch ein Experiment zeigt er, daß Probanden die besser geübten Sätze schneller wiedererkennen können.
Die Theorie Andersons (auch AKT- Theorie) behauptet, daß Gedächtnisspuren durch die Darbietung assoziierter Konzepte aktiviert werden, und daß sich unser Gedächtnis innerhalb eines Netzwerkes von Konzepten bewegt. Die Aktivationsausbreitung deutet auf eine Ausbreitung der Aktivation entlang der Pfade eines solchen Netzwerk
Die nächste Grafik stellt ein Beispiel eines solchen Netzwerks bzw. einen Teil eines propositionalen Netzwerks (die Umgebung des Konzeptes HUND) dar8:
Anderson führte ein Experiment mit Perlmutter, um Belege für seine Annahme zu erbringen. Die Probanden sollten Worte generieren, die eine bestimmte Bedingung erfüllten. Bei der Priming bedingung sollten die Probanden Worte generieren, die mit einem bestimmten Buchstaben begannen und in Assoziation zu einem vorgegeben Wort standen ( obere Grafik). Zum Beispiel könnten die Probanden das Wort Katze als Assoziation zu Hund generieren.
Bei der Kontroll bedingung sollte hingegen ein Wort generiert werden, das zwar mit einem bestimmten Buchstaben beginnen sollte, aber nicht unbedingt mit dem vorgegebenen Wort in Verbindung stehen sollte.
Das Ergebnis des Experiment war, daß die Probanden weniger Zeit bei der Primingbedingung als bei der Kontrollbedingung gebraucht hatten, um ein Wort zu generieren. Die unbewußte Bahnung von Wissensstrukturen (so Anderson) erleichtert - und teilweise führt - die Aktivation und den Abruf von Informationen (assoziatives Priming).
Die Untersuchungen anderer Forscher haben zu ähnlichen Ergebnissen geführt.
3.3 Ü bung und Stärke
Da die Aktivation einer Gedächtnisspur sehr schnell verloren gehen kann, bezeichnen wir als Stärke die „Tiefe“ dieser Spur. Die Stärke einer Gedächtnisspur steigt bei jeder Nutzung. Das ist der Grund, weswegen Üben als Hauptlehrtechnik gilt.
In einer Untersuchung von Pirolli und Anderson (1985) sollten die Probanden Sätze lernen. Es wurde gemessen, wie sehr die Übung die Wiedererkennungszeiten dieser Sätze beeinflußte. In der Tat sanken diese Zeiten, je mehr die Sätze geübt wurden. Das Verhältnis zwischen Übung und Wiedererkennungszeit läßt sich in einer Potenzfunktion erfassen:
T= 1,40 P-0,24
T steht für die Wiedererkennungszeit, während P die Zahl der Übungstage steht. Die Kurve, die diese Funktion zeichnet, zeigt, daß die Verbesserung mit zunehmender Übung abnimmt. Newell und Roosenbloom haben diese Regel Potenzgesetz des Lernens genannt. Belegt ist es, daß dieses Gesetz eine Basis in den neuronalen Aktivitäten hat. Man spricht zum Beispiel von LPT, long- term potentiation:
Wenn eine Nervenbahn mit hochfrequentem elektrischem Strom stimuliert wird, hat dies eine gesteigerte Sensibilität der Zellen entlang dieser Nervenbahn für weitere Stimulationen zur Folge.9
3.4 Die Tiefe der Verarbeitung
Lernen und Üben heißen aber nicht automatisch gesteigerte Gedächtnisleistung. Entscheidend ist es, wie man lernt. Verschiedene Untersuchungen beweisen die Annahme, daß eine bedeutungshaltige Verarbeitung der Informationen sowie eine elaborative Verarbeitung sehr wichtig für die Steigerung des Gedächtnisleistung sind (vgl. Theorie des Verarbeitungstiefe von Craik und Lockhart).
Bobrow und Bower zeigten im Jahre 1969, daß die Probanden viel besser Sätze, die sie selbst generiert hatten, wiedererkennen konnten, als die die von Experimentatoren vorgegeben waren. Es ging nicht darum, ob die Sätze von Probanden oder Experimentatoren stammen sondern viel mehr, daß die Sätze die Wissenzusammenhänge und die Wissensstruktur der einzelnen Probanden widerspiegelten.
Ein Experiment von Slamecka und Graf (1978) brachte die Aufmerksamkeit auf die Rolle der Bedeutungshaltigkeit oder nicht Bedeutungshaltigkeit der Elaborationen. Die Probanden sollten Wortpaare generieren oder lesen, die entweder aus Synonymen bestanden (erste Bedingung) oder Reime bildeten (zweite Bedingung).
Die höchste Wiedererkennungswahrscheinlichkeit lag bei den Paaren von Synonymen, unabhängig davon, ob sie selbst generiert wurden oder nur gelesen wurden.
3.4.1 Die Rolle der Intentionalität beim Lernen
Ein Experiment von Hyde und Jenkins (1978) illustriert, daß es keine Rolle spielt, ob man die Absicht zu lernen hat oder nicht hat. Wichtig ist es nur (noch einmal), wie das Material verarbeitet wird.
Die Probanden wurden hier in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe sollte bei einer Liste von 24 Wörtern erkennen, ob der Buchstabe „ e “ oder der Buchstabe „ g “ vorkommt. Die andere Gruppe sollte bei derselben Liste angeben, welches Wort sich als angenehm oder unangenehm fühlen ließ. Man nahm an, daß diese zweite Aufgabe eine tiefere Verarbeitung benötigte, als bei dem erste der Fall war.
Dann wurde der Faktor „Ansicht / Intention“ ins Experiment eingeführt. Der Hälfte der Mitglieder beider Gruppen wurde Bescheid gegeben, daß das wahre Ziel des Experiment im Lernen der Worte bestand.
Dieser Faktor beeinflußte aber kaum die Ergebnisse. Die Unterschiede zwischen der Gedächtnisleistung von denen, die Bescheid wußten (> intentionales Lernen), und von denen, die nicht Bescheid wußten (> inzidentelles Lernen), war ohne Bedeutung. Und dieses geschah, unabhängig von der Art der Verarbeitung.
3.4.2 Entwicklung von Lernmethoden
Auf der Basis der Befunden, die zum Teil oben beschrieben sind, wurden Lernmethoden entwickelt. Die Bekannteste sind die SQ3R- Methode (Robinson, 1961) und die PQ4R- Methode (Thomas & Robinson, 1972). Diese Lernstrategien werden oft an Studenten bei Kursen vermittelt, um ihre Behaltensleistung von Texte zu verbessern. Der Erfolg solcher Kurse ist wissenschaftlich bewiesen.
Die zugrundeliegende Idee dieser Methoden ist, den zu lernenden Text zu „befragen“, um die Inhalten tiefer zu verarbeiten. Zuerst sollte man sollte die Themen des Textes definieren und Fragen dazu formulieren10, dann sollten genau diese Fragen beantwortet werden. Wenn es bei einer Frage nicht möglich ist, sollte der Text wieder gelesen werden, um später die Frage zu beantworten.
4 Behalten und Abruf
Das Experiment von Ebbinghaus hat sicher nicht alleine Belege ergebracht, für die Annahme, daß gelernte Informationen auch vergessen werden.
Es gibt zwei Arten von Vergessen: a) Die Informationen gehen für immer verloren; b) Wir glauben, etwas vergessen zu haben, obwohl die Informationen immer noch gespeichert sind und vielleicht in anderen Situationen zum Bewußtsein wieder kommen.
Verschiedene Forscher haben die zweite und interessanteste Möglichkeit durch Experimente untersucht. Bei neurochirurgischen Eingriffen stimulierte Penfield (1959) Teile des Gehirnes von Patienten mit elektrischem Strom. Die ‚stimulierten‘ Patienten erzählten danach Ereignissen aus ihrer Kindheit, die unter normalen Umständen nicht wiedergegeben hätten. Nelson (1971 und 1978) ließ Probanden Zahl- Nomen- Paare lernen, bis sie diese fehlerfrei wiedergeben konnten. Zwei Wochen später wurden die Probanden getestet: sie konnten sich an 75% der Items erinnern, während 25% davon anscheinend vergessen wurden. Die Probanden bekamen dann die Möglichkeit, die ganze Liste der Items wieder zu lernen. Mit einem Unterschied: die vergessene Items wurden zum Teil geändert. Bei einem späteren erneuten Test konnten die Probanden 78% der unveränderten Items und nur 43% der veränderten Items wiedergeben. Das Gedächtnis hatte sich so verhalten, als ob die unveränderten Items nicht ganz neu gewesen wären, also konnten diese Informationen nicht ganz verloren gegangen sein, obwohl sie bei dem ersten Test als vergessen erschienen. Das heißt aber längst nicht, daß sich die Menschen an alles erinnern können.
Sowie wir von Potenzgesetz des Lernens gesprochen haben, sprechen wir nun von Potenzgesetz des Vergessens. Die Funktion dieses Gesetzes zeichnet eine Kurve, die der von Ebbinghaus sehr ähnlich ist.
Das Vergessen (wie das Erinnern) ist negativ beschleunigt, d.h. man vergisst im Laufe der Zeit immer weniger (vgl. die Kurve von Ebbinghaus), bis die Kurve fast eine Linie wird, die den Wert 0 nach sehr langen Zeit trifft, nämlich wenn alles wird vergessen wird. Den Unterschied zwischen dem Potenzgesetz des Lernens und dem Potenzgesetzt des Vergessens wird von Anderson (1996: S. 198) in wenigen Worten erklärt. Er schreibt, daß Funktionen, die das Lernen darstellen, eine abnehmende Verbesserung der Behaltensleistung mit zunehmender Übung aufzeigen, während sich die Behaltenfunktionen für einen abnehmenden Verlust mit zunehmender Verzögerung charakterisieren.
Es gibt zwei Theorien, die versuchen, das Phänomen des Vergessens zu erklären: a) Die Zerfallstheorie; b) Die Interferenztheorie. Diese Theorien widersprechen sich nicht, sondern integrieren sich gegenseitig.
A. Die Zerfallstheorie
Die Erklärung wird hier bei den neuronalen Prozessen gesucht. Es wird nämlich angenommen, daß es eine Korrespondenz mit dem Potenzgesetz des Lernens gibt, indem sich die Langzeitpotenzierung (LPT - long- term potentiation = Anstieg der neuronalen Reaktionsbereitschaft als Funktion vorangehender elektrischer Stimulierung) in dem Phänomen des Vergessens negativ widerspiegelt.
Die Ergebnisse einer Untersuchung von Barnes (1979) zeigen, daß LPT mit zunehmender Verzögerung absinkt. Dieses Prozess läßt sich auch durch eine Potenzfunktion darstellen. Es gibt eine Korrespondenz zwischen auf neueronale Ebene und Verhaltensebene des Vergessens, die selbe Korrespondenz, die man bei den Lernfunktionen findet. Beim Vergessen kann man annehmen, daß die Stärke von Gedächtnisspuren im Laufe der Zeit sinkt.
B. Die Interferenztheorie
Diese Theorie widerspricht die Annahme, daß die Behaltensleistung eines Begriffes steigt, je mehr Fakten ich zu diesem Begriff lerne. Ein Experiment von Anderson zeigte 1974, daß genau das Gegenteil wahr ist.
Die Probanden sollten sich 26 Sätzen merken, die nach dem Muster „Eine Person befindet sich in einem Ort“ gebaut wurden. Einige Personen wurden mit nur einem Ort in dem Satz assoziiert, und einige Orte mit nur einer Person. Andere Personen wurden mit zwei Orten assoziiert und manche Orte mit zwei Personen. Die Probanden sollten die Sätze auswendig lernen, um sie eine Woche später möglichst schnell wiederzuerkennen. Die Ergebnisse zeigten, daß die Reaktionszeiten von der Anzahl von Fakten über eine Person oder über einen Ort abhingen. Zum Beispiel konnte man sich schneller an eine Person erinnern, die nur in einer Assoziation mit einem Ort vorkam, als an eine Person, die in zwei Assoziationen mit zwei verschiedenen Orten vorkam. Dieses Phänomen wurde Interferenzeffekt genannt.
Man hat schon in der AKT- Theorie Andersons gesehen, wie sich das Gedächtnis innerhalb eines Netzwerkes von Konzepten (die Knoten) bewegt. Genau mit der Idee eines solchen Netzwerkes hat man versucht, auch die Interferenzeffekten zu erklären: Wenn ich zu einer Knote aus verschiedenen Knoten (mehrere Fakten) statt aus einer einzigen Knote kommen muß, ist es klar, daß ich mehr Zeit dafür brauche (Fächereffekt).
Man hat sich gefragt, ob vorexperimentelle Gedächtnisinhalten auch zu Inferenzeffekten führen können. Auch dafür Belege gefunden.
In einem Experiment zeigten Lewis und Anderson 1976, daß die Probanden länger brauchten, um Sätze wiederzuerkennen, die mit bekannten Persönlichkeiten (zum Beispiel Napoleon Bonaparte) und deswegen mit entsprechenden bekannten Fakten (Napoleon war ein Kaiser) zu tun hatten, wenn man bei den Experimenten neue (falsche oder wahre) Fakten über diese Personen gelernt hatte.
Da man beim Schlafen nichts neues Lernen kann, hat man hypothesiert, daß man nachts langsamer vergißt, da es keine Interferenzen geben kann. Verschiedene Untersuchungen kommen zu dieser Schlußfolgerung.
Hockey, Davies und Gray (1972) zeigen aber, daß es nicht nur mit dem Schlafen zu tun hat. Sie wollten sehen, welche Tageszeit die beste Behaltensleistung beim Lernen verspricht. Die Probanden sollten einmal tagsüber schlafen und nachts lernen. Die Ergebnisse zeigten, daß das Material besser behalten werden kann, wenn dieses nachts gelernt wurde. Eigentlich ist es aber bewiesen, daß der frühe Abend die Periode der höchsten Aktivierung (zumindest bei Vordiplomstudenten) ist: das Material, das in solchen Tagesphasen gelernt wird, wird am Längste behalten.
4.1 Abruf und Inferenzen
Auch das, was man vergißt, ist mit einem Kontext von Erinnerungen verbunden. Es kann so passieren, daß man versucht, etwas über das Vergessene zu inferieren, durch andere Informationen, die noch im Gedächtnis behalten sind. Davon sind wir uns aber selten bewußt, da man glaubt, das Gelernte wiederzugeben, obwohl es in Wirklichkeit eine Schlussfolgerung war.
In einem Experiment von Bransford, Barclay und Franks (1972) sollten Probanden zwei ähnlichen Sätze lernen und nach eine bestimmte Zeit wiedererkennen, ob sie genau diese Sätze gelernt hatten. Die zwei Sätze, die man wiedererkennen sollte, wurden aber vor dem Test leicht geändert, so daß ein Satz als falsch erkannt werden sollte (bzw. er wurde in dieser Form nicht gelernt) und der andere zwar falsch war, aber mit einer Bedeutung, der in einem der gelernten Sätze implizit war. Dieser letzte Satz wurde viel häufiger dem gelernten Material zugeordnet als der erste. Die Probanden glaubten nämlich genau diesen Satz gelernt zu haben, obwohl es nicht wahr war.
Inferenzen finden aber nicht nur mit Material statt, die man im Labor gelernt hat. Wenn wir irgendeinen kurzen Text über irgendeine Person lernen würden, deren Name gleich einem Name einer berühmten Person wäre (z.B. Mozart), dann würde die Wahrscheinlichkeit hoch sein, daß wir nach einer Woche den Satz „Er war einen Musiker“ als gelernten Satz wiedererkennen würden, obwohl dieser Satz, in dieser Form, im gelernten Text nicht enthalten war.
Wenn man die Probanden des Experiments von Brandsford, Barclay und Franks nochmals später testen wurde, würde man merken, daß die Wiedererkennungsfehler, die zu Inferenzen deuten, mit der Verzögerung der Zeit steigen. Das heißt, daß je mehr vom tatsächlich Gelernte man durch die Zeitverzögerung vergißt, desto mehr Inferenzen erforderlich sind, um eine Rekonstruktion der Erinnerung zu ermöglichen.
Diese waren auch die Ergebnisse einer Untersuchung, die Sulin und Dooling 1974 durchführten. Aufgrund dieser Feststellungen unterscheiden wir nun zwischen bekannt und plausibel: Bekannt ist das, was man exakt wiedererkennen kann; Plausibel ist das, was hingegen durch Schlußfolgerungen festgestellt wird.
Reder bewies, daß was plausibel ist, viel länger im Gedächtnis behaltbar und abrufbar ist, als das, was bekannt ist. Bei einem seiner Experimente sollten Probanden einen Text lernen, um dann zu erkennen, ob drei verschiedenen Sätze in diesem Text enthalten waren: Der erste Satz war tatsächlich enthalten (deswegen bekannt); der zweite Satz war nicht enthalten, aber seine Bedeutung plausibel; der dritte Satz war weder bekannt noch plausibel.
Die Probanden wurden unter zwei verschiedenen Bedingungen getestet: einmal unter der Genauigkeitsbedingung (nur der erste Satz stimmte) und einmal unter der Plausibilitätsbedingung (die erste zwei Sätze stimmten).
Der Test wurden einmal 2 Minuten unmittelbar nach dem Lesen des Texts durchgeführt und einmal zwei Tagen später. Reder fand heraus, daß unter der Genauigkeitsbedingung die Reaktionszeiten für eine richtige Antwort mit der Zeitverzögerung stiegen, während unter der Plausibilitätsbedingung sanken.
Er behauptete deswegen folgendes: während für eine genaue Wiedererkennung eine exakte Gedächtnisspur nötig ist, ist ein Plausibilitätsurteil nicht von einer einzigen Gedächtnisspur abhängig. Das ist der Grund, deswegen er nicht so anfällig für das Vergessen ist. Mit der Testverzögerung werden die Probanden schneller unter der Plausibilitätsbedingung, weil sie nicht mehr versuchen, die exakte Informationen abzurufen, sondern direkt einen Plausibilitätsurteil heranziehen.
Schon oben hatte man davon gesprochen, daß man je mehr Fakten über eine Person oder einen Ort lernen muß, desto länger dauert, ein einziger Item über die Person bzw. den Ort wiederzuerkennen. In einer Untersuchung von 1983 zeigten Reder und Ross, daß dieses nur unter der Genauigkeitsbedingung gilt, während unter der Plausibilitätsbedingung genau das Gegenteil stimmt: je mehr Informationen man gelernt hat, desto schneller wird man dann einen Plausibilitätsurteil angeben können.
Der Unterschied zwischen bekannt und plausibel und die beschriebenen Ergebnissen der Experimenten führen auch zu anderen konkreten Schlußfolgerungen, die auch belegt wurden. Falsche Behauptungen sind in der Werbung zwar gesetzlich verboten, aber wenn man die Zuschauer nach einer Werbung fragen würde, ob das Produkt X wirklich hilft, irgendeines Ziel zu erreichen, wird man meistens die Antwort ‚Ja‘ bekommen, obwohl diese Behauptung in der Werbung nicht aufgestellt ist und darf. So passierte 1977 in einem Experiment von Harri
Owens, Bower und Black haben 1979 beweisen wollen, daß eigene Elaborationen nicht nur das Lernen erleichtern, sondern auch das Abrufen von Gedächtnisinhalten. In einem Experiment sollten Probanden eine Geschichte lesen, die einen Tag des Lebens einer Studentin beschrieb. Die Geschichte erschien so von ganz neutraler Bedeutung zu sein. Ein Teil der Probanden (die sogenannte Themengruppe) hatte aber zu Beginn des Experiment bereits das Ende der Geschichte vorgelegt bekommen, das die neutrale Handlung der Geschichte in eine ganz andere und viel interessantere Licht stellte. Nach 24 Stunden wurden die Probanden gebeten, die Geschichte wiederzugeben. Die Themengruppe konnte sowohl mehr gelernte als auch mehr inferierte Präpositionen über die Geschichte wiedergeben, als die Gruppe, die nur den neutralen Teil der Geschichte gelesen hatte. Durch das ‚interessante‘ Ende hatte sich die Themengruppe mehr Gedanken (Elaborationen) über die ‚neutrale‘ Geschichte gemacht, als die andere Gruppe.
Auch Schemata spielen eine wesentliche Rolle nicht nur bei der Elaboration der Inhalte während des Lernens, sondern auch bei der Rekonstruktion der Inhalte beim Abruf. In einem Experiment von Barlett (1932) sollten englische Probanden eine Geschichte vorlesen, die aus der amerindischen Kultur abstammt. Wenn man auch Nach einer bestimmten Zeit wurden diese Probanden gebeten, die Geschichte schriftlich wiederzugeben. Da die Geschichte auf ganz andere kulturelle Schemata basierte, die in der englischen Kultur nicht existierten, ließen die Probanden oft einen Teil der ursprünglichen Geschichte weg, zahlreiche Einzelheiten wurden geändert und neue Informationen hinzugefügt. Barlett konzentrierte sich auf die Ähnlichkeiten unter den Verhaltensweisen der Probanden und erfuhr, daß alle Probanden hatten die Änderungen genutzt, um die Geschichte mit ihren eigenen kulturellen Stereotypen übereinstimmen zu lassen.
4.2 Abruf und Assoziative Strukturen
Eine Person braucht weniger Zeit, um eine Wortliste (z.B. Hund, Katze, Pferd...) zu lernen, wenn man ihr die Kategorie nennt, zu der diese Worte gehören (z.B. Säugetier). Die Organisation der Informationen und die Assoziationen (in und unter den Informationen) vereinfachen nicht nur das Lernen, sondern auch den Abruf und die Reproduktion. In einem Experiment von Bower, Clark, Lesgold und Winzenz (1969) sollten zwei Gruppen von Probanden eine Wortliste lernen, mit dem Unterschied, daß die Worte der Liste der ersten Gruppe in Kategorien gruppiert waren, während die der Liste der zweiten Gruppe zwar unter Kategorie standen, aber nicht unbedingt dazu gehörten. Ergebnis beim Test: die erste Gruppe konnte viel mehr von den gelernten Worte reproduzieren, als die zweite.
Wie diese Wortliste läßt sich auch normales Lernmaterial hierarchisch organisieren. Diese Organisation des Lernmaterials ist eine Lerntechnik, die das Behalten und Abrufen der Informationen erleichtert. Theoretisch könnte das Inhaltsverzeichnis eines Buches gut dazu dienen.
Eine besondere Art der Organisation des Lernmaterials ist die Methode der Orte, eine Methode, die schon in der Antike bekannt war. Um das Lernen und die Reproduktion des Materials nochmals zu vereinfachen, assoziiert man Teile des Material an ideellen Stationen, die sich auf einem gut bekannten Weg befinden, z.B. auf dem Weg, der von der eigenen Wohnung zur Universität führt. Wenn man das gelernte Material abrufen möchte, sollte man erst z.B. an die eigene Wohnung denken, um sich dann an den damit assoziierten gelernten Text zu erinnern, das so wiedergeben werden kann. Und so weiter mit der Bäckerei auf der anderen Seite der Strasse, usw..
Empfehlenswert wäre die Assoziationen möglichst kreativ zu gestalten, so daß das Lernmaterial in seiner Station einen richtigen Kontext hat. Die Verbindungen zwischen den beiden Elementen sollten dadurch vermehrt werden.
Diese Methode hilft auch, Reden oder Vorträge zu halten.
Die Forscher der Kognitive Psychologie haben auch über eine andere Hypothese recherchiert: Der Abruf von gelernten Informationen sollte einfacher fallen, wenn der Kontext, in dem man sich befindet, ähnlich wie der der Lernsituation ist. Die Kontexteffekte werden auch Effekte des Enkodierkontext genannt.
Experimente haben belegt, daß Informationen über einen Ort besser am Ort selber gelernt werden. Selbst wenn die Bedeutung des Material nicht mit dem Ort verbunden ist, spielt der Kontext eine Rolle. In einem Experiment sollten Probanden einmal Wortlisten unter Wasser lernen, und einmal am Ufer. Als sie getestet wurden, waren die bessere Wiedererkennungsleistungen dort, wo sie die Liste gelernt hatten.
Untersucht wurde auch die Möglichkeit, daß der emotionalen Kontext eine Rolle spielt. In der Tat fand man aus, daß man bessere Gedächtnisleistungen hatte, wenn die Stimmung eine Geschichte mit der positiven oder negativen Stimmung der Person, die sie lernen sollte, stimmte (Stimmungskongruenz).
Das Phänomen des sogenannten zustandsabhängigen Lernens zeigt, daß dieser Effekt auch bei dem Abruf der gelernten Informationen gilt. Experimente haben bewiesen, daß wenn man Wortlisten beim Rauchen gelernt hat, kann man diese Listen am Bestem abrufen, wenn man wieder raucht (Eich, Weingartner, Stillman und Gillin, 1975). Das heißt aber nicht, daß das Rauchen bessere Gedächtnisleistungen erbringt.
Um es besser zu erleuchten, nennen wir die bekannten Fälle über Alkoholiker, wo man behauptet, ihr Gedächtnis würde zwei getrennte Leben führen: ein Leben im nüchternen Zustand und einem in betrunkendem Zustand. Ein Alkoholiker kann sich manchmal an Sachen erinnern, die in einem oder in dem anderen Zustand passiert sind, nur wenn er sich in dem selben Zustand befindet.
Zum Schluß befassen wir kurz mit dem Prinzip der Enkodierungsspezifität (Tulving, 1975), die Definition von Anderson (1996: S. 225) zitierend:
Die Gedächtnisleistung für Wörter steigt, wenn diese Wörter im Kontext derselben Wörter getestet werden, in dem sie ursprünglich gelernt wurden.
Wenn man das Wort Blau lernen sollte, würde es von Vorteil sein, wenn das Wort in Assoziation mit dem Wort Himmel stehen würde. So wurde den Abruf des Wortes durch einen Kontext von Informationen vereinfacht, der sich mit Himmel befasst. Dieser Beispiel ist sehr einfach, aber gilt auch für komplexeres Lernmaterial.
5. Schlußwort
In dieser kurzen Arbeit erkennt man nicht nur, wie sehr Gedächtnis und Lernen voneinander abhängen, sondern auch die besondere Vorgehensweise der Kognitive Psychologie in ihrer Forschung.
Darüber fand ich die Einführung von Lefrancois zu dem Kapitel „Gedächtnis und Aufmerksamkeit“ seines Buches „Psychologie des Lernens“ sehr interessant:
Wie wir mehrmals gesehen haben, ist die kognitive Psychologie metaphorischer Art. Sie versucht die großen Komplexitäten der menschlichen kognitiven Funktionen nicht so sehr dadurch zu verstehen, daß sie die exakten Mechanismen entdeckt und Strukturen und Funktionen in den Vordergrund stellt, sondern sie erfindet sehr zwingende und nützliche Metaphern, um diese Funktionsweise zu beschreiben. Schießlich wird der Wert einer Metapher aber danach beurteilt, wie gut sie die Fakten reflektiert. Daher kommt es, daß die Suche nach Metaphern auf den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung fußt. Wenn wir unseren Fakten nicht trauen können, wie können wir dann unseren Methaphern trauen oder uns auf sie verlassen? (Lefrancois, 1986: S. 159).
Literatur
- Anderson, John R., Kognitive Psychologie, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 1996 (Kapitel 6 und 7).
- Lefrancois, Guy R., Psychologie des Lernens, Berlin- Heidelberg: Springer Verlag, 1986 (Kapitel 7 und 11).
- Weltgesundheitsorganisation, ICD 10, Göttingen: Huber Verlag, 1993.
Ehrenwörtliche Erklärung
Hiermit erkläre ich, daß ich diese Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel ( Literatur) verwendet habe.
Düsseldorf, den 25. 10. 1999 Davide Brocchi
[...]
1 Lefrancois, Guy R., Psychologie des Lernens, Berlin- Heidelberg: Springer Verlag, 1986 (S. 159).
2 Siehe zum Beispiel: Anderson, J. R.. Languages, memory and thought; Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1976; Cohen, N.J. & Squire, L. R.. Preserved learning and retention of pattern analyzing skills in amnesia: Di ssociation of knowing how and knowing that. In: Science, S. 207- 210, 210/1980; Schacter, D.L.. Implicit memory: History and current status. In: Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, S. 501- 518, 13/1987.
3 Quelle: Anderson, John R., Kognitive Psychologie, Heidelberg: Sprektrum Akademischer Verlag, 1996 (S. 167).
4 Lefrancois, Guy R., Psychologie des Lernens. Berlin- Heidelberg: Springer Verlag, 1986 (S. 166)
5 Anderson, John R., Kognitive Psychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 1996 (S. 171).
6 Anderson, John R., Kognitive Psychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 1996 (S. 178).
7 Lefrancois, Guy R., Psychologie des Lernens. Berlin- Heidelberg: Springer Verlag, 1986 (Kapitel 11)
8 Quelle der Grafik: Anderson, John R., Kognitive Psychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 1996 (S. 180).
9 Anderson, John R., Kognitive Psychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 1996 (S. 186).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das explizite Gedächtnis im Gegensatz zum impliziten Gedächtnis?
Explizites Wissen ist bewusst und kann berichtet werden, während implizites Wissen unbewusst ist, obwohl es vorhanden ist. Ein Beispiel für explizites Wissen ist ein auswendig gelerntes Gedicht, während ein Beispiel für implizites Wissen die Fähigkeit einer Schreibkraft ist, schnell zu tippen, ohne sich bewusst an die Position jeder Taste zu erinnern.
Wie unterscheidet sich das Gedächtnis von Amnesie-Patienten von dem gesunder Menschen?
Amnesie-Patienten, insbesondere solche mit dem Korsakoff-Syndrom, können Dissoziationen zwischen implizitem und explizitem Wissen aufweisen, die bei gesunden Menschen selten sind. Sie können Schwierigkeiten mit dem expliziten Gedächtnis haben, aber implizite Gedächtnisleistungen beibehalten.
Was hat Hermann Ebbinghaus in seinen Gedächtnisexperimenten herausgefunden?
Ebbinghaus entdeckte, dass das Vergessen schnell nach dem Lernen erfolgt und sich dann verlangsamt. Er stellte auch fest, dass Überlernen die Behaltensleistung verbessert und dass es weniger Zeit braucht, Material erneut zu lernen, das zuvor gelernt und vergessen wurde.
Was ist die Theorie des Kurzzeitgedächtnisses und warum wurde sie in Frage gestellt?
Die Theorie des Kurzzeitgedächtnisses besagt, dass Informationen vor dem Übergang ins Langzeitgedächtnis eine gewisse Zeit im Kurzzeitgedächtnis verweilen müssen. Craik und Lockhart stellten dies in Frage und argumentierten, dass die Verarbeitungstiefe wichtiger ist als die Dauer des Memorierens.
Was ist das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley?
Baddeley schlägt vor, dass das Arbeitsgedächtnis aus einer artikulatorischen Schleife, einem räumlich-visuellen Notizblock und einer zentralen Exekutive besteht, die diese Systeme koordiniert. Die Aufnahmekapazität wird durch die Verarbeitungsgeschwindigkeit bestimmt.
Wie beeinflusst die Aktivationshöhe Gedächtnisinhalte?
Die Aktivationshöhe bestimmt die Wahrscheinlichkeit des Zugriffs auf das Gedächtnis und wird durch den Zeitabstand seit dem letzten Abruf und den Übungsgrad beeinflusst. Die Aktivation kann sich entlang der Pfade eines Netzwerks von Konzepten ausbreiten.
Was bedeutet der Begriff Stärke in Bezug auf Gedächtnisspuren?
Stärke bezieht sich auf die Tiefe einer Gedächtnisspur, die sich mit jeder Nutzung erhöht. Übung stärkt Gedächtnisspuren, aber der Zuwachs nimmt mit zunehmender Übung ab (Potenzgesetz des Lernens).
Wie beeinflusst die Verarbeitungstiefe die Gedächtnisleistung?
Eine bedeutungshaltige und elaborative Verarbeitung der Informationen ist wichtig für die Steigerung der Gedächtnisleistung. Selbst generierte Inhalte werden besser erinnert als vorgegebene.
Ist die Absicht zu lernen wichtig für die Gedächtnisleistung?
Nein, die Art und Weise, wie das Material verarbeitet wird, ist wichtiger als die Absicht zu lernen. Inzidentelles Lernen (ohne Absicht) kann genauso effektiv sein wie intentionales Lernen, wenn eine tiefe Verarbeitung stattfindet.
Was ist die SQ3R- bzw. PQ4R-Methode?
Dies sind Lernmethoden, die darauf abzielen, den zu lernenden Text zu "befragen", um die Inhalte tiefer zu verarbeiten und die Behaltensleistung zu verbessern. Sie beinhalten das Definieren der Themen, das Formulieren von Fragen und das Beantworten dieser Fragen.
Was sind die Zerfalls- und Interferenztheorien des Vergessens?
Die Zerfallstheorie besagt, dass Gedächtnisspuren im Laufe der Zeit schwächer werden. Die Interferenztheorie besagt, dass andere Gedächtnisinhalte das Abrufen bestimmter Informationen beeinträchtigen können.
Was sind Inferenzen im Zusammenhang mit dem Gedächtnis?
Inferenzen sind Schlussfolgerungen, die wir über das Vergessene ziehen, basierend auf anderen Informationen, die im Gedächtnis behalten werden. Wir können uns irrtümlich an Inferenzen erinnern, als wären sie tatsächlich gelernte Inhalte.
Was ist der Unterschied zwischen bekannt und plausibel im Gedächtnisabruf?
Bekannt ist das, was man exakt wiedererkennen kann, während plausibel das ist, was durch Schlussfolgerungen festgestellt wird. Plausibel ist tendenziell länger im Gedächtnis behaltbar als bekannt.
Wie beeinflussen Schemata den Abruf von Gedächtnisinhalten?
Schemata (mentale Rahmen) erleichtern nicht nur die Elaboration von Inhalten während des Lernens, sondern auch die Rekonstruktion der Inhalte beim Abruf. Probanden neigen dazu, Informationen an ihre bestehenden Schemata anzupassen.
Wie beeinflussen assoziative Strukturen und Kontexteffekte den Gedächtnisabruf?
Die Organisation von Informationen und die Assoziationen (in und unter den Informationen) vereinfachen nicht nur das Lernen, sondern auch den Abruf und die Reproduktion. Der Kontext, in dem man lernt, kann auch den Abruf beeinflussen (Enkodierkontext-Effekte).
Was ist das Prinzip der Enkodierungsspezifität?
Die Gedächtnisleistung für Wörter steigt, wenn diese Wörter im Kontext derselben Wörter getestet werden, in dem sie ursprünglich gelernt wurden. Die Wiedererkennung wird besser, wenn die Hinweisreize denen ähneln, die bei der Enkodierung vorhanden waren.
- Arbeit zitieren
- Davide Brocchi (Autor:in), 1999, Das explizite Gedächtnis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101684