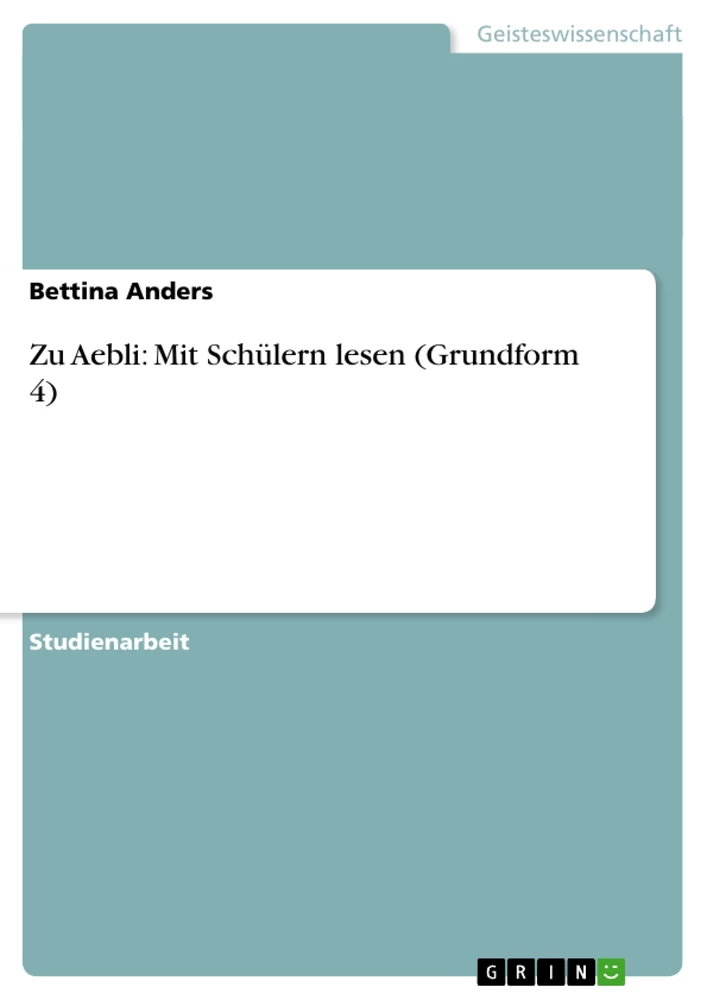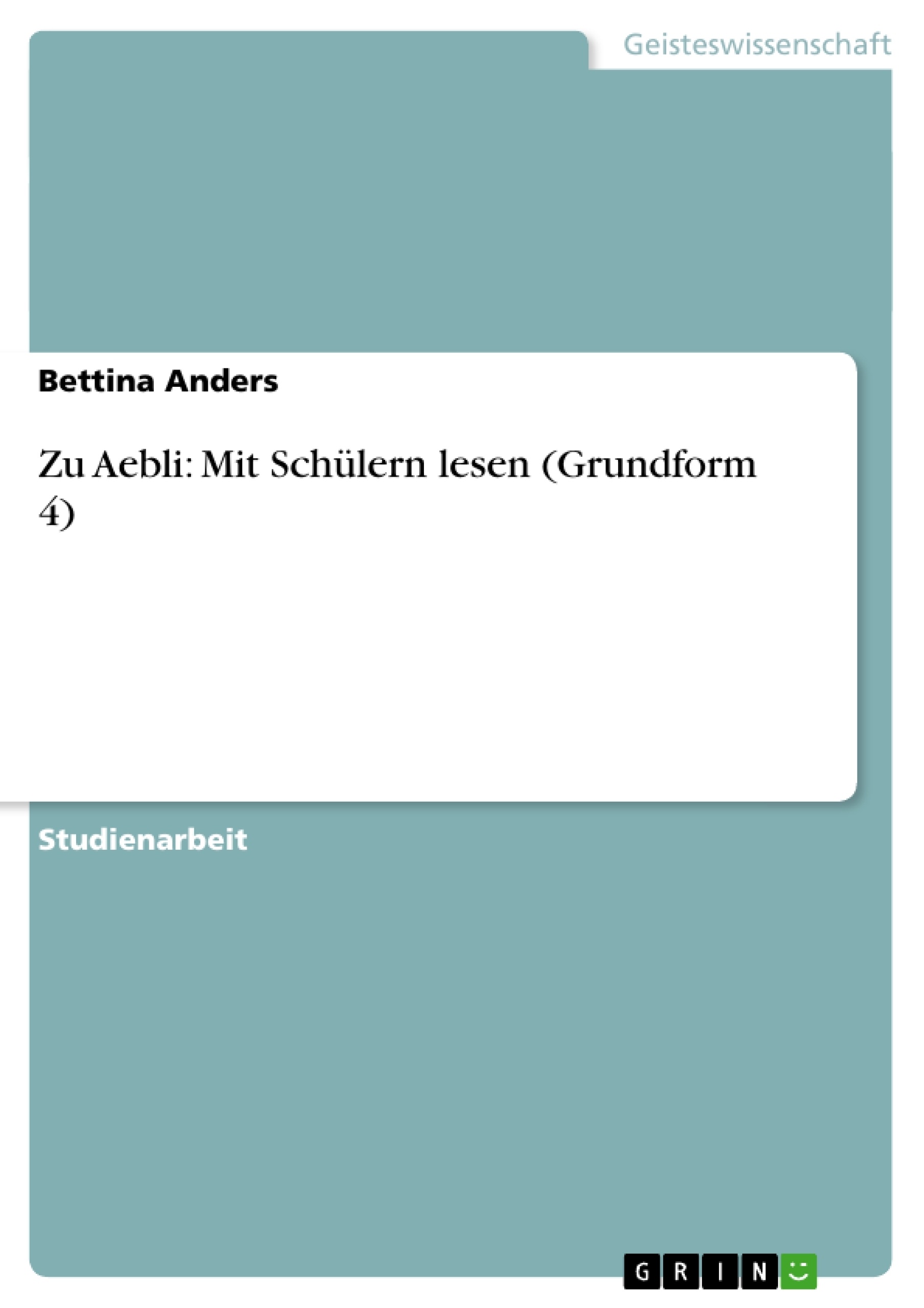Aebli fordert, daß im Leseunterricht ein neues Gleichgewicht zwischen
schöngeistiger und realistischer Literatur gefunden werden soll.1 In den von ihm als „Realfächer“2 bezeichneten Unterrichtsfächern soll fach- und problembezogene Fachliteratur („realistisches Lesen“3) gelesen werden. Dagegen soll im Deutschunterricht sollen die Schüler die Fähigkeiten der Textarbeit an schöngeistiger aber auch an realistischer Lektüre erwerben.
[...]
1 vgl. Aebli, Hans: Zwölf Grundformen des Lehrens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der Lernzyklus. Stuttgart: Klett-Cotta, 10. Auflage 1998, S. 131
2 Aebli, Hans. S. 131
Inhaltsverzeichnis
- Zum Umgang mit Texten anleiten
- In den Text eindringen
- Lesen im Rahmen umfassender Unterrichtseinheiten
- Die Lesemotivation ist nicht allein von der Art der Texterschließung abhängig, deshalb muß das Lesen eine Funktion erhalten.
- Textverarbeitung im Unterricht
- Überlegungen zur Vorbereitung der Lektüre
- Zur Praxis des Lesens mit Klassen
- Zusammenfassen und Interpretieren
- Die Integration der Deutung in das Wissen des Schülers
- Die Wiedergabe von Texten
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der didaktischen Umsetzung des Lesens im Unterricht, insbesondere basierend auf den Prinzipien von Hans Aebli. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Fähigkeiten zur aktiven Auseinandersetzung mit Texten, sowohl in der Literatur als auch in Fachbereichen.
- Die Bedeutung von Textverständnis und -analyse im Unterricht
- Die Relevanz von "realistischem Lesen" in verschiedenen Fächern
- Die Rolle der Lesemotivation und des aktiven Eingangs in den Text
- Verschiedene Methoden der Textverarbeitung im Unterricht
- Die Integration von neuem Wissen in das Vorwissen der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Bedeutung der Auseinandersetzung mit Texten im Unterricht und die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen schöngeistiger und realistischer Literatur zu finden.
Das zweite Kapitel beschreibt die Bedeutung des aktiven Eingangs in den Text. Aebli betont die Notwendigkeit, den Sinngehalt eines Textes zu verstehen, indem man die Textzusammenhänge und Sachstrukturen analysiert.
Im dritten Kapitel wird das Lesen im Kontext umfassender Unterrichtseinheiten betrachtet. Dabei geht es um die Frage, wie das Lesen eine Funktion im Unterricht erhält und wie man die Lesemotivation steigern kann.
Kapitel vier beschäftigt sich mit der Textverarbeitung im Unterricht. Es werden verschiedene Methoden vorgestellt, die den Schülern helfen sollen, ein Methodenbewußtsein und die entsprechenden Fertigkeiten zu erwerben.
Im fünften Kapitel werden Überlegungen zur Vorbereitung der Lektüre angestellt. Der Lehrer sollte sich vor der Behandlung eines Textes mit dem Ziel und dem mutmaßlichen Ertrag der Lektüre auseinandersetzen.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der Praxis des Lesens mit Klassen. Es wird die Bedeutung des stillen Lesens betont und verschiedene Ansätze für das laute Vorlesen in der Klasse vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Didaktik des Lesens, insbesondere die Grundformen des Lehrens nach Aebli, Textverständnis, Textanalyse, Lesemotivation, Textverarbeitung im Unterricht und die Integration von neuem Wissen in das Vorwissen der Schüler. Der Schwerpunkt liegt auf der aktiven Auseinandersetzung mit Texten und der Entwicklung von Fähigkeiten, die Schülern helfen, Texte kritisch zu analysieren und zu interpretieren.
Häufig gestellte Fragen
Was fordert Hans Aebli für den Leseunterricht?
Aebli fordert ein neues Gleichgewicht zwischen schöngeistiger Literatur und "realistischem Lesen", also der Arbeit mit Sachtexten in Fachfächern.
Wie sollen Schüler laut Aebli in einen Text "eindringen"?
Schüler sollen den Sinngehalt erfassen, indem sie Textzusammenhänge und Sachstrukturen aktiv analysieren und den Text in ihr eigenes Wissen integrieren.
Warum muss Lesen im Unterricht eine "Funktion" haben?
Die Lesemotivation steigt, wenn das Lesen in umfassende Unterrichtseinheiten eingebettet ist und einem konkreten Zweck dient, anstatt isoliert stattzufinden.
Welche Rolle spielt das stille Lesen im Vergleich zum lauten Vorlesen?
Aebli betont die Bedeutung des stillen Lesens für das Verständnis, während das laute Vorlesen gezielt zur Übung der Wiedergabe und Interpretation genutzt werden sollte.
Wie bereitet ein Lehrer die Lektüre eines Textes optimal vor?
Der Lehrer muss sich vorab über das Ziel der Lektüre und den mutmaßlichen Ertrag für die Schüler klar werden, um die Texterschließung methodisch sinnvoll zu planen.
- Arbeit zitieren
- Bettina Anders (Autor:in), 2000, Zu Aebli: Mit Schülern lesen (Grundform 4), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10162