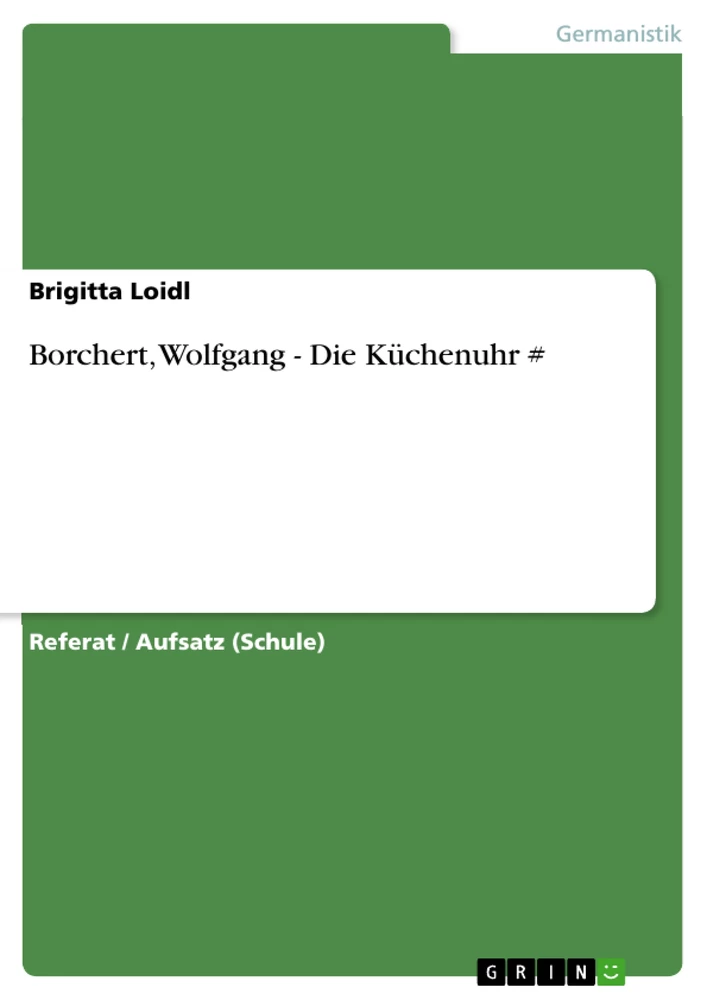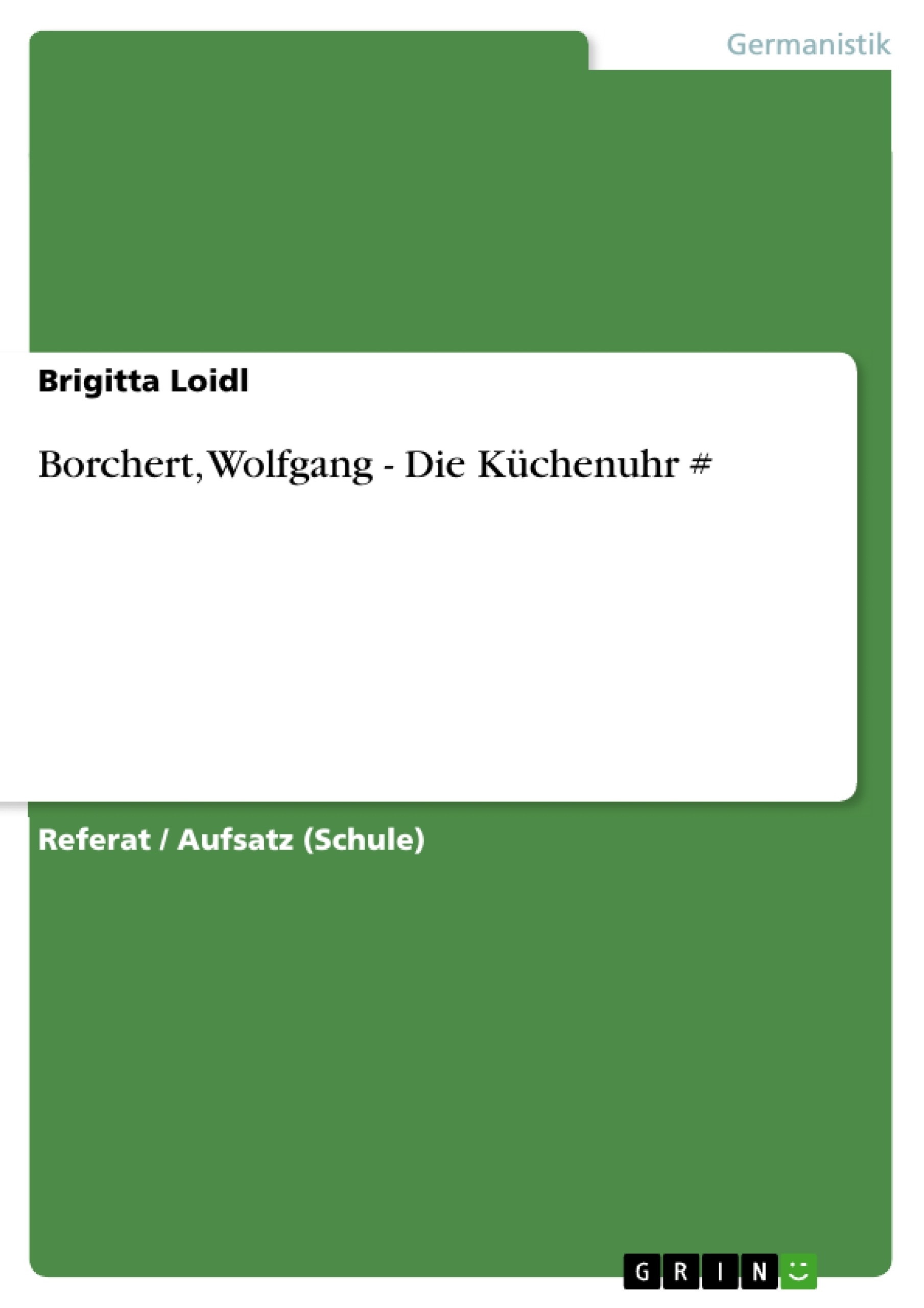Was bleibt, wenn alles verloren ist? In Wolfgang Borcherts ergreifender Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“ begegnet der Leser einem jungen Mann, dessen Gesicht die Narben des Krieges trägt, obwohl er erst zwanzig Jahre alt ist. Er sitzt auf einer Parkbank, inmitten von Fremden, und zeigt ihnen stolz ein unscheinbares Objekt: eine alte Küchenuhr. Diese Uhr, äußerlich schlicht und innerlich zerbrochen, ist für ihn mehr als nur ein Zeitmesser; sie ist das letzte Fragment einer verlorenen Welt, ein greifbares Andenken an eine unbeschwerte Vergangenheit, die im Bombenhagel des Krieges unterging. Die Uhr ist stehengeblieben, genau um halb drei Uhr nachts, jene Zeit, zu der er einst von der Arbeit nach Hause kam und von seiner Mutter mit Wärme und Geborgenheit empfangen wurde. Diese Erinnerung, das abendliche Brot und die liebevolle Fürsorge seiner Mutter, erscheint ihm nun, nach dem Verlust seiner Familie und seines Zuhauses, wie ein fernes Paradies. Borchert fängt die Trostlosigkeit der Trümmerliteratur in knappen, eindringlichen Sätzen ein und thematisiert die Nachkriegszeit mit all ihren seelischen Wunden. Die Küchenuhr wird zum Symbol für die Zerrissenheit einer Generation, die nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Unschuld verloren hat. Die Geschichte berührt universelle Themen wie Verlust, Erinnerung und die Sehnsucht nach Geborgenheit. Sie regt zum Nachdenken über die Bedeutung von vermeintlich wertlosen Gegenständen an, die als Hüter unserer persönlichsten Erinnerungen fungieren können. Die eindringliche Schilderung der inneren Welt des jungen Mannes, seine Freude an der Erinnerung, trotz des Schmerzes über den Verlust, macht diese Kurzgeschichte zu einem bewegenden Zeugnis der menschlichen Widerstandsfähigkeit in den dunkelsten Stunden. Ein Muss für alle Liebhaber der deutschen Nachkriegsliteratur und für Leser, die sich von Geschichten berühren lassen wollen, die von den einfachen Dingen des Lebens und der Kraft der Erinnerung erzählen. Entdecken Sie mit Borchert die stille Ironie des Lebens und die Bedeutung, die wir den kleinen Dingen beimessen, die uns Halt geben, wenn die Welt um uns herum in Trümmern liegt. Lassen Sie sich von der schlichten Schönheit und der tiefen emotionalen Wirkung dieser zeitlosen Erzählung verzaubern.
Brigitta Loidl
Wolfgang Borchert
Die Küchenuhr
Wolfgang Borchert wurde am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren und trat nach einer Buchhändlerlehre als Schauspieler in Lüneburg auf. Im 2. Weltkrieg schwer verwundet, wurde er zunächst entlassen, dann aber aufgrund kritischer Äußerungen inhaftiert und wegen „Wehrkraftzersetzung” zum Tod verurteilt. Danach musste er zur „Bewährung“ an die Ostfront. Nach dem Krieg arbeitete Borchert als Regieassistent und als Kabarettleiter am Hamburger Schauspielhaus. Er starb am 20. November 1947 während eines Kuraufenthalts in Basel.
Mit seinem zum Drama umgearbeiteten Hörspiel „Draußen vor der Tür“ wurde er schnell als ein Vertreter der desillusionierten Kriegsgeneration anerkannt (Trümmerliteratur). Auch Borcherts Lyrik ist gekennzeichnet von Schwermut und Hoffnungslosigkeit ( Laterne, Nacht und Sterne). In seinen Erzählbänden „An diesem Dienstag“ (1947), „Die Hundeblume“ (1947) und „Die traurigen Geranien und andere Geschichten aus dem Nachlaß“ findet man ebenfalls die Grausamkeit des Krieges sowie das Elend der Nachkriegszeit.
Kennzeichnend für seine Kurzgeschichten ist seine knappe aber präzise und eindringliche Sprache.
In der Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“ thematisiert Wolfgang Borchert die Nachkriegszeit in seiner bekannten kurzen Form. In Prosa und knappen Sätzen beschreibt der Autor einen Mann, der sich auf eine Parkbank zu anderen setzt, ihnen seine Küchenuhr zeigt und die Geschichte erzählt, die er damit verbindet. Der Mann ist erst zwanzig Jahre alt, aber der Krieg dürfte in seinem Gesicht Spuren hinterlassen haben, die ihm jetzt schon „ein ganz altes Gesicht“ verleihen (Zeile 2). Die „Küchenuhr“, die er den Leuten zeigt, die sich die Parkbank mit ihm teilen, ist in der Geschichte wohl ein Symbol für den jungen Mann selbst, der, so wie auch die Küchenuhr, im Zerfall begriffen ist. Der Krieg hat vieles zerstört, und das einzige, was diesem jungen Mann noch geblieben ist, ist eine alte, kaputte Küchenuhr („Innerlich ist sie kaputt“, Zeile 13). Der junge Mann weiß, dass seine Uhr keinen Wert mehr hat, zumindest keinen materiellen Wert (Sie hat keinen Wert mehr..., das weiß ich auch, Zeile 9), aber sie erinnert ihn an die Vergangenheit. Wenn er sie ansieht denkt er jedoch nicht an die Bomben, die sie zerstörten, wie man annehmen würde, denn einer der anderen auf der Parkbank sitzenden Menschen, spricht ihn darauf an (Zeile 30), aber der junge Mann meint, die Küchenuhr erinnere ihn an besseren Zeiten, als er noch bei seiner Mutter lebte. Die Uhr ist nämlich „um halb drei stehen geblieben“ (Zeile 28), genau zu der Uhrzeit ,zu der er früher immer nachts von der Arbeit heimkam. Seine Mutter machte ihm dann immer noch das Abendbrot warm und wartete bis er aufgegessen hatte (Zeile 50). Für ihn war es damals selbstverständlich, dass seine Mutter das jede Nacht für ihn tat (Zeile 55/56). Nach dem Tod seiner Eltern ist ihm jedoch bewusst geworden, dass es damals das „Paradies“ war ( „Jetzt, jetzt weiß ich, dass es das Paradies war“, Zeile 63).
Obwohl der Mann diese Geschichte eigentlich seinen Sitznachbarn erzählt, redet er doch bloß mit seiner Uhr, denn „dann sagt er der Uhr leise ins weißblaue runde Gesicht“. Der Leser bekommt das Gefühl, dass der Mann zunächst eigentlich mehr Selbstgespräche mit führt als eine Unterhaltung mit den Menschen in seiner Umgebung. Während er seine Küchenuhr beschreibt, sehen ihn die anderen nicht an (Zeile 18). Nur ein paar Mal wird seine Erzählung unterbrochen von Zwischenfragen, Menschen von denen man aber das Gefühl hat, sie fragen mehr aus Höflichkeit als aus Interesse und Neugier. Erst am Schluss der Kurzgeschichte erkennt der Leser, dass die Menschen dem jungen Mann doch zugehört haben mussten, zumindest einer, denn jener „Mann, der neben ihm saß, sah auf seine Schuhe. Aber er sah seine Schuhe nicht. Er dachte immerzu an das Wort Paradies.“ Ab diesem Zeitpunkt kann der Leser annehmen, dass die Zuhörer auf der Parkbank kein Desinteresse an der Geschichte hatten, sondern nur selbst ins Nachdenken kamen, durch die erneute Konfrontation mit dem Krieg.
Über die Zuhörer auf der Parkbank erfährt der Leser sehr wenig. Diese Anonymität der Personen ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass diese Kurzgeschichte jedem passieren könnte beziehungsweise, dass jeder Zuhörer dieser Geschichte werden kann, wie es der Leser in diesem Fall auch wird. Die Personen auf der Bank stehen also in keiner bestimmten Beziehung zum Erzähler, woraus man schließen kann, dass dieser sehr verzweifelt sein muss, wenn er einfach so mit fremden Leuten über seine eigentlich intime Geschichte zu sprechen beginnt. Vielleicht hat er aber auch nur den Drang verspürt, nach den langen Jahren des Schweigens während des Krieges endlich wieder zu sprechen.
Genauso wie die Personen bleiben auch Ort und Zeit des Geschehens ungenannt, wieder ein Hinweis darauf, dass die Kurzgeschichte zu jeder Zeit und an einem beliebigen Ort spielen kann. Der Autor Wolfgang Borchert beschränkt sich also auf den Inhalt der Erzählung und spart jegliche Bildhaftigkeit, Darstellung der Umgebung und der Personen aus, mit Ausnahme der Hauptperson, deren Gesicht und Gang gleich zu Beginn kurz beschrieben werden (Zeilen 1 und 2).
Auffallend ist auch, dass der Text ohne Einleitung steht. Borchert geht also gleich „zur Sache“ und erspart sich lange Beschreibungen. Die Wortwahl und der Satzbau sind einfach, ohne verschachtelte lange Sätze und Fremdwörter.
Borchert praktiziert meist zeitdeckendes Erzählen, er ist also recht ausführlich in seinen Schilderungen, denn die Szene (wie auch das Lesen) dauert nur wenige Minuten. Er verwendet oft direkte Reden, die er jedoch nie unter Anführungszeichen setzt und die somit nahtlos in die Erzählung einfließen.
Der Autor verwendet das auktoriale Erzählverhalten, begrenzt seine Informationen über das Geschehen und die Mitwirkenden jedoch stark, genaugenommen gibt es eigentlich keine Handlung.
Das Wichtigste wiederholt Borchert immer wieder, zum Beispiel die Aussage, dass die Uhr um halb drei stehengeblieben ist (Zeilen 27-29, 35-37, 42, 54/55, 69). Weiters wird der Satz „Sie ist übrig geblieben“ wiederholt, manchmal auch ein wenig abgewandelt (Zeile 6/7, 16, 20/21, 68). Auch der Erzähler, der junge
Mann wiederholt sich in seinen Erzählungen ständig, als würde er sich selbst immer wieder bestätigen wolle, wie schön es früher war.
Mit der beschriebenen Küchenuhr wird in dieser Kurzgeschichte nicht nur die starke Verbindung zwischen Personen und Gegenstand und den daraus resultierenden Erinnerungen dargestellt, sondern es verdeutlicht auch, dass ein jeder Tag und seine Gewohnheiten immer wieder etwas Besonderes sind, welches man allerdings erst erkennt, wenn sie einem fehlen. Die Küchenuhr bedeutet für den Mann die Erinnerung an sein früheres Leben im Kreis der Familie, er hält sich krampfhaft an ihr fest. Sie ist ein Symbol einer Vergangenheit, die ihm angesichts der trostlosen Gegenwart wie das „Paradies“ vorkommt.
Häufig gestellte Fragen zu Wolfgang Borchert - Die Küchenuhr
Wer war Wolfgang Borchert?
Wolfgang Borchert war ein deutscher Schriftsteller und Schauspieler, geboren am 20. Mai 1921 in Hamburg. Er gilt als wichtiger Vertreter der Trümmerliteratur, einer literarischen Strömung der Nachkriegszeit. Er starb am 20. November 1947 in Basel.
Was ist die Trümmerliteratur?
Die Trümmerliteratur ist eine literarische Bewegung, die sich mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit auseinandersetzt, insbesondere mit den materiellen und moralischen Zerstörungen.
Worum geht es in der Kurzgeschichte "Die Küchenuhr"?
In der Kurzgeschichte "Die Küchenuhr" thematisiert Wolfgang Borchert die Nachkriegszeit. Sie erzählt von einem jungen Mann, der auf einer Parkbank sitzt und Fremden von seiner Küchenuhr erzählt. Die Küchenuhr ist ein Symbol für die Vergangenheit und die Erinnerung an seine Mutter und ein unbeschwertes Leben vor dem Krieg.
Was symbolisiert die Küchenuhr in der Geschichte?
Die Küchenuhr symbolisiert die Vergangenheit des jungen Mannes, die Erinnerung an seine Familie und die Geborgenheit seines Elternhauses. Sie ist ein greifbares Überbleibsel einer zerstörten Welt und steht für die Sehnsucht nach einer besseren Zeit.
Welche Bedeutung hat die Uhrzeit "halb drei" in der Geschichte?
Die Uhrzeit "halb drei" ist die Zeit, zu der der junge Mann früher nachts von der Arbeit nach Hause kam und seine Mutter ihm noch das Abendbrot warm machte. Diese Uhrzeit ist für ihn mit positiven Erinnerungen und einem Gefühl der Geborgenheit verbunden.
Welche Rolle spielen die Zuhörer auf der Parkbank?
Die Zuhörer auf der Parkbank sind anonym und repräsentieren die allgemeine Bevölkerung der Nachkriegszeit. Ihre Anonymität deutet darauf hin, dass die Geschichte jedem passieren könnte und dass jeder Zuhörer dieser Geschichte werden kann.
Was ist das Besondere an Borcherts Schreibstil in "Die Küchenuhr"?
Borcherts Schreibstil in "Die Küchenuhr" ist gekennzeichnet durch seine Kürze, Präzision und Eindringlichkeit. Er verwendet einfache Sprache und vermeidet lange Beschreibungen, um sich auf den Kern der Erzählung zu konzentrieren.
Welche Ironie findet sich in der Kurzgeschichte?
Die Ironie liegt in der ungewöhnlichen Freude des jungen Mannes, wenn er von seiner Küchenuhr erzählt. Trotz des Verlusts seiner Familie und seines Zuhauses scheint die Erinnerung an die Vergangenheit das Einzige zu sein, was ihm noch Freude bereitet.
Welches Erzählverhalten verwendet Borchert in der Kurzgeschichte?
Borchert verwendet ein auktoriales Erzählverhalten, begrenzt jedoch seine Informationen über das Geschehen und die Mitwirkenden stark. Es gibt eigentlich keine eigentliche Handlung.
Welche thematischen Schwerpunkte setzt die Kurzgeschichte?
Die thematischen Schwerpunkte liegen auf der Nachkriegszeit, der Erinnerung an die Vergangenheit, dem Verlust von Geborgenheit und Familie, sowie der Suche nach Sinn in einer trostlosen Gegenwart. Die Verbindung zwischen Personen und Gegenständen und den daraus resultierenden Erinnerungen wird ebenfalls dargestellt.
- Quote paper
- Brigitta Loidl (Author), 2001, Borchert, Wolfgang - Die Küchenuhr #, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101601