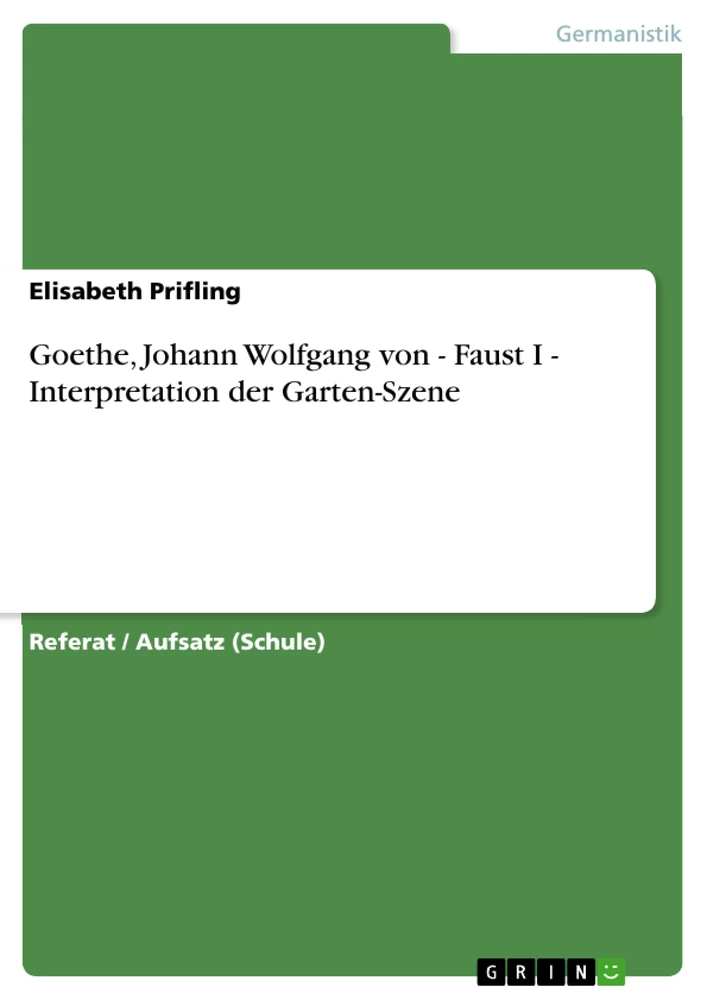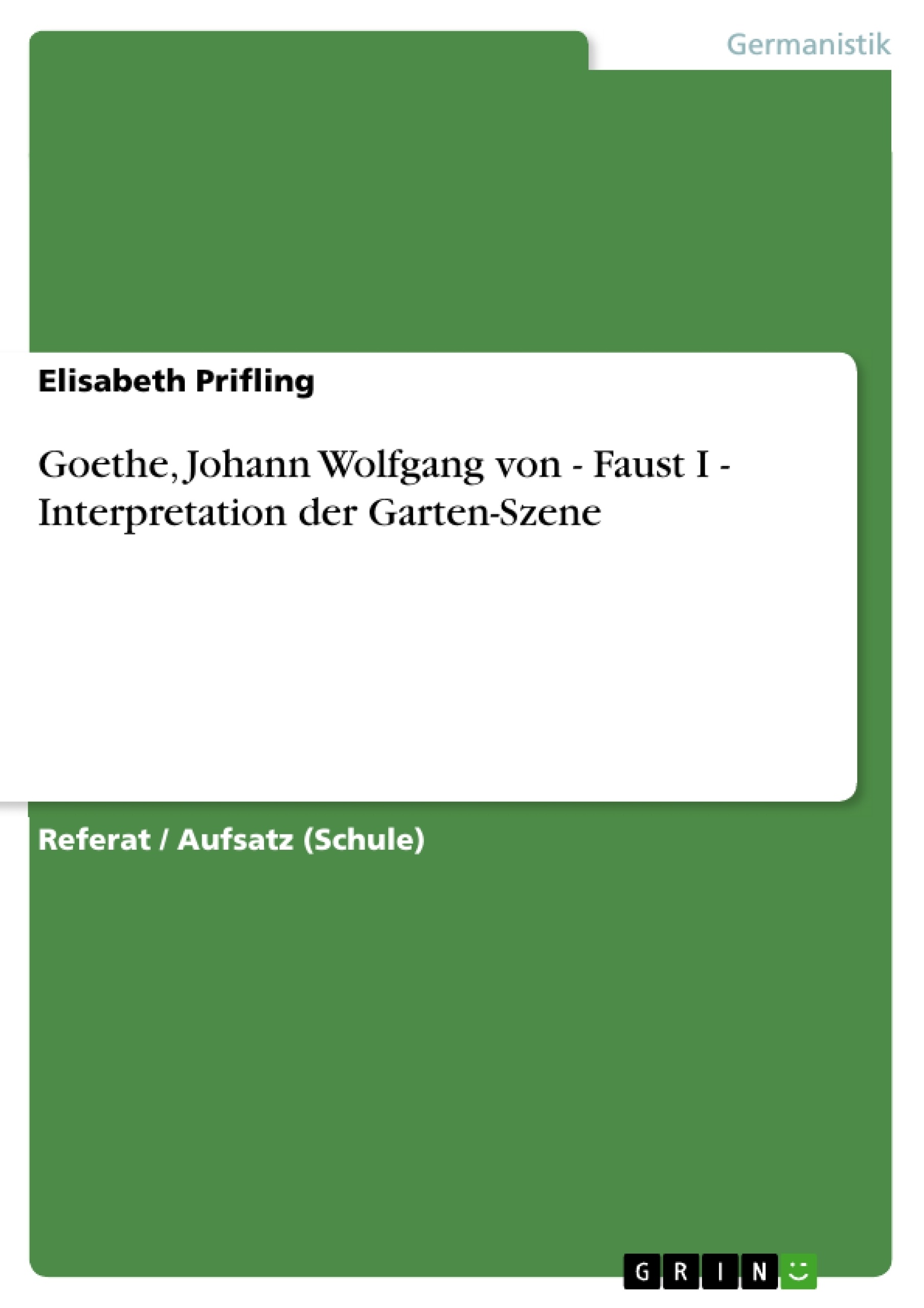Johann Wolfgang von Goethe ist wahrscheinlich bereits in Kinderjahren mit dem FaustThema in Kontakt gekommen, als es in dramatisierter Form auf Puppenbühnen aufgeführt und als Roman billig auf Jahrmärkten feilgeboten wurde.
Alle schriftlich fixierten Faust-Geschichten, auch das erste Faust-Drama von Ch. Marlowe, gehen auf ein Volksbuch zurück, das das Leben eines gewissen Johann Georg Faust beschreibt. Von ihm ist nur wenig dokumentarisch belegt: Er hat ca. von 1480 bis 1530 gelebt und ist als Wahrsager und magischer Heiler durchs Land gezogen. Bereits zu seinen Lebtagen ist ihm nachgesagt worden, er habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Die Sagen, die sich um ihn entwickelt haben, fasst J. Spieß in seinem Volksbuch zusammen, das über Jahre hinweg neu bearbeitet und übersetzt wird.
Goethe übernimmt nun diesen Stoff und schreibt auf dieser Basis „Faust. Eine Tragödie“, eines der bedeutendsten Werke der deutschen Literatur.
Im Folgenden wird nun eine Szene aus Faust I, die „Garten“-Szene, interpretiert.
Die Handlung in Faust I lässt sich in drei Teile zerlegen: in die Gelehrtentragödie, die Weltfahrt und in die Gretchentragödie. In der Gelehrtentragödie wird der verzweifelte Gelehrte Faust vorgestellt, der aus Erkenntnisdrang einen Pakt mit Mephisto, einem Diener des Teufels, schließt. Faust ist davon überzeugt, dass Mephisto ihn niemals zufrieden-stellen kann und begibt sich daraufhin mit ihm auf Weltreise.
Die erste Station ist „Auerbachs Keller“, wo Mephisto Faust mit seinen Zauberkunst- stückchen nicht beeindrucken kann. In der „Hexenküche“ wird Faust dann um 30 Jahre verjüngt.
In der folgenden Szene beginnt bereits die Gretchentragödie: Faust begegnet auf der „Straße“ Gretchen. Er möchte sie für sich gewinnen und beauftragt Mephisto, Schmuck für sie zu besorgen, den Gretchens Mutter aber dem Pfarrer übergibt. Gretchen bekommt daraufhin eine weitere Schatulle voll Schmuck, die sie zu Marthe, einer Nachbarin, bringt. Dort erscheint auch Mephisto, der durch eine Lüge ein Rendezvous im „Garten“ einfädelt.
Es folgt nun die zu interpretierende „Garten“-Szene.
Sowohl Marthe und Mephisto als auch Faust und Gretchen treffen aufeinander. Sie spazieren als zwei Pärchen durch den Garten und unterhalten sich getrennt voneinander. Marthe will sich Mephisto angeln, der ihr jedoch ständig ausweicht.
Gretchen dagegen erzählt Faust ihre Lebensgeschichte, bis Faust ihr letztendlich seine Liebe gesteht.
Auf die „Garten“-Szene folgt eine kurze Szene, in der sich Faust und Gretchen das erste Mal küssen.
Nach einer Unterbrechung der Gretchenhandlung durch „Wald und Höhle“ stellt Gretchen Faust die Frage nach seinem Glauben, außerdem gesteht sie ihm ihre Antipathie gegenüber Mephisto. Darüberhinaus verabreden sich die beiden für die nächste Nacht.
Hier ist der Wendepunkt in der Gretchentragödie anzusetzen; Gretchen wird schwanger und erkennt, welches Schicksal ihr als ledige Mutter bevorsteht. Faust erfährt von all diesem nichts, da sich Gretchen lediglich an die schmerzensreiche Muttergottes wendet. Faust tötet im Folgenden mit Mephistos Hilfe Valentin, Gretchens Bruder, nachdem bereits ihre Mutter an einem Schlaftrunk gestorben ist, den sie ihr verabreicht hat, damit sie in der Nacht mit Faust ungestört ist.
Während sich Faust und Mephisto in der „Walpurgisnacht“ amüsieren und sich Exzessen hingeben, begeht Gretchen Kindsmord und wird dafür zum Tode verurteilt. Als Faust davon erfährt, will er sie retten, um sein eigenes Gewissen zu beruhigen, da er weiß, dass er mitschuldig ist. Gretchen aber will nicht gerettet werden und begibt sich in die Hand Gottes. Damit endet die Gretchentragödie und der I. Teil des „Faust“.
Wenn man die Gretchentragödie als eigenständige Handlung betrachtet, ist die „Garten“- Szene Teil der Exposition. Gretchen wird vorgestellt, indem sie selbst von ihrem Leben erzählt (vgl. V. 3109-3148), und der Leser, bzw. Zuschauer erhält Einblick in ihre Welt, die Welt des Kleinbürgertums.
Außerdem befinden wir uns noch in der steigenden Handlung. Faust und Gretchen lernen sich kennen und verlieben sich ineinander.
Gretchen ist glücklich, ihre Welt ist noch in Ordnung und sie fühlt sich von ihrer Umwelt noch nicht bedroht.
Faust jedoch ahnt bereits, welches Ende ihre Liebe haben wird: „Verzweiflung“ (V. 3193).
Die vorliegende Szene erfüllt im Drama bzw. in der Gretchentragödie mehrere Funktionen.
Wenn Gretchen von ihrer Welt erzählt, erfahren wir, welche Werte beim Kleinbürgertum gelten.
Gretchen muss in der Wirtschaft ihrer Mutter mitarbeiten (vgl. V. 3109-3112); sie ist äußerst fleißig und den ganzen Tag beschäftigt. Sie hat auch ihre kleine Schwester aufgezogen, als ihre Mutter nach der Geburt sehr krank gewesen ist (vgl. V. 3122 ff.). Gretchen hat also sehr früh die Mutterrolle übernommen. Sie hat sehr früh erwachsen werden und Verantwortung übernehmen müssen.
Außerdem ist Gretchens Familie sehr sparsam und bescheiden. Obwohl der Vater bei seinem Tod ein kleines Vermögen hinterlassen hat, zeigt Gretchens Mutter dies nicht. Sie leisten sich nichts Besonderes, sondern leben wie zuvor (vgl. V. 3115 ff.).
Darüberhinaus herrscht beim Kleinbürgertum eine harte Sexualmoral. Das Höchste bei einem Mädchen ist es, ihre Tugend zu bewahren (vgl. V. 3170 ff.). Bis zu diesem Punkt ist Gretchen dies auch gelungen.
Gretchen verkörpert also das Idealbild eines kleinbürgerlichen Lebens.
Marthe gehört zwar auch dem Kleinbürgertum an, entspricht aber keineswegs dem Idealbild, mit dem Gretchen identifiziert wird.
Zwei Szenen vorher, in „Der Nachbarin Haus“, erfährt der Leser bzw. Zuschauer, dass ihr Mann sie schon vor langer Zeit verlassen hat um in die Welt hinauszuziehen. Als Mephisto ihr mitteilt, dass ihr Mann tot sei, ist Marthe nur am Totenschein interessiert, damit sie möglichst bald wieder heiraten kann.
In der vorliegenden Szene zeigt sie dann auch offenkundiges Interesse an Mephisto. Marthe ist äußerst direkt und spricht offen von „Lust“ (V. 3157).
Gretchen dagegen tritt mit einer kindlichen Unschuld auf, die sich auch im Blumenspiel zeigt (vgl. V. 3180 ff.).
Während Marthe nur von Sexualität spricht, denkt Gretchen nicht einmal daran.
Ähnliche Gegensätzlichkeiten wie zwischen Marthe und Gretchen treten auch zwischen Faust und Gretchen auf.
Faust ist ein „Reisender“ (V. 3075), ein „erfahrener Mann“ (V. 3077). Er ist ein Fremder in der kleinbürgerlichen Welt, wie er selbst in andere Szenen erkennt, z.B. in „Wald und Höhle“. Gretchen als unerfahrenes Mädchen hat deshalb Angst, dass sie Faust langweilt (vgl. V. 3078), weil sie auch nicht in so hohen Worten wie er (z.B. V. 3100 ff.) sprechen kann und ihn auch nicht versteht, wenn er so spricht.
Faust und Gretchen haben also nichts gemeinsam.
Desweiteren wird in dieser Szene vorgeführt, in welchem Ausmaß die Öffentlichkeit alles kontrolliert. Jeder achtet darauf, was sein Nachbar macht, und ist an allem interessiert. (Vgl. V. 3197-3201).
Dies spielt auch im weiteren Geschehen noch eine wichtige Rolle, da es allein die Öffentlichkeit ist, die Bürger, die ledige Mütter verurteilt. Besonders gut zu erkennen ist dies in der Szene „Am Brunnen“, in der die Schikanen angesprochen werden, denen man ausgesetzt ist, wenn man unverheiratet schwanger ist.
Die wichtigsten Aspekte, die in der vorliegenden Szene angesprochen werden, sind also das Idealbild eines kleinbürgerlichen Mädchens, der Gegensatz einmal zwischen Marthe und Gretchen und zum zweiten zwischen Faust und Gretchen und die Kontrollfunktion der Öffentlichkeit.
Bei der Garten-Szene handelt es sich um zwei voneinander getrennte Dialoge, die sich abwechseln.
Betrachtet man das Gespräch zwischen Marthe und Mephisto, fällt auf, dass des kürzer ist als das zwischen Gretchen und Faust, es also nicht im Vordergrund steht. Auffällig ist aber, dass Marthe immer die Gesprächsthemen von Faust und Gretchen übernimmt, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Beim ersten Wechsel zwischen den Paaren übernimmt Marthe das Reise-Thema, beim zweiten Wechsel, dass „die armen Weiber ... doch übel dran“ sind (V. 3149), meint dies aber ganz anders als Gretchen.
Mephisto dagegen ist wortkarg und benutzt Sprichwörter (vgl. V. 3155 f.), anstatt dass er klar sagt, was er selbst denkt. Damit weicht er Marthe absichtlich aus. Außerdem ist er es, der dem Treffen ein Ende bereitet (vgl. V. 3195). Er tritt dann auch als Störenfried zwischen Faust und Gretchen und löst die Szene auf, wie er auch in „Wald und Höhle“ Fausts gute Stimmung kaputt macht.
Der größere Teil der Szene ist Faust und Gretchen gewidmet. Es ist einer der wenigen Dialoge zwischen den beiden (vgl. „Marthens Garten“ und „Kerker“). Der größere Sprachanteil liegt hier bei Gretchen, die fast die ganze Zeit über erzählt. Faust dagegen sind vor allem in der ersten Hälfte meist nur kurze Einwürfe zugedacht.
Erst als er Gretchen seine Liebe gesteht, spricht er etwas länger (vgl. v. 3188-3149). Hier aber weicht er vom Vers ab und spricht in Prosa, was immer geschieht, wenn seine Gefühle ihn übermannen (vgl. „Trüber Tag“).
Die „Garten“-Szene ist also ein wichtiger Teil in der Gretchentragödie, da sich Faust und Gretchen hier kennenlernen und da hier Einblicke gegeben werden, ohne die das folgende Geschehen nur schwer zu verstehen wäre.
Goethe hat über 60 Jahre am „Faust“ gearbeitet, also fast sein ganzes Leben lang.
Bereits vor 1775 schreibt er den „Urfaust“, 1790 veröffentlicht er „Faust. Ein Fragment“, 1808 „Faust. Teil I“ und erst 1737 wird „Faust. Teil II“ veröffentlicht.
Häufig gestellte Fragen zu Faust I und der Gartenszene
Worum geht es in dem Text über Faust?
Der Text ist eine Analyse der Gartenszene aus Johann Wolfgang von Goethes "Faust I". Er beleuchtet die Bedeutung dieser Szene innerhalb der Gretchentragödie und untersucht die Werte und Gegensätze zwischen den Charakteren.
Was ist der Hintergrund des Faust-Themas?
Das Faust-Thema basiert auf der historischen Figur Johann Georg Faust, einem Wahrsager und magischen Heiler, dem nachgesagt wurde, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Diese Sagen wurden in Volksbüchern zusammengefasst und dienten Goethe als Grundlage für sein Werk.
Wie ist die Handlung von Faust I aufgebaut?
Die Handlung lässt sich in drei Teile zerlegen: die Gelehrtentragödie, die Weltfahrt und die Gretchentragödie. In der Gelehrtentragödie schließt Faust einen Pakt mit Mephisto. Die Gretchentragödie beginnt mit Fausts Begegnung mit Gretchen.
Was geschieht in der Gartenszene?
In der Gartenszene treffen Marthe und Mephisto sowie Faust und Gretchen aufeinander. Marthe versucht, Mephisto für sich zu gewinnen, während Gretchen Faust ihre Lebensgeschichte erzählt und er ihr seine Liebe gesteht.
Welche Rolle spielt die Gartenszene in der Gretchentragödie?
Die Gartenszene ist Teil der Exposition und der steigenden Handlung. Sie führt Gretchen ein und gibt Einblick in ihre kleinbürgerliche Welt. Faust und Gretchen lernen sich kennen und verlieben sich ineinander.
Welche Werte werden im Kleinbürgertum vermittelt?
Die Werte des Kleinbürgertums umfassen Fleiß, Bescheidenheit, Sparsamkeit und eine strenge Sexualmoral. Das Idealbild ist ein tugendhaftes Mädchen.
Welche Gegensätze werden in der Gartenszene aufgezeigt?
Es gibt Gegensätze zwischen Marthe und Gretchen sowie zwischen Faust und Gretchen. Marthe ist an weltlichen Vergnügungen interessiert, während Gretchen Unschuld verkörpert. Faust ist ein erfahrener Mann, während Gretchen unerfahren ist.
Wie wird die Kontrollfunktion der Öffentlichkeit dargestellt?
Die Öffentlichkeit kontrolliert alles und verurteilt ledige Mütter. Dies spielt eine wichtige Rolle im weiteren Verlauf der Gretchentragödie.
Wie ist der Dialog in der Gartenszene aufgebaut?
Die Szene besteht aus zwei getrennten Dialogen, die sich abwechseln: Marthe und Mephisto sowie Faust und Gretchen. Der Dialog zwischen Faust und Gretchen ist länger und wichtiger.
Welche Bedeutung hat die Gartenszene für das Verständnis der Gretchentragödie?
Die Gartenszene ist ein wichtiger Teil der Gretchentragödie, da sich Faust und Gretchen hier kennenlernen und Einblicke in ihre Charaktere und ihre Welten gegeben werden.
Wie lange hat Goethe an Faust gearbeitet?
Goethe hat über 60 Jahre an "Faust" gearbeitet, fast sein ganzes Leben lang. Er veröffentlichte verschiedene Versionen, darunter den "Urfaust", "Faust. Ein Fragment", "Faust. Teil I" und "Faust. Teil II".
- Quote paper
- Elisabeth Prifling (Author), 2001, Goethe, Johann Wolfgang von - Faust I - Interpretation der Garten-Szene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101598