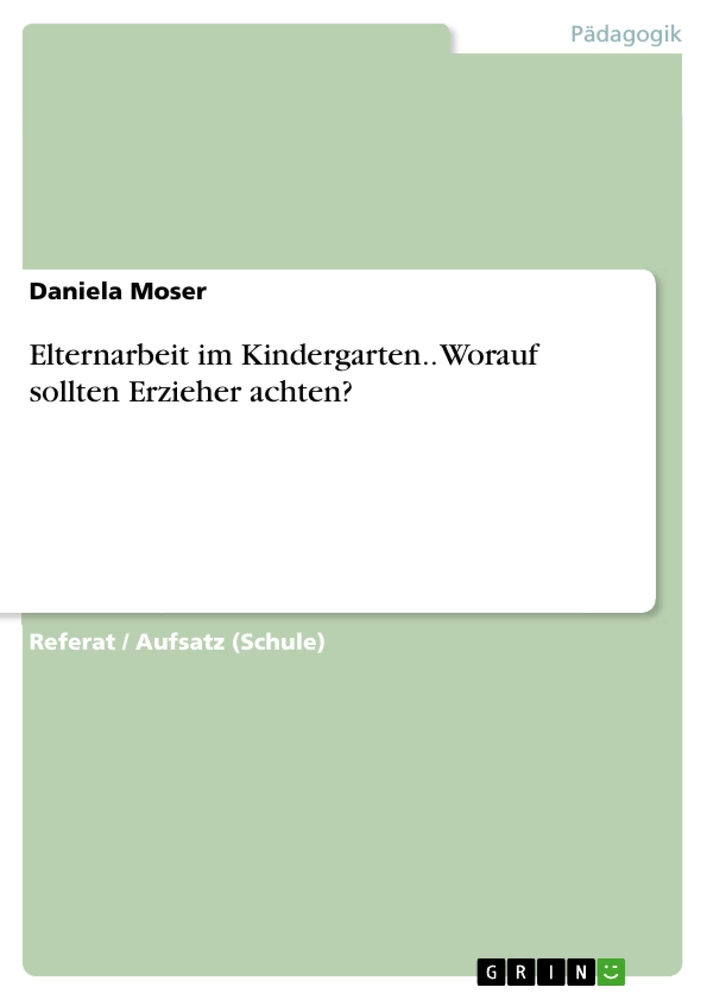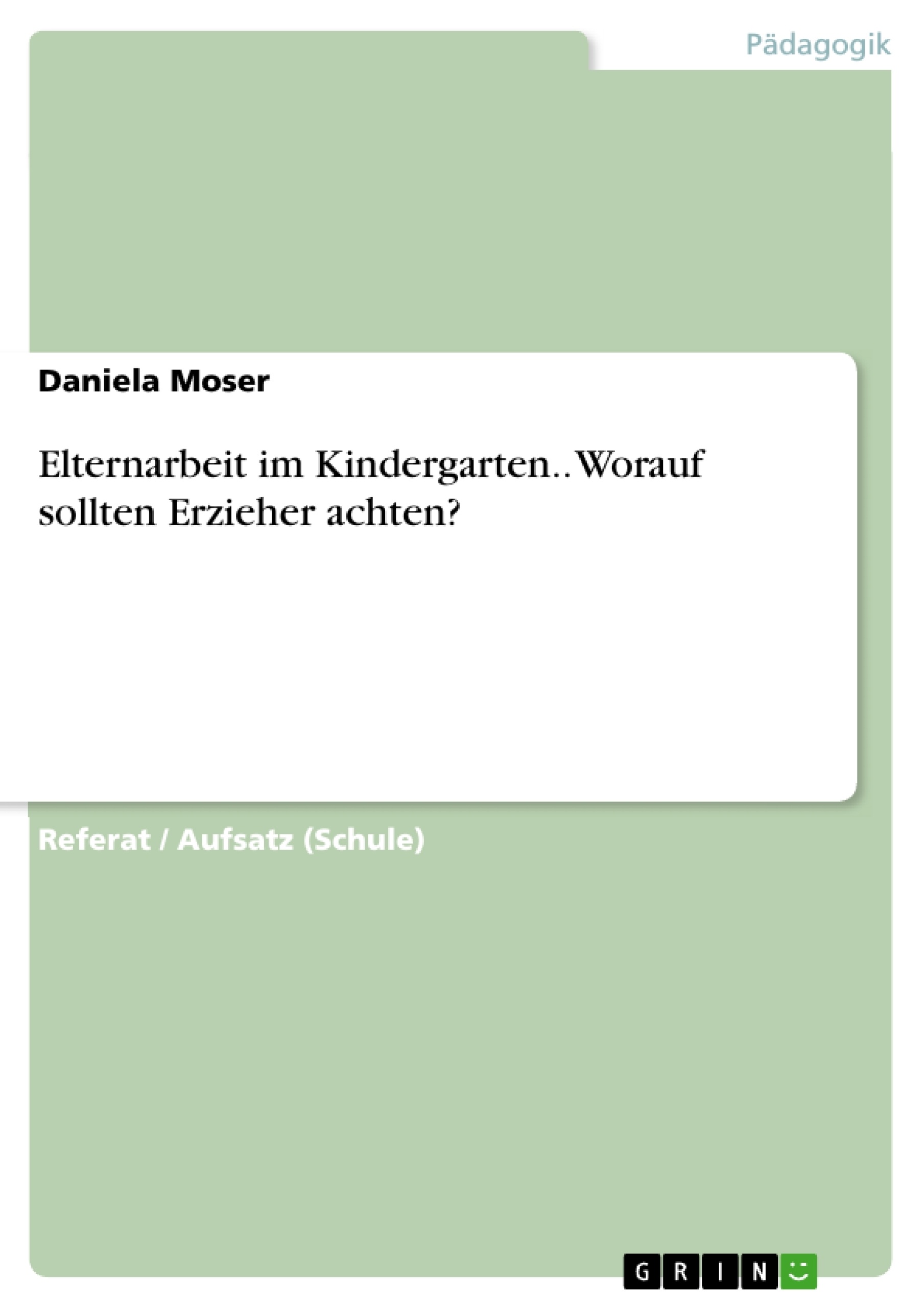Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Welt, in der die unsichtbare Brücke zwischen Elternhaus und Kindergarten das Fundament für eine harmonische Kindesentwicklung bildet. Diese Arbeit enthüllt die vielschichtige Bedeutung der Elternarbeit im Wandel der Zeit, weg von einer bloßen Pflichtübung hin zu einer lebendigen Partnerschaft. Entdecken Sie, wie Transparenz, Kooperation und Beratung zu Eckpfeilern einer erfolgreichen Erziehungspartnerschaft werden, die das Kind in den Mittelpunkt stellt. Von der subtilen Macht der Raumgestaltung und der Atmosphäre in der Einrichtung bis hin zu den sorgfältig geplanten Elterngesprächen, die auch kritische Themen konstruktiv angehen – diese Einblicke bieten Erzieherinnen und Erziehern praktische Werkzeuge, um Vertrauen aufzubauen und gemeinsam mit den Eltern an einem Strang zu ziehen. Erfahren Sie, wie Sie Informationsbretter ansprechend gestalten, Elterngespräche systematisch vorbereiten und auch schwierige Kritikgespräche mit Feingefühl meistern. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Elternabenden als Plattform für Austausch und Vernetzung, gibt konkrete Tipps für die Themenwahl, die Gestaltung des Raumes und die Moderation, um sicherzustellen, dass jedes Elternpaar erreicht wird. Lassen Sie sich inspirieren, wie Sie die Elternarbeit in Ihrer Einrichtung neu definieren können, um eine wertvolle und nachhaltige Basis für die Entwicklung jedes einzelnen Kindes zu schaffen, indem die aktive Einbeziehung der Eltern in den Kita-Alltag die Grundlage für eine erfolgreiche, gemeinsame Erziehung bildet und wie ein offener Dialog und gegenseitiges Verständnis dazu beitragen, eventuelle Ängste abzubauen und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der sich sowohl Kinder als auch Eltern wohlfühlen. Die Erkenntnis, dass die Erzieherpersönlichkeit und der Umgang unter den Kollegen einen wesentlichen Beitrag zur Meinungsbildung der Eltern leisten, rundet diese umfassende Betrachtung ab und verdeutlicht die Notwendigkeit eines respektvollen und wertschätzenden Miteinanders im gesamten Team, denn die aktive Teilnahme der Eltern an Ausflügen und Festen stärkt die Gemeinschaft und fördert den Austausch, während die bewusste Gestaltung der Übergänge zwischen Kita und Elternhaus ein Gefühl der Sicherheit und Kontinuität vermittelt. Abschließend zeigt die Untersuchung, wie wichtig es ist, die Elternarbeit als Chance zu begreifen, um gemeinsam eine positive und entwicklungsfördernde Umgebung für die Kinder zu schaffen, denn die kontinuierliche Reflexion und Anpassung der Angebote an die Bedürfnisse der Familien sichert die Qualität der Elternarbeit und trägt maßgeblich zum Erfolg der pädagogischen Arbeit bei, damit die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Erziehern und Eltern zum Wohle des Kindes gelingt.
Gliederung
I. Einleitung
II. Elternarbeit im Wandel
1) Transparenz, Kooperation & Beratung
2) Formen der Elternarbeit
2.1) Atmosphäre der Einrichtung
2.2) Infobrett
2.3) Elterngespräche
2.3.1) Kritikgespräche
2.4) Elternabend
III. Schluss
I. Einleitung zum Thema Elternarbeit:
Jeder weiß, dass die Elternarbeit ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Institution für Kinder ist. Doch viele Erzieher/innen begegnen der Elternarbeit nicht so locker und selbstbewusst, wie man sie vielleicht in dem täglichen Umgang mit den Kindern kennt, sondern eher verkrampft und ängstlich, den Erwartungen der Eltern nicht entsprechen zu können.
Doch es sind nicht nur die Erzieher/ innen, die befangen dem vielleicht ersten Elterngespräch zur Anmeldung des Kindes, entgegensehen, sondern die Eltern haben mindestens genauso viel Ängste. Da das Kind erstmals aus der Familie in eine größeren Gruppe Gleichaltriger wechselt und außerfamiliäre Erziehungspersonen erlebt, ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Erzieher/in und Eltern erforderlich, damit das Kind keinen Bruch zwischen dem Elternhaus und der Einrichtung erlebt.
In dieser Arbeit werde ich kurze Einblicke geben in welchen Formen Elternarbeit im Kindergarten bzw. Kindertagesstätten möglich ist und worauf man als Erzieher/in zu achten hat.
II. Elternarbeit im Wandel:
Früher war z. B. der Kindergarten ein Ort, von dem der Blick hauptsächlich auf das Kind und dann auf dessen Familie geworfen wurde. Die Elternarbeit war eine unbeliebte Pflichtausgabe und wurde nur dann praktiziert, wenn es gerade ins Programm passte.
In den letzten Jahren wurde immer mehr ein Perspektivenwechsel sichtbar. Der Blick richtet sich jetzt nicht nur hauptsächlich auf das Kind sondern die Eltern und die Umgebung werden mit der täglichen Arbeit mit Kindern integriert. Eltern sind so ein Teil des Programms.
Um eine gute Elternarbeit auszuarbeiten sind einige Fragen aus Sicht der Erzieher/innen nötig:
- Welche Interessen habe ich für die Zusammenarbeit mit den Eltern: Weil es der Arbeitgeber so möchte? Weil ich die Eltern näher kennen lernen möchte? Weil mich das häusliche Umfeld der Kinder interessiert?
- Worin sehe ich als Erzieher/in die spezifischen Aufgaben in der Arbeit mit Eltern?
- Was ist mir in der Zusammenarbeit mit Eltern besonders wichtig?
- Möchte ich ein positives Bild der Einrichtung nach außen vermitteln?
- Möchte ich den Eltern die verschiedenen Möglichkeiten der Einrichtung zur 2 Verfügung stellen?
- Wie viel Vorbereitungszeit und welcher Etat für Elternarbeit steht zur Verfügung?
- Welche Themen machen die Zusammenarbeit mit den Eltern schwierig?
1)Transparenz, Kooperation & Beratung:
Es ist in der Elternarbeit wichtig, dass die Einrichtung transparent mit der pädagogischen Arbeit umgeht, dass sie mit den Eltern kooperiert und sie beraten.
Transparenz: Eltern haben einen Anspruch darauf, zu erfahren wie ihr Kind in der Einrichtung erzogen wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten um die pädagogische Arbeit offen zu legen, wie z. B. eine schriftliche Konzeption der Einrichtung, welche die Eltern von Anfang an erhalten sollten. Es könnten Informationswände im Eingangsbereich der Einrichtung zu finden sein, auf denen, in Form von einer Fotodokumentation, die letzten Projekte geschildert werden.
Kooperation: Bei der Kooperation steht an erster Stelle das Abstimmen der Erziehungsziele und des Erziehungsverhalten. Die Mitarbeit, die Mitbestimmung und die Zusammenarbeit der Eltern untereinander gehören ebenfalls dazu. Kooperative Tätigkeiten bedeuten häufig auch eine zusätzliche Transparenz. Beratung: Da die Erzieher/innen das Kind mit anderen Augen und in einer anderen Umgebung als die Eltern sehen und zusätzliche Vergleichsmöglichkeiten haben , haben sie die Möglichkeit den Eltern über die Entwicklung des Kindes aus ihrer Sicht zu berichten und die Eltern zu beraten. Zusätzlich können sie ihre Fachkenntnisse einbringen und den Eltern Hilfen in der Erziehung bieten. All dies sollte aber nicht in Form eines Kurses, wie einer der Volkshochschule, verstanden werden.
2) Formen der Elternarbeit:
Es gibt verschiedene Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern, welche man grob in vier Bereiche unterteilen kann.
2) Der nonverbale Einfluss:
- Raumgestaltung / Atmosphäre
- Aktivitäten und Erzählungen der Kinder
- Ausstrahlung der Erzieherpersönlichkeit
- Beobachtung beim Abholen und Bringen
- Gerüchte und Tratsch
3) Die schriftlichen Informationen:
- Infobrett im Flur
- Informationen bei der Aufnahme
- Elterbriefe, Merkblatt, Einladungen
- Elternzeitung
- Kontaktheft
- Konzeptionsmappe
4) Kontakte mit einzelnen Eltern:
- Tür- und Angel- Gespräche
- Telefonate
- Gespräche/ Sprechstunde
- Hospitationen
- Hausbesuche
5) Aktivitäten mit Elterngruppen:
- Elternarbende
- Elternmitarbeit
- Eltern- Kind- Nachmittage, Ausflüge, Tag der offenen Tür
Ich werde mich nun mit je einer Form aus jedem Bereich näher befassen.
2.1)Atmosphäre der Einrichtung:
Es ist ein großer Unterschied, ob der Kindergarten wie ein aufgeräumtes Museum erscheint oder wie ein behaglicher Lebensraum, ob alles völlig überfüllt ist mit Bastelsachen oder schön dekoriert. Ansprechend ist für Eltern sicherlich auch eine gemütliche Sitzecke, in der die Eltern auf ihre Kinder warten können. In einer solche Sitzecke können Fachzeitschriften, Bilderbücher, Informationen von Verschiedenen Institutionen oder dergleichen ausgelegt werden, damit sich die Eltern in der Wartezeit beschäftigen können. Kaffe oder Tee können an diesem Platz bestimmt nicht verkehrt sein.
Auch der Umgang unter den einzelnen Erziehern/innen bleibt den Eltern nicht unbemerkt und tragen zu einer Meinungsbildung der Eltern über die Einrichtung bei. Es sollte also darauf geachtet werden, dass Meinungsverschiedenheiten oder Antipathien zwischen den Erziehern/innen nicht vor den Eltern ausgetragen werden.
2.2) Infobrett:
Ein Infobrett sollte gut sichtbar im Eingangsbereich der Einrichtung angebracht werden, auf dem Kurze Nachrichten, wie Termine, augenblickliche ansteckende Krankheiten, gefundene Gegenstände, mitzubringende Dinge oder der Speiseplan, angepinnt werden.
Es ist darauf zu achten, dass überholte Informationen rechzeitig abgehangen werden, um die neuen wichtigen Dinge nicht überdecken, so das sie von den Eltern übersehen werden könnten.
Das Infobrett sollte ansprechend gestaltet sein und Dinge die für längere Zeit aushängen sollen, müssen ebenfalls formschön und einladend aussehen, da sie ansonsten schnell übersehen werden.
Informationen sollten kurz und prägnant geschrieben werden, da lange Texte oft abschreckend wirken und die Eltern meist keine Zeit haben Seitenlange Romane zu lesen. Bei Einrichtungen in denen viele ausländische Kinder gehen, sollte eine Übersetzung, in die verschiedenen Sprachen, der Elterninformationen mit an dem Infobrett angepinnt werden.
2.3) Elterngespräche:
Bei Elterngesprächen wird meist ein Termin vereinbart, an dem die Eltern Zeit haben. Im Regelfall sollte mindestens einmal jährlich mit jedem Elternpaar ein Elterngespräch stattfinden. Es sollte vermittelt werden, dass ein Elterngespräch etwas ganz normales ist und es keinen Grund gibt mit einem unguten Gefühl an das Elterngespräch heranzutreten. Bei einem Elterngespräch werden beide Elternteile eingeladen und auch der Vater soll das Gefühl bekommen, dass er als Gesprächspartner willkommen ist. Das Elterngespräch sollte in einem gemütlichen und ungestörten Raum stattfinden. Nicht in einem Raum mit den oft unbequemen Kinderstühlchen und auch nicht im Büro, indem man ständig durch Telefonate unterbrochen wird. Die Eltern sollten freundlich begrüßt werden und sich ihren Sitzplatz selber auswählen dürfen. Zur Auflockerung kann den Eltern Kaffee oder Tee angeboten- und Plätzchen gereicht werden. Die Erzieherin sollte das Elterngespräch gut vorbereiten und die Punkte, die sie ansprechen will systematisch ordnen. Schwierig wird einen solches Elterngespräch, wenn es sich um ein Kritikgespräch von seiten der Erzieherin handelt.
2.3.1) Kritikgespräche:
Ein Kritikgespräch benötigt eine noch größere Vorbereitung und des ist mit großer Vorsicht vorzugehen. Die Erzieherin muss sich nochmals vergegenwärtigen, wo genau des Problem des Kindes liegt und muss auch mit den Kollegen/innen über das Problem sprechen, um deren Meinung zu erkennen. Genauso muss sich die Erzieherin über die positiven Eigenschaften des Kindes klar werden, um die Eltern nicht nur mit dem Negativen zu konfrontieren. Sie muss sich die Ziele, die mit dem Elterngespräch erreicht werden sollen, bewusst machen und sich gegebenenfalls schriftlich festhalten, um den Faden während nicht zu verlieren. Diese Vorbereitungen trifft sie zusammen mit der Zweitkraft, die an dem Gespräch mit teilnehmen soll.
Wie auch bei jedem anderen Gespräch sind die oben genanten Vorraussetzungen zu erfüllen.
Während dem Gespräch sollten sich die Eltern nicht wie auf einer Klagebank fühlen. Die Erzieherin sollte, bevor sie die negativen Punkte aufführt, mit den positiven Dingen beginnen.
Die Erzieherin sollte nun die momentane Problemsituation mit den Kind verdeutlichen. Solche Beobachtungen sollten ausschließlich mit Ich- Botschaften geschildert werden. So bleibt es sachlich und das Kind bekommt keine negative Bewertung.
Zusammen mit den Eltern sollten Lösungen für das Problem gesucht werden, da dies nicht nur gesonderte Probleme, die nur den Kindergarten betreffen sind, sondern auch in der Familie bearbeitet werden müssen. Vielleicht ist den Eltern das Problem zu Hause auch schon aufgefallen.
Bei dem ganzen Gespräch ist das Verhalten der Erzieher/ in besonders wichtig, da nicht nur die Sprache und die gewählten Worte ausschlaggebend ist, sondern auch die Gestik und Mimik der Erzieher/ in. Auch wenn sich Eltern oft angegriffen fühlen und mit Gegenangriffen versuchen sich zu schützen, bedarf es, dass die Erzieherin ruhig und sachlich bleibt und immer wieder auf den eigentlichen Inhalt des Gespräches zurückführt. Sie muss den Eltern Hilfe und Unterstützung anbieten, um das Problem in den Griff zu bekommen. Es können weitere Termine vereinbart werden, bei denen man die reflektiert, ob sich die Situation verbessert hat, oder ob eine andere Möglichkeit zur Problemlösung gefunden werden muss.
Die Erzieherin sollte sich am ende des Gespräches verabschieden, indem sie sich erleichtert zeigt und ihre Hoffnung äußert, dass sich das Problem sicher bald löst.
Von Zeit zu Zeit sollte dann die Erzieherin den Eltern Rückmeldung geben, wie sie nun das Verhalten des Kindes erlebt.
2.4) Elternabende:
Der Elternabend gilt als die klassische Form der Elternarbeit. Die Qualität in der Vorbereitung und Durchführung des Elternabends wird unter anderem von folgenden Faktoren beeinflusst:
- Die richtige Tageszeit ( Wann können die meisten Eltern? ) Dabei ist auf die Örtlichen Veranstaltungen und Ereignisse im Fernseher zu achten (Man wird wohl eher wenige Vater zu Gesicht bekommen, wenn ein besonderes Fußballspiel übertragen wird)
- Es muss für ein erwachsenengerechten Raum gesorgt werden
- Rechzeitige schriftliche Einladungen mit einer klaren Zeitstruktur (Darauf achten, dass wirklich jedes Elternpaar eine Einladung erhalten haben)
- Themenwahl ( Welches Thema spricht zur Zeit die meisten Eltern an?)
- Besuch von einem Experten zu diesem Thema
- Kreisförmige Sitzordnung, da dies die Interaktion fördert.
- Wichtig ist der pünktliche und klar angekündigte Beginn.
- Eine Person, die den Ablauf leitet und moderiert, die auf den Zeitplan achtet und Pausen einschiebt.
- Für alle Informationspunkte sollten zum Schluss klare Ergebnisse festgehalten werden.
- Zeiten für Rückfragen einschieben. Fragen ob alles verstanden wurde.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Das Hauptthema dieses Dokuments ist die Elternarbeit im Kindergarten und in Kindertagesstätten, einschließlich verschiedener Formen der Zusammenarbeit und was Erzieher dabei beachten sollten.
Welche Formen der Elternarbeit werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt verschiedene Formen der Elternarbeit, unterteilt in vier Bereiche: nonverbaler Einfluss (Atmosphäre der Einrichtung), schriftliche Informationen (Infobrett), Kontakte mit einzelnen Eltern (Elterngespräche) und Aktivitäten mit Elterngruppen (Elternabende).
Was bedeutet "Transparenz" in Bezug auf Elternarbeit?
Transparenz bedeutet, dass Eltern einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, wie ihr Kind in der Einrichtung erzogen wird. Dies kann durch eine schriftliche Konzeption der Einrichtung oder durch Informationswände im Eingangsbereich erfolgen.
Was ist der Zweck von Elterngesprächen laut dem Text?
Elterngespräche dienen dazu, sich über die Entwicklung des Kindes auszutauschen, Erziehungsziele abzustimmen und Eltern bei der Erziehung zu beraten. Es wird betont, dass sie in einem gemütlichen und ungestörten Rahmen stattfinden sollten.
Wie sollte man sich auf ein Kritikgespräch vorbereiten?
Für ein Kritikgespräch sollte man sich intensiv vorbereiten, die positiven Eigenschaften des Kindes berücksichtigen, das Problem genau analysieren, sich mit Kollegen austauschen und die Ziele des Gesprächs schriftlich festhalten.
Was sind wichtige Aspekte bei der Gestaltung eines Elternabends?
Wichtige Aspekte bei der Gestaltung eines Elternabends sind die richtige Tageszeit, ein erwachsenengerechter Raum, rechtzeitige Einladungen, eine ansprechende Themenwahl, eine kreisförmige Sitzordnung, ein pünktlicher Beginn und ein gemütlicher Teil zum Austausch.
Welche Rolle spielt die Atmosphäre der Einrichtung in der Elternarbeit?
Die Atmosphäre der Einrichtung spielt eine wichtige Rolle, da sie einen nonverbalen Einfluss auf die Eltern hat. Eine behagliche und einladende Umgebung trägt positiv zur Meinungsbildung der Eltern über die Einrichtung bei.
Was sollte auf einem Infobrett zu finden sein?
Auf einem Infobrett sollten kurze Nachrichten wie Termine, ansteckende Krankheiten, gefundene Gegenstände, mitzubringende Dinge oder der Speiseplan angepinnt werden. Die Informationen sollten aktuell, prägnant und ansprechend gestaltet sein.
Warum ist die Kooperation zwischen Erziehern und Eltern so wichtig?
Die Kooperation ist wichtig, um die Erziehungsziele abzustimmen und sicherzustellen, dass das Kind keinen Bruch zwischen Elternhaus und Einrichtung erlebt. Mitarbeit, Mitbestimmung und Zusammenarbeit der Eltern untereinander sind ebenfalls Teil der Kooperation.
Welche Fehler sollten bei der Kommunikation mit Eltern vermieden werden?
Es sollte vermieden werden, Meinungsverschiedenheiten oder Antipathien zwischen Erziehern/innen vor den Eltern auszutragen. Außerdem sollte man darauf achten, in Kritikgesprächen sachlich zu bleiben und Ich-Botschaften zu verwenden, um das Kind nicht negativ zu bewerten.
- Quote paper
- Daniela Moser (Author), 2001, Elternarbeit im Kindergarten.. Worauf sollten Erzieher achten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101551