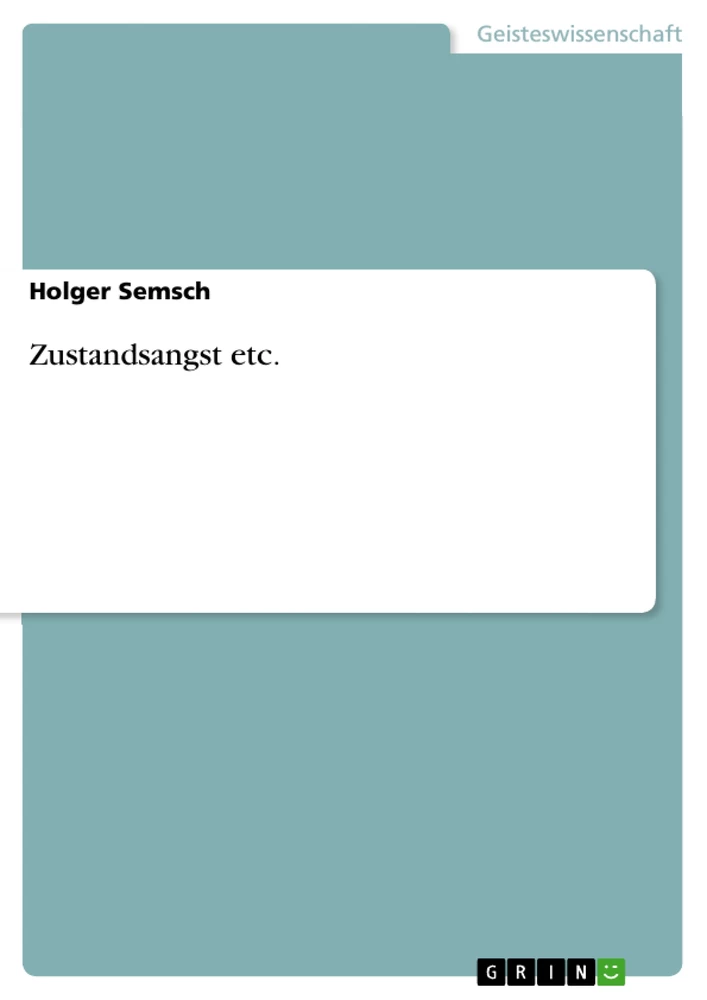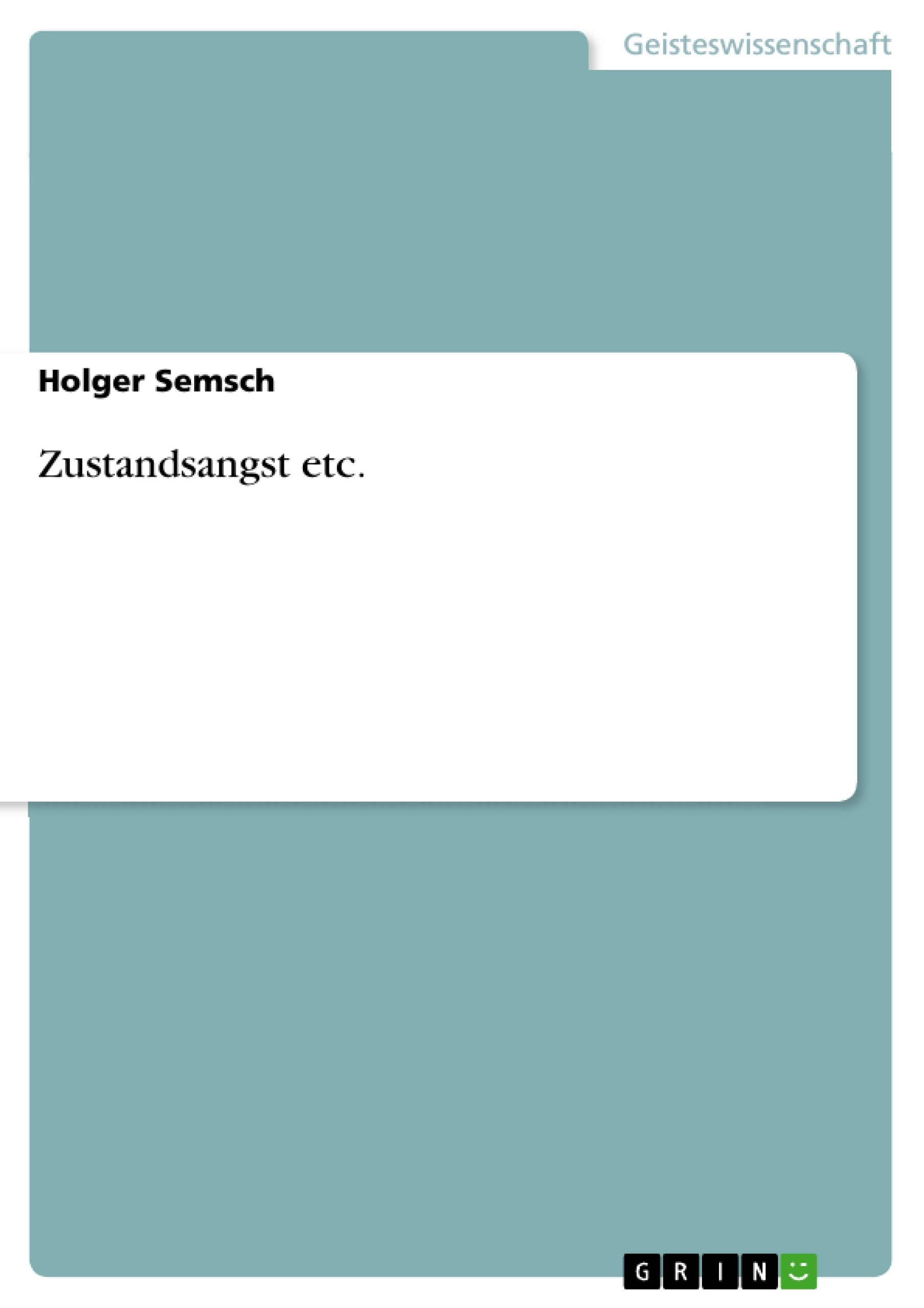Komponenten der Zustandsangst
Indikatoren der Zustandsangst
Laut Trait-State-Angstmodell ist der Angstzustand ein unidimensionales Konstrukt. Die verschiedenen Komponenten des Angstzustandes Besorgtheit (irrelevante Gedanken, Anspannung, Körpersymptome) bleiben unberücksichtigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Interkorrelationen zwischen diesen Variablen sind äußerst gering. Validität kommt nur der Selbstbeschreibung zu (aufgrund der expliziten Abfrage von Angstgefühlen).
Besorgtheit und emotionale Erregung
Moderne Angstforschung trennt zwischen den Zustandsangstqualitäten „emotionale Erregung“ und „Besorgtheit“(Liebert&Morris 1967).
-Besorgtheit = kognitiver Aspekt des Angsterlebens(Sorgen machen, sich keine Blöße geben)
-Emotionale Erregung = subjektive Wahrnehmung und Einschätzung von Körpersymptomen Beide sind zwar nicht unabhängig voneinander, jedoch verschieden verhaltenswirksam. z.B.: Leistungsbeeinträchtigung im Zusammenhang mit Besorgtheit
Sarason (1984) nahm auf der Trait-Ebene eine Differenzierung innerhalb der ursprünglichen Zustandsangstqualitäten vor. Bei kognitiver Komponente kann zwischen Selbstzweifel (ich mache mir Sorgen) und aufgabenirrelevanten Kognitionen (meine Gedanken sind ganz woanders) unterschieden werden. Bei der emotionalen Komponente lässt sich das Gefühl der Anspannung (ich fühle mich belastet und unruhig) von der Wahrnehmung verschiedener Körpersymptome(Herz schlägt schneller) trennen.
Hodapp (1991) extrahierte durch Faktorenanalyse von Prüfungsangst 4 Faktoren (Mangel an Zuversicht, Aufgeregtheit, Besorgtheit & Interferenz). Mangel an Zuversicht beschreibt Feststellungen der Leistungserwartung. (Interferenz = hemmende Wechselwirkung zwischen Fertigkeiten).
(Angst und Aktivierung)
Um den Aktivierungs-/Erregungszustand eines Individuums zu beschreiben, benötigen wir nur die zwei Dimensionen der Angst und Aktivierung. Die Angstdimension variiert zwischen Ruhe und Erregung, die Aktivierungsdimension zwischen Schlaf und Wachheit. Hohe Ausprägung der Angst(Erregung) ist unangenehm, hohe Ausprägung der Aktivierung(Wachheit) ist angenehm. (Beide Dimensionen hängen schwach negativ miteinander zusammen.)
Zwei Systeme sind bei der Aktivierungsregulation im zentralen Nervensystem beteiligt, das limbische System und die Retikulärformation. Letztere reguliert das Schlaf-Wach-Geschehen. Das limbische System steuert den Ruhe-Erregungszustand
Angst und Leistung
Ängstlichkeit und Leistung
Das Trait-State-Angstmodell behandelt Leistung nicht gesondert. Untersuchungen zeigen aber, das nur bestimmte Kategorien motorischer Prozesse(beobachtbar) beeinträchtigt werden. Diese Prozesse liegen auf einem Komplexitätskontinuum von einfachen bis hin zu hyperkomplexen sprachlich-kognitiven Prozessen. Ausgangspunkt war die Triebtheorie(Taylor 1956) und deren Hypothese über die Aufmerksamkeitsbegrenzung. Später wurden Untersuchungen hinsichtlich Prüfungsangst von größerer Relevanz. Taylor behauptete, das sich Verhalten durch zwei Variablen vorhersagen lässt, fähigkeitsbezogene bzw. motivierende Variablen (Ängstlichkeit) Aufmerksamkeitsbegrenzungshypothese : Erregung ↑ Aufmersamkeit ↓ Prüfungsangsttheorie postuliert angstabhängige Leistungsverschlechterungen durch Befassen mit aufgabenirrelevanten, den Selbstwert betreffenden Aspekten von Leistungssituationen
Der Zusammenhang zwischen Angst und Leistung wird durch 2 Variabelengruppen beeinflusst :
- motivationale Variablen (angst- & bedrohungsspezifischer Anregungsgehalt der Situation, in der die Leistung erbracht werden soll)
- Aufgabenmerkmale (Schwierigkeit, Komplexität)
Personenmerkmale (Intelligenz, Verfügbarkeit von Reaktionen im Zhang mit der Aufgabenschwierigkeit (Fähigkeitsvariablen))
Daraus resultiert laut Eysenck (1982) und Fröhlich (1983) :
Hochängstliche-Leistung↓ je schwieriger +komplexer Aufgabe Je weniger Hilfen, Zeit Je weniger intelligent VP ist.
Ändern sich o.g. Variablen in entgegengesetzte Richtung , kommen sie Hochängstlichen zu gute
Zustandsangst und Leistung
O.g. Untersuchungen sollen zeigen, dass Unterschiede in der Angstdisposition mit analogen Unterschieden in der Zustandsangst zusammenhängen. Wenn Angst sowohl als Zustand als auch als Eigenschaft erfasst wird, so erkennt man das Zustandsangst, nicht aber Eigenschaftsangst mit der Leistung einhergehen.
Bei den Untersuchungen von Hall 1970 und Spielberger 1969 wurde Leistung aber nicht als Prozess sondern nur als reproduktiver Akt gesehen.
(Prozess: mit den Phasen Wahrnehmung, Reizauswahl, Speicherung, Abruf aus dem Gedächtnis, und motorische Komponente der Leistungsäußerung).
Ein weiteres Problem ist die konkrete Isolation des Aspektes der Zustandsangst, der die Leistungsverschlechterung bedingt.
Somit sind es nur Hinweise, die uns annehmen lassen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bewältigung von Angst
Bewältigung ist ein Prozess, der postemotional (auf erfolgten, anhaltenden Angstzustand, der als quälend empfunden wird) aber auch präemotional (Einschätzung einer bevorstehenden Stresssituation) einsetzen kann. Lazarus definiert 1991
Definition Bewältigung: kognitive, handlungsbezogene Bemühung mit Anforderungen fertig zuwerden, die die Ressourcen einer Person beanspruchen oder übersteigen Sie ist der Versuch, die Diskrepanz zwischen Anforderungen und Mglkt. zu beseitigen. Auch das Misslingen gilt als Bewältigung.
Bewältigungsmodelle
Hinsichtlich der Angstbewältigung gibt es 2 Modelle. Das EB-Modell beschreibt die Situation einer ausgelösten Emotion und der daraus resultierenden Bewältigung. Durch das Bewältigen an sich, wird die Bewältigung selbst zum Faktor/ Mediator. D.h.durch das Wissen erfolgter Bewältigungen verändert sich die Haltung gegenüber angstauslösender Situationen. Dies wird durch das BE-Modell zum Ausdruck gebracht.
Qualität und Intensität der ausgelösten Emotionen werden durch die Bewältigungsprozesse bestimmt. Beide Modelle schließen sich nicht aus, es können nacheinander beide Formen der Beziehungen zwischen Angst und Bewältigung auftreten.
Ängstlichkeit, Angst und Bewältigung
Dem Trait-State-Angstmodell zufolge initiieren Angstzustände Bewältigungsreaktionen, die zur Verringerung der Angst führen sollen. (konform EB-Modell)
Durch Schutzmaßnahmen wird ein potentieller Stressor als weniger bedrohlich eingeschätzt, was die Intensität der Zustandsangst vermindert (BE-Modell).
Beim Trait-State-Angstmodell kommt noch der Traitfaktor „Angstneigung„ dazu Bolger (1990) stellte fest, dass Persönlichkeitseigenschaften wie Neurotizismus und Ängstlichkeit(Äquivalente Konzepte laut Bolger), die Auswahl der Bewältigungsreaktionen bestimmen und diese dann als Mediator Einfluss nehmen auf den Angstzustand(BE-M).
Untersuchungen zeigten dem Trait-State-Modell entsprechend : Neurotizismus/Ängstlichkeit mit Steigerung der Zustandsangst verbunden sind. Der Neurotizismus bestimmte im wesentlichen die Bewältigungsreaktion und diese wiederum die Angst. Kommen wir nun zu Selbstwertschutz und Selbstdarstellungsansätzen (der Angst)
Bedrohung des Selbstwertes taucht in fast allen Modellen, Theorien und Konzepten der Angst auf. Und obwohl diese Ansätze nicht ohne die Selbstwertbedrohung auszukommen scheinen, ist sie nirgendwo tragendes Leitthema.
Anders bei den Ansätzen von Schlenker und Leary (1982) . Der konsequente Selbstwertbezug kennzeichnet ihren Selbstdarstellungsansatz. Mehr noch. Sie greifen auch unterschiedliche Konzepte der Angstforschung auf und binden diese integrativ ein.
(Angst als Folge von Selbstdarstellungsproblemen)
Das Basispostulat
Soziale Angst beschreibt die Angst vor der erwarteten und tatsächlichen Bewertung durch andere. Mit sozial sind reale Situationen gemeint. Soziale Angst und Leistungsangst sind miteinander verknüpft, da Leistung häufig Gegenstand einer Öffentlichen Bewertung ist. Selbstdarstellung steht für den Versuch, bestimmte Selbstbilder zu vermitteln. Nach diesen Eindrücken werden wir von anderen oder uns selbst beurteilt, wobei es keine Verstellungen sein müssen. Die Projektion von Selbstbildern erfolgt gegenüber real vorhandenen und imaginären Interaktionspartnern bis hin zum eigenen Selbst.
Beispielsweise möchte man als kompetent angesehen werden, zweifelt aber an der Vermittlung dieses Eindruckes.
Diese Zweifel/Angst bilden den Kern des Basispostulats.
Demnach ist die Motivation, einen bestimmten Eindruck zu vermitteln eine notwendige aber nicht ausreichende Bedingung für soziale Angst. Dazu kommt der Zweifel, ob die Eindrücke hervorgerufen werden können. Geschieht das nicht, so ist das Selbstwertgefühl in Gefahr. Durch das Basispostulat kann man situative und dispositionelle Faktoren bezüglich der Angst einordnen. Bsp.: Charakteristika anderer Interaktionspartner (einflussreiche Personen...)
Evaluative Relevanz (1.Eindruck, Größe Publikum)
Um soziale Angst zu empfinden muss man sich selbst als soziales Objekt sehen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit anderer Personen zu stehen führt zu öffentlicher Selbstaufmerksamkeit. Ist die dispositionelle öffentliche Selbstaufmerksamkeit groß so steigt auch die Selbstdarstellungsmotivation.
Alle Persönlichkeitsmerkmale, die die Motivation erhöhen, können sich angstfördernd auswirken (Furcht vor negativer Beurteilung, Orientierung an anderen)
( Informationsprüfung und emotionale Reaktion)
Wird Situation als bedrohlich eingestuft, so beginnt Prozess zum Schutz des Selbstwertes. Dabei ist die Informationsprüfung einer der wichtigsten Prozesse.
Bsp : schlechtes Abschneiden IQ-Test führt zu Informationssuche betreffend der Validität von IQ-Tests
Prozess:
Nach initialer Bedrohlichkeitseinschätzung setzt Angst ein. Es folgt eine genauere Begutachtung.
Resultiert aus Begutachtung die Erwartung sich gut darstellen zu können, ruft das positive Emotionen hervor. (Spezialfall Selbst-Wirksamkeits-Erwartung Bandura 1977).
In dieser Phase hoher Selbstaufmerksamkeit sollen sich sogar Hochängstliche wohlfühlen. Die nachgewiesene Leistungserhöhung wird durch stärkere Konzentration auf aufgaberelevante Informationen erklärt(Schlenker 1987).
Das widerlegt den Ansatz der Leistungsforschung, das Selbstaufmerksamkeit bei Hochängstlichen immer zu erhöhter Besorgtheit/Leistungsabfall führt. Schließt Begutachtung selbstbezogener Informationen mit niedriegen Selbtwirksamkeitserwartungen ab, dann resultiert Angst. Ist kein Rückzug aus der Situation möglich so verharrt die Person in der Erfassungsphase und überprüft andauernd und exzessiv Selbst- und Situationsinformationen.
(Selbstdarstellung bei der Bewältigung von Angst)
Selbstdarstellungsprobleme entstehen, wenn bei der Vermittlung von Selbstbildern schon Angst vorliegt.
Bsp.: Einstellungsinterview; mdl. Prüfung
Zum Ereignis an sich kommt nun noch die Angst als vorgreifende Emotion dazu. Bedrohlichkeitsgehalt der Angst besteht in:
a) Validierung der Selbstwertbedrohung - das was bisher nur auf der Ebene bedrohlicher Gedanken stattfand, hat sich zu einem körperlich wahrnehmbaren Affekt entwickelt.
b) Angst vor dem Sichtbarwerden der Angst
Ausgelöste Angst vergrößert Befürchtung, den angestrebten Eindruck nicht zu vermitteln - die interne Unsicherheit wird für andere sichtbar Die besonders bei Hochängstlichen ausgeprägte Sorge, andere könnten ihre Angst bemerken, erweist sich empirisch als unbegründet. Das Ausmaß der von den Interaktionspartnern registrierten Angst ist sehr gering.
(Verbergen von Angst)
Das Sichtbarwerden der Angst wird gleichgesetzt mit dem Nichterreichen des gewünschten Eindruckes.→ Verbergen der Angst
Laux und Weber (1991) stellten fest, das soz. Angst viel stärker durch das Nichtzeigen des Gefühls bewältigt wird. Bei Angst geht es im Gegensatz zum Ärger darum, Aufsehen zu vermeiden.
Studierende mit hoher Zustandsangst sollen eine stark defensive Absichtsstruktur aufweisen. Sie wollen ihre Schwächen und Anfälligkeiten verbergen, um vor anderen gut dazustehen.
(Strategisches Mitteilen von Angst)
Normales gängiges Reaktionsmuster besteht aus Verbergen der Angst + kognitive Form der Angstverringerung
Laux und Glanzmann(1986) zeigten, das das Trait-State-Angstmodell nur dann stimmt, wenn die Angstreaktion unmittelbar nach dem bedrohlichen Ereignis retrospektiv erfasst wird. In der Situation selber reagieren Hochängstliche nicht anders als Niedrigängstliche. Man nimmt an, das Hochängstliche danach ein höheres Ausmaß an Zustandsangst angeben um vorsorglich das Auftreten von möglichen Leistungsdefiziten zu erklären.
Ein ähnliches Bewältigungsmuster arbeiteten Jones und Berglas (1978) mit der sog. „Selbstbehinderung“ heraus.
„ Ich bin furchtbar nervös, Ich vergesse bestimmt, was ich sagen wollte“
Symptome sozialer Angst werden strategisch eingesetzt, um von vermeintlichen oder vorhandenen Defiziten im Bereich von Fähigkeit und Kompetenz abzulenken.
Man opfert das Selbstbild des Nichtaufgeregten, um das des Leistungsfähigen zu schützen.
Differentialpsychologische Modelle
Die Aufteilung in Hoch und Niedrigängstliche stellen unterschiedliche differentialpsychologische Modelle dar, die man als quantitative und qualitative Konzeptionen der Ängstlichkeit sehen kann.
Problematisch an all diesen Ansätzen ist die statische Grundauffassung. Bewältigen über längere biographische Zeiträume wird nicht thematisiert.
Wie wirkt sich permanentes erfolgloses Bewältigen aus. Führt die negative Spirale von Angsterhöhung und inadäquater Bewältigung in den Bereich der klinischen Angst. Es ist kaum vorstellbar, das es eine stabile Zuordnung gibt, in die man immer wieder zurückgeholt wird, wenn man dabei ist die Trait-Kategorie zu verlassen. Abschließen will ich meinen Vortrag mit einer dynamische Eigenschaftsauffassung, die Allport schon 1970 äußerte:
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptkomponenten der Zustandsangst laut dem Trait-State-Angstmodell?
Laut dem Trait-State-Angstmodell wird Angst als ein unidimensionales Konstrukt betrachtet, wobei die verschiedenen Komponenten wie Besorgtheit, Anspannung und Körpersymptome nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Wie unterscheidet sich moderne Angstforschung vom Trait-State-Angstmodell?
Die moderne Angstforschung trennt zwischen den Zustandsangstqualitäten "emotionale Erregung" und "Besorgtheit". Besorgtheit bezieht sich auf den kognitiven Aspekt des Angsterlebens (Sorgen machen), während emotionale Erregung die subjektive Wahrnehmung von Körpersymptomen beschreibt.
Welche Differenzierungen nahm Sarason (1984) auf der Trait-Ebene innerhalb der Zustandsangstqualitäten vor?
Sarason unterschied bei der kognitiven Komponente zwischen Selbstzweifel und aufgabenirrelevanten Kognitionen. Bei der emotionalen Komponente trennte er das Gefühl der Anspannung von der Wahrnehmung verschiedener Körpersymptome.
Welche Faktoren extrahierte Hodapp (1991) durch Faktorenanalyse von Prüfungsangst?
Hodapp extrahierte vier Faktoren: Mangel an Zuversicht, Aufgeregtheit, Besorgtheit und Interferenz (hemmende Wechselwirkung zwischen Fertigkeiten).
Wie hängen Angst und Aktivierung zusammen?
Angst und Aktivierung werden als zwei Dimensionen beschrieben, die den Aktivierungs-/Erregungszustand eines Individuums bestimmen. Angst variiert zwischen Ruhe und Erregung, Aktivierung zwischen Schlaf und Wachheit. Hohe Angst wird als unangenehm, hohe Aktivierung als angenehm empfunden.
Wie beeinflusst Ängstlichkeit die Leistung?
Das Trait-State-Angstmodell behandelt Leistung nicht gesondert. Untersuchungen zeigen jedoch, dass nur bestimmte Kategorien motorischer Prozesse, insbesondere komplexe sprachlich-kognitive Prozesse, beeinträchtigt werden. Die Aufmerksamkeitsbegrenzungshypothese und die Prüfungsangsttheorie spielen hierbei eine Rolle.
Welche Variablen beeinflussen den Zusammenhang zwischen Angst und Leistung?
Der Zusammenhang wird durch motivationale Variablen (angstspezifischer Anregungsgehalt der Situation), Aufgabenmerkmale (Schwierigkeit, Komplexität) und Personenmerkmale (Intelligenz, Verfügbarkeit von Reaktionen) beeinflusst.
Was besagt das EB- und BE-Modell hinsichtlich der Angstbewältigung?
Das EB-Modell beschreibt die Situation einer ausgelösten Emotion und der daraus resultierenden Bewältigung. Das BE-Modell besagt, dass die Bewältigung die Qualität und Intensität der ausgelösten Emotionen beeinflusst.
Wie beeinflusst die Angstneigung (Traitfaktor) die Bewältigung von Angstzuständen?
Bolger (1990) stellte fest, dass Persönlichkeitseigenschaften wie Neurotizismus und Ängstlichkeit die Auswahl der Bewältigungsreaktionen bestimmen, die wiederum den Angstzustand beeinflussen.
Was ist das Basispostulat des Selbstdarstellungsansatzes von Schlenker und Leary (1982)?
Das Basispostulat besagt, dass soziale Angst die Angst vor der erwarteten und tatsächlichen Bewertung durch andere ist. Die Motivation, einen bestimmten Eindruck zu vermitteln, ist eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für soziale Angst. Es kommt der Zweifel hinzu, ob die gewünschten Eindrücke hervorgerufen werden können.
Wie wird das Verbergen von Angst bei der Bewältigung von Angst eingesetzt?
Das Sichtbarwerden der Angst wird gleichgesetzt mit dem Nichterreichen des gewünschten Eindruckes, weshalb Angst oft verborgen wird. Laux und Weber (1991) stellten fest, dass soziale Angst viel stärker durch das Nichtzeigen des Gefühls bewältigt wird.
Was ist die "Selbstbehinderung" nach Jones und Berglas (1978) im Zusammenhang mit Angst?
Symptome sozialer Angst werden strategisch eingesetzt, um von vermeintlichen oder vorhandenen Defiziten im Bereich von Fähigkeit und Kompetenz abzulenken. Man opfert das Selbstbild des Nichtaufgeregten, um das des Leistungsfähigen zu schützen.
Was ist problematisch an den differentialpsychologischen Modellen zur Ängstlichkeit?
Problematisch ist die statische Grundauffassung. Bewältigen über längere biographische Zeiträume wird nicht thematisiert.
- Quote paper
- Holger Semsch (Author), 2001, Zustandsangst etc., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101539