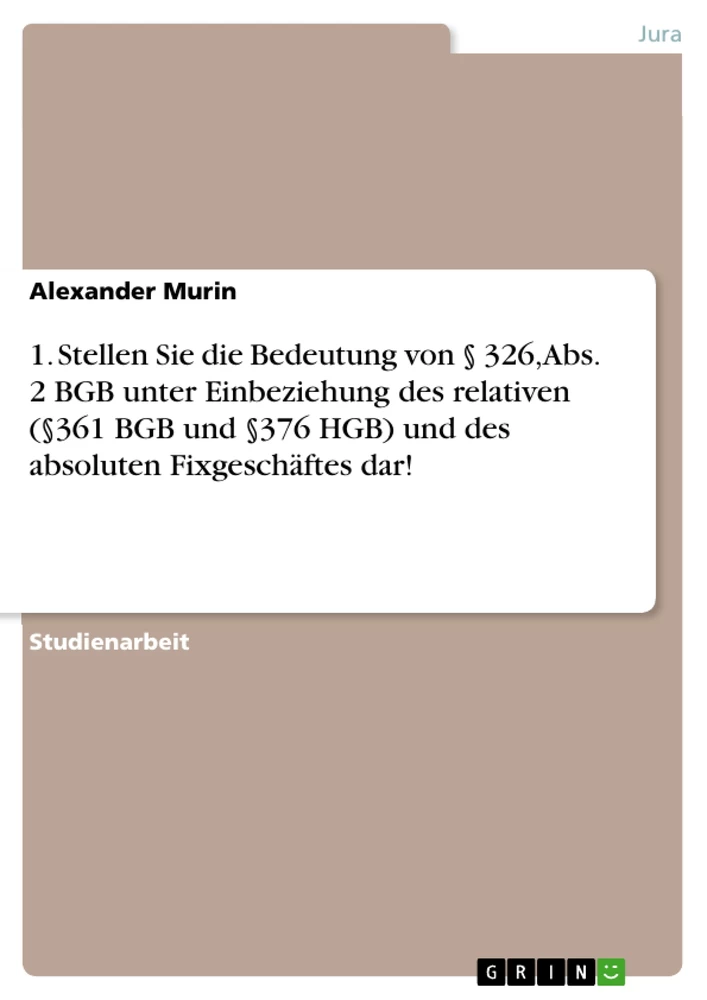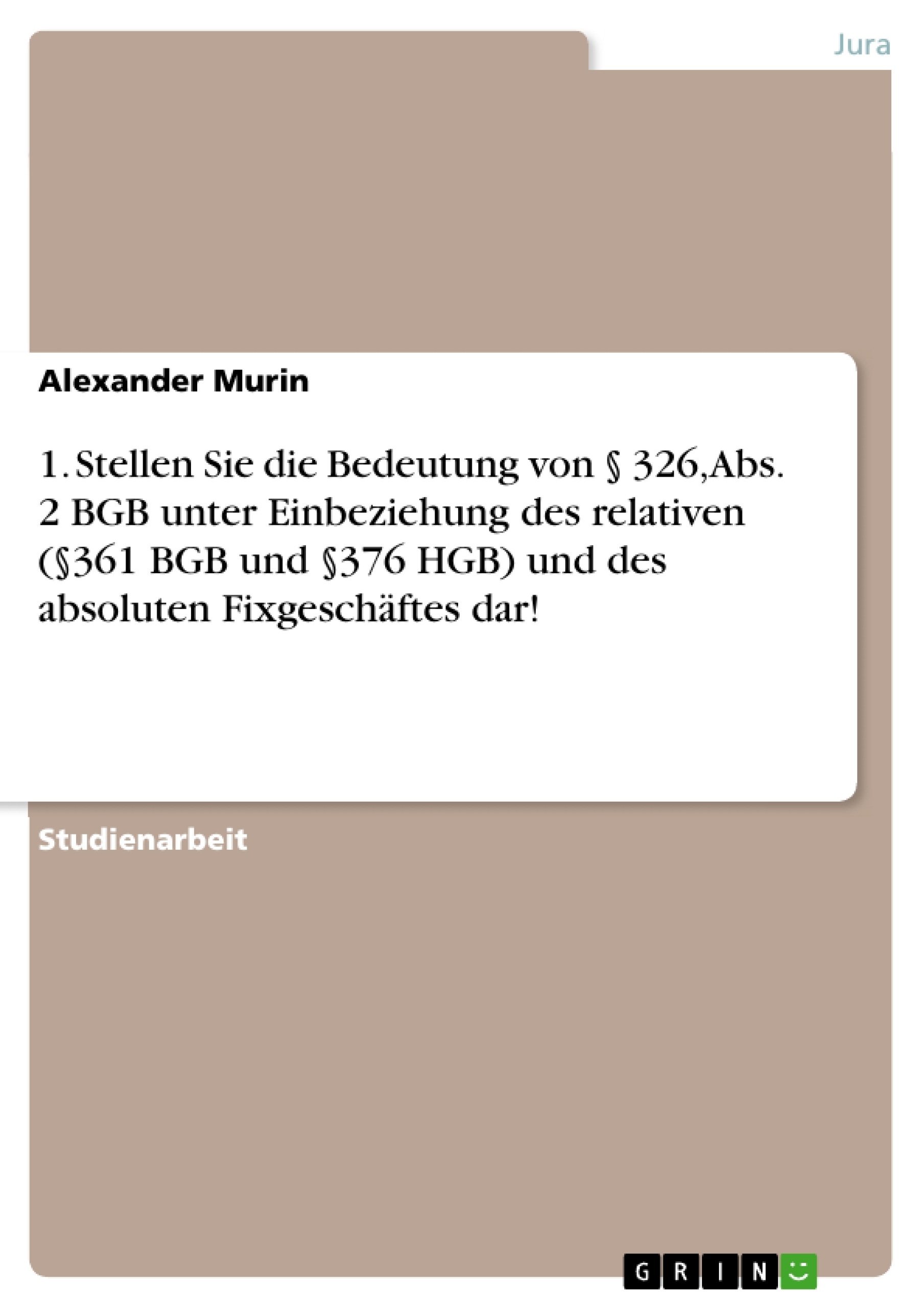Was tun, wenn sich die Geschäftswelt gegen Sie verschworen hat und Verträge plötzlich wertlos erscheinen? Dieser Band seziert die komplexen Fallstricke des § 326 Abs. 2 BGB im Kontext von Fixgeschäften und Leistungsstörungen. Erfahren Sie, wie sich relative und absolute Fixgeschäfte unterscheiden und welche Auswirkungen dies auf Ihre vertraglichen Ansprüche hat. Anhand praxisnaher Beispiele, wie etwa Saisongeschäfte bei Lieferverzug oder Weiterverkäufe mit Abnahmeverweigerung, wird die Bedeutung des "Interessenfortfalls" für Käufer und Verkäufer beleuchtet. Die Analyse zeigt, wann ein Käufer aufgrund verspäteter Lieferung vom Vertrag zurücktreten kann und wann nicht, insbesondere im Hinblick auf § 361 BGB und § 376 HGB. Untersucht werden auch Situationen, in denen der Verkäufer die Ware anderweitig gewinnbringender veräußern könnte oder der Käufer aufgrund von Fehleinschätzungen des Marktes weniger Ware benötigt. Die klare Strukturierung und die präzisen Erläuterungen machen dieses Werk zu einem unverzichtbaren Ratgeber für Juristen, Wirtschaftsfachleute und Studierende, die sich mit den Feinheiten des Leistungsstörungsrechts auseinandersetzen müssen. Verstehen Sie die Rechte und Pflichten im Detail und navigieren Sie sicher durch die Untiefen des BGB, um Ihre Interessen optimal zu schützen. Die Schwerpunkte liegen auf dem Schuldnerverzug, der Unmöglichkeit der Leistung und den daraus resultierenden Ansprüchen. Lassen Sie sich nicht von komplizierten Vertragsklauseln einschüchtern – dieses Buch liefert Ihnen das nötige Know-how, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Position im Geschäftsleben zu stärken. Ein unverzichtbarer Leitfaden, um die Dynamik von Angebot und Nachfrage im Spannungsfeld von Recht und Wirtschaft zu meistern und die Fallstricke des Handelsrechts zu überwinden.
Inhaltsverzeichnis
1. Stellen Sie die Bedeutung von § 326, Abs. 2 BGB unter Einbeziehung des relati- ven (§361 BGB und §376 HGB) und des absoluten Fixgeschäftes dar!
2. Diskutieren und systematisieren Sie folgende Fälle unter dem Aspekt, ob und ggfs. warum es sich uns einen Anwendungsfall von § 326, Abs. 2 BGB handelt:
2.1. Bei einem Saisongeschäft hat der Käufer infolge verspäteter Leistung für die Ware keine Verwendung mehr
2.2. Der Käufer veräußert die Ware schon vor der Lieferung weiter, sein Ab- nehmer lehnt aber später infolge Lieferungsverzögerung die Abnahme ab und eine vergleichbare Verkaufsmöglichkeit besteht nicht.
2.3. Möglichkeit des Verkäufers, die Ware anderweitig zu einem höheren Preis zu verkaufen.
2.4. Der Käufer hat infolge falscher Beurteilung der Marktentwicklung nur Ver- wendung für eine geringere Menge als ursprünglich vorgesehen.
1. Stellen Sie die Bedeutung von§326, Abs. 2 BGB unter Einbeziehung des relati- ven (§361 BGB und§376 HGB) und des absoluten Fixgeschäftes dar!
Der Interessenfortfall hat in §286 II BGB und §326 II BGB die gleiche Bedeutung, wobei bei gegenseitigen Veträgen der §326 II BGB vor geht und §286 II BGB verdrängt. Hier hat der Gläubiger mehr Rechte. Bei einseitig verpflichtenden Verträgen besteht der Interessenfortfall immer fort.
§326 II BGB gibt dem Gläubiger im gegenseitigen Vertrag die im §326 I BGB genannten Rechte auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder Rücktritt vom Vertrag, wenn er durch den Verzug kein Interesse mehr an der Erfüllung des Vertrages hat - ohne das Erfordernis einer Nachfristsetzung.
Unerheblich herbei ist, ob der Schuldner den Interessenfortfall voraussehen konnte.
Im Gegensatz zum Absoluten Fixgeschäft muss hierbei der Leistungszeitpunkt nicht zum Inhalt der Leitungspflicht des Schuldners werden. Hier würden nicht die Rechts- folgen des §362 II BGB gelten, sondern, wenn das Verstreichen des Leistungszeit- punktes den Tatbestand der zeitlichen Unmöglichkeit erfüllt, die Folgen der §§ 275 ff BGB bzw. §§323 ff BGB. Dies wäre z.B. der Fall, wenn der Gläubiger Konzertkarten an einem bestimmten Abend, an dem eine prominente Sängerin, die nur an diesem Abend ein Konzert gibt, reserviert, diese aber erst am Tag nach dem Auftritt erhält.
Wird der Tatbestand der Unmöglichkeit nicht durch das Verstreichen eines Leis- tungszeitpunktes bestimmt, so liegt ein relatives Fixgeschäft vor. Dies wäre in o.g. Beispiel der Fall gewesen, wenn das Konzert vorher um zwei Wochen verschoben worden wäre, d.h. die Karten waren zwar nicht zu dem vereinbarten Termin ange- kommen, der Besuch des Konzerts wäre aber an sich noch möglich. Da aber nicht sicher ist, dass der Gläubiger an dem zweiten Termin nicht verhindert ist, kann er gemäß § 361 BGB vom Vertrag zurücktreten. Bei relativen Fixgeschäft wird also der Leistungszeitpunkt nicht zum Inhalt der Leistungspflicht des Schuldners.
Unter Kaufläuten gilt §326 I HGB. Er wandelt den Anspruch auf Erfüllung in einen Schadensersatzanspruch um, sofern der Gläubiger nicht nach Ablauf der Frist auf Erfüllung besteht.
2.1 Bei einem Saisongeschäft hat der Käufer infolge verspäteter Leistung für die Ware keine Verwendung mehr.
Ist eine Lieferung zu spät angekommen, ist zu prüfen, ob es sich um eine nach dem Kalender bestimmten Leistungszeitraum handelt oder der Verkäufer angemahnt wurde, d.h. ob der Verkäufer in Verzug ist. Da es sich hier um ein Saisongeschäft handelt, ist davon auszugehen, dass es höchstwahrscheinlich ein relatives Fixgeschäft ist, z.B. Sommer- / Winterbekleidung. Unter Umständen kann es sich auch ein absolutes Fixgeschäft handeln, z.B. Weihnachten ist immer am 24. Dezember.
Da der Käufer nach dem Termin den Vertragsgegenstand nicht mehr oder nur schwer verkaufen kann, hat er daher kein Interesse mehr an der Erfüllung des Vertrages. Hiermit sind die Bedingungen des §326 II BGB erfüllt.
Es besteht also ein adäquater kausaler Zusammenhang zwischen dem Schuldnerverzug und dem Interessenfortfall des Käufers.
⇨ Ein Interessenfortfall ist zu bejahen!
2.2 Der Käufer veräußert die Ware schon vor der Lieferung weiter, sein Abnehmer lehnt aber später infolge Lieferungsverzögerung die Abnahme ab und eine ver gleichbare Verkaufsmöglichkeit besteht nicht.
Grund für den Abschluss des Vertrages für den Käufer war die Möglichkeit, die Ware an einen bestimmten Abnehmer verkaufen zu können.
Da es nun aber dem Käufer der Ware nicht mehr möglich ist, die Ware an Abnehmer weiterzuverkaufen, hat er kein Interesse mehr an der Erfüllung des Vertrages. Die Bedingungen des $326 II BGB sind also auch hier erfüllt.
Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Interessenfortfall des Käufers an der Erfüllung des Vertrages und dem Schuldnerverzug des Verkäufers.
⇨ Ein Interessenfortfall ist zu bejahen!
2.3 Möglichkeit des Verkäufers, die Ware anderweitig zu einem höheren Preis zu verkaufen.
Hier hat der Käufer noch Interesse an der bestellten Ware. Da es sich um einen ge- geseitigen Vertrag handelt hat der Verkäufer die Ware zu dem bestimmten Preis an den Käufer zu veräußern. Hier greifen unter anderem die §§145ff. BGB, in denen bestimmt wird, dass man an einen Antrag zum Abschluss eines Vertrages gebunden ist, sofern die Gebundenheit nicht ausgeschlossen wurde. Weiterhin verpflichtet §433 I1 BGB den Verkäufer, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Für das gesamte Vertragsrecht gilt der Grundsatz „pac- ta sunt servanda“, d.h. Verträge sind grundsätzlich einzuhalten, außer sie verstoßen gegen ein Gesetz (§134 BGB).
In diesem Fall ist ein Interessenfortfall im Sinne des §326 II BGB nicht gegeben, da hier kein Verzug vorliegt.
⇨ Ein Interessenfortfall ist zu verneinen!
2.4 Der Käufer hat infolge falscher Beurteilung der Marktentwicklung nur Verwe n- dung für eine geringere Menge als ursprünglich vorgesehen.
Der Käufer hat kein Interesse mehr an der bestellten Menge, jedoch steht dies in keinem Zusammenhang mit dem eventuellen Verzug, falls dieser überhaupt vorliegt.
Die Voraussetzungen für einen Interessenfortfall im Sinne des §326 II BGB sind daher nicht gegeben, da hierfür als Voraussetzung ein Verzug vorliegen muss.
⇨ Ein Interessenfortfall ist zu verneinen!
Übersicht des Schuldnerverzuges
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Bedeutung von § 326, Abs. 2 BGB im Zusammenhang mit relativen und absoluten Fixgeschäften?
§ 326 II BGB gewährt dem Gläubiger bei gegenseitigen Verträgen die Rechte aus § 326 I BGB (Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder Rücktritt vom Vertrag), wenn er aufgrund des Verzugs des Schuldners kein Interesse mehr an der Erfüllung hat, ohne dass eine Nachfristsetzung erforderlich ist. Im Gegensatz zum absoluten Fixgeschäft wird hierbei der Leistungszeitpunkt nicht zwingend zum Inhalt der Leistungspflicht des Schuldners. Bei einem relativen Fixgeschäft hingegen wird der Leistungszeitpunkt nicht zum Inhalt der Leistungspflicht des Schuldners, jedoch kann der Gläubiger gemäß § 361 BGB vom Vertrag zurücktreten.
Was passiert, wenn ein Käufer bei einem Saisongeschäft die Ware aufgrund verspäteter Lieferung nicht mehr verwenden kann?
Wenn die Lieferung zu spät erfolgt und es sich um ein relatives Fixgeschäft (z.B. Sommer-/Winterbekleidung) handelt, bei dem der Käufer die Ware nach dem Termin nicht mehr oder nur schwer verkaufen kann, hat er kein Interesse mehr an der Erfüllung. Somit sind die Bedingungen des § 326 II BGB erfüllt, und es besteht ein adäquater kausaler Zusammenhang zwischen dem Schuldnerverzug und dem Interessenfortfall des Käufers.
Was ist, wenn der Käufer die Ware vor der Lieferung weiterverkauft, der Abnehmer aber aufgrund der Lieferungsverzögerung die Abnahme ablehnt?
Wenn der Grund für den Vertragsabschluss des Käufers die Möglichkeit war, die Ware an einen bestimmten Abnehmer zu verkaufen, und dies nun aufgrund der Lieferungsverzögerung nicht mehr möglich ist, hat der Käufer kein Interesse mehr an der Erfüllung. Die Bedingungen des § 326 II BGB sind somit erfüllt, und es besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Interessenfortfall des Käufers und dem Schuldnerverzug des Verkäufers.
Wie ist die Situation zu beurteilen, wenn der Verkäufer die Ware anderweitig zu einem höheren Preis verkaufen könnte?
In diesem Fall hat der Käufer weiterhin Interesse an der bestellten Ware. Da es sich um einen gegenseitigen Vertrag handelt, ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zu dem vereinbarten Preis an den Käufer zu veräußern (siehe §§ 145ff. BGB, § 433 I1 BGB, "pacta sunt servanda"). Ein Interessenfortfall im Sinne des § 326 II BGB liegt hier nicht vor, da kein Verzug vorliegt.
Was passiert, wenn der Käufer infolge falscher Markteinschätzung nur eine geringere Menge der Ware benötigt?
Obwohl der Käufer kein Interesse mehr an der bestellten Menge hat, besteht kein Zusammenhang mit einem eventuellen Verzug des Verkäufers. Die Voraussetzungen für einen Interessenfortfall im Sinne des § 326 II BGB sind nicht gegeben, da ein Verzug Voraussetzung dafür ist.
- Quote paper
- Alexander Murin (Author), 2000, 1. Stellen Sie die Bedeutung von § 326, Abs. 2 BGB unter Einbeziehung des relativen (§361 BGB und §376 HGB) und des absoluten Fixgeschäftes dar!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101536