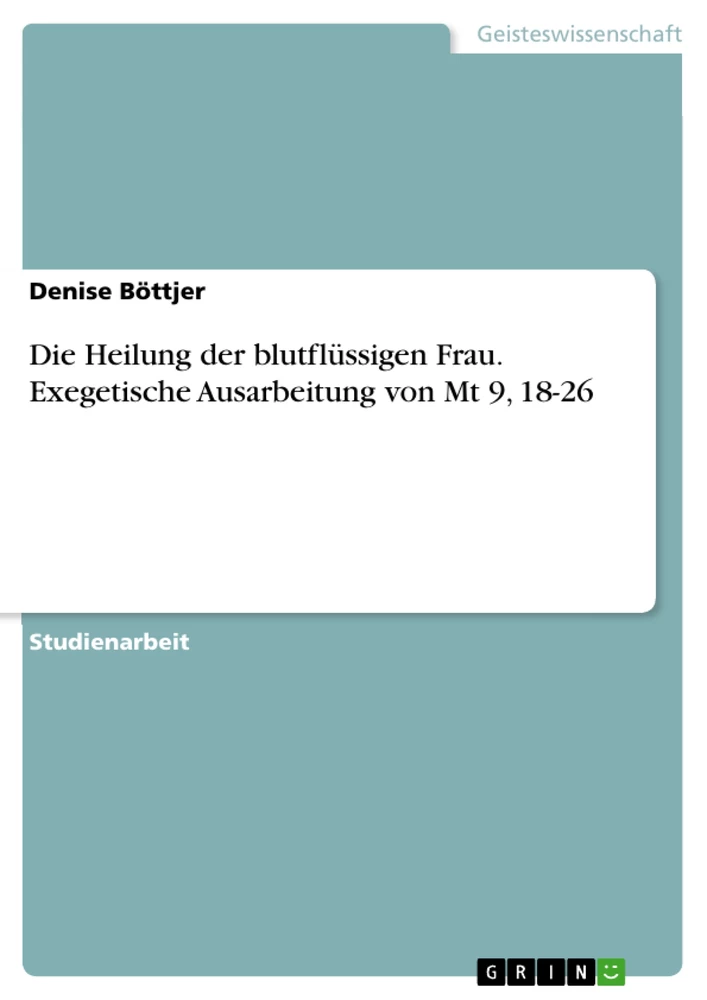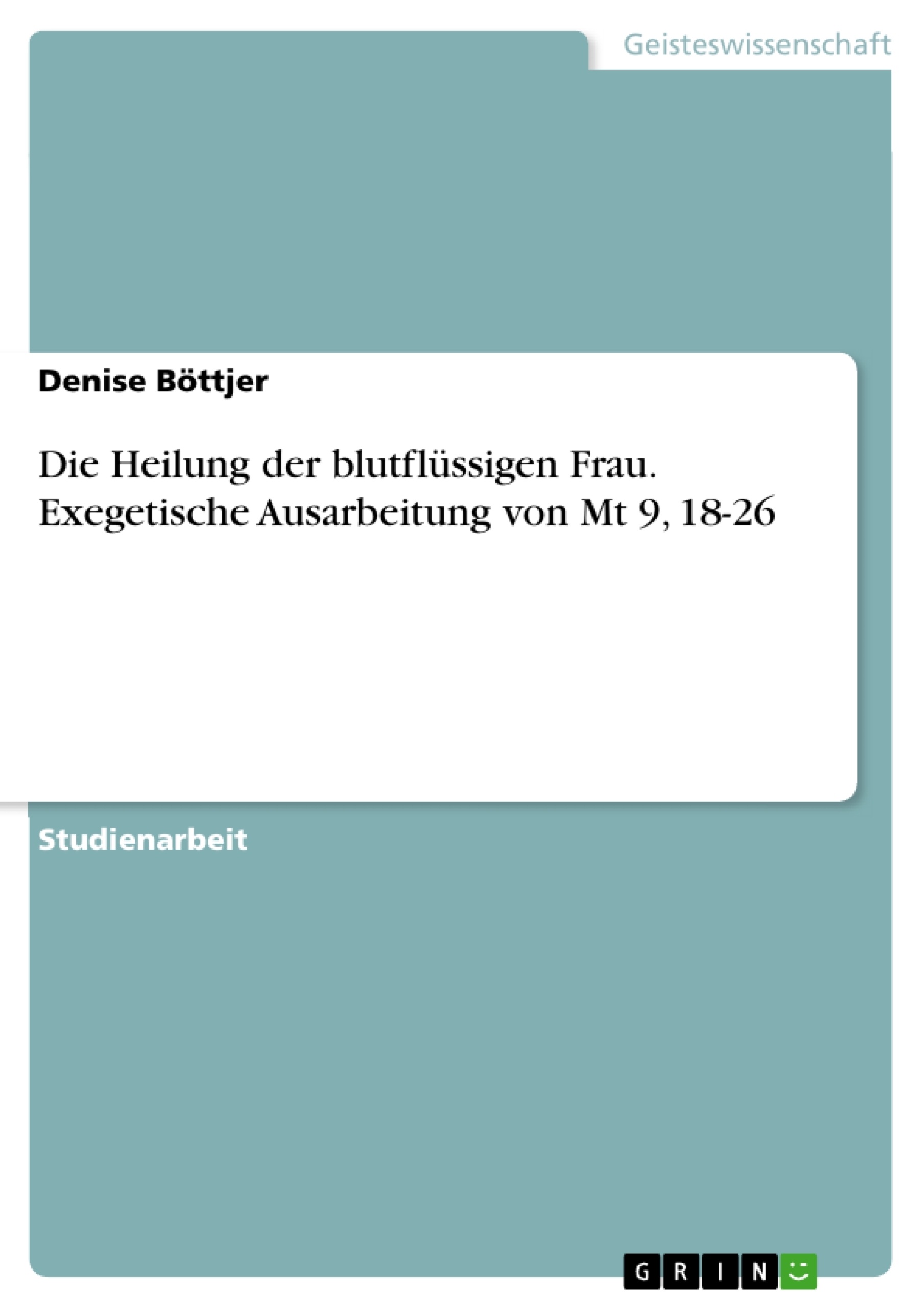In der vorliegenden Arbeit wird mit Hilfe von unterschiedlichen Arbeitsmethoden einer Exegese, unter anderem Literarkritik, Begriffsgeschichte und Redaktionsgeschichte, die Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium 9 Verse 18-26 interpretiert, analysiert und verglichen, um somit die historischen und textlichen Zusammenhänge zu verdeutlichen.
Die Stelle ist im Neuen Testament im Matthäusevangelium zu finden und bezieht sich auf die Heilung einer Frau, welche seit Jahren unter Blutungen leidet, sowie die Auferweckung der Tochter eines vornehmen Mannes. In dieser Bibelstelle wird Jesus vom Volk verspottet, als er berichtete, dass das Mädchen nicht tot sei, sondern schlafen würde. Nachdem er das Mädchen aufgeweckt hatte und sie wieder zum Leben erweckte, ging diese Nachricht im ganzen Land umher.
Der Fokus dieser Exegese liegt auf die beiden ineinander verwobenen Ereignisse in Mt 9 18-26, die in einen neutestamentlichen Kontext eingeordnet und analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Griechische Textgrundlage
- Übersetzung
- 1. Literarkritik
- 2. Begriffsgeschichte
- 3. Formgeschichte
- 4. Religionsgeschichtlicher Vergleich
- 5. Historischer Ort
- 6. Redaktionsgeschichte
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Bibelstelle Matthäus 9,18-26 mithilfe verschiedener exegetischer Methoden zu interpretieren, analysieren und vergleichen. Dabei liegt der Fokus auf der Verdeutlichung der historischen und textlichen Zusammenhänge.
- Analyse der beiden ineinander verwobenen Ereignisse der Heilung einer Frau und der Auferweckung der Tochter eines Vorstehers
- Einordnung der Ereignisse in den neutestamentlichen Kontext
- Untersuchung der literarischen und sprachlichen Besonderheiten der Stelle
- Rekonstruktion der historischen Hintergründe und der sozialen Situation der damaligen Zeit
- Analyse der theologischen Botschaft der Bibelstelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beschreibt die angewandten exegetischen Methoden. Die Bibelstelle Matthäus 9,18-26, die die Heilung einer blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter eines Vorstehers erzählt, wird als Ausgangspunkt der Untersuchung eingeführt. Der Fokus liegt auf der Analyse der beiden Ereignisse und ihrer Einordnung in den neutestamentlichen Kontext.
Griechische Textgrundlage
Dieses Kapitel stellt den griechischen Text von Matthäus 9,18-26 vor und bietet eine genaue Analyse der griechischen Wörter und Satzstrukturen. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten der Sprache und ihrer Bedeutung für die Interpretation der Bibelstelle.
Übersetzung
In diesem Kapitel wird die gewählte Übersetzung der Bibelstelle erläutert und mit anderen Übersetzungen verglichen. Die Elberfelder Bibel wird als Grundlage für die Interpretation verwendet, da sie sich nah am griechischen Urtext orientiert. Der Vergleich mit der Zürcher Bibel zeigt unterschiedliche Schwerpunkte und Interpretationen der Bibelstelle auf.
1. Literarkritik
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der literarischen Analyse der Bibelstelle. Der Fokus liegt auf der Struktur, den literarischen Formen und den erzähltechnischen Besonderheiten des Textes. Die literarkritische Analyse soll Aufschluss über die Entstehung und die Intention des Autors geben.
2. Begriffsgeschichte
Die Begriffsgeschichte untersucht die Entwicklung und Verwendung der wichtigsten Begriffe in der Bibelstelle. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Begriffe im Kontext der damaligen Zeit und im Laufe der Geschichte. Die Begriffsgeschichte hilft, die Bedeutung der Wörter und ihre Funktion in der Bibelstelle besser zu verstehen.
3. Formgeschichte
Die Formgeschichte analysiert die literarische Gattung der Bibelstelle. Der Fokus liegt auf der Einordnung der Geschichte in das Genre der Wundererzählung und der Untersuchung der typischen Merkmale dieses Genres. Die Formgeschichte ermöglicht es, die Bibelstelle in ihrer literarischen Tradition zu verstehen und ihre Funktion im Rahmen der Wundererzählungen des Neuen Testaments zu analysieren.
4. Religionsgeschichtlicher Vergleich
Dieses Kapitel setzt die Bibelstelle in den Kontext der damaligen Religionen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich mit anderen Heilungs- und Auferweckungsgeschichten aus dem Judentum, Hellenismus und anderen Religionen. Der religionsgeschichtliche Vergleich ermöglicht es, die Bibelstelle in ihren historischen und religiösen Kontext einzuordnen und ihre Eigenheiten hervorzuheben.
5. Historischer Ort
Dieses Kapitel untersucht den historischen Ort, an dem die Ereignisse der Bibelstelle spielen. Der Fokus liegt auf den historischen und sozialen Bedingungen der damaligen Zeit und ihrer Relevanz für die Interpretation der Bibelstelle. Die Untersuchung des historischen Orts hilft, die Ereignisse in ihrem Kontext zu verstehen und ihre Bedeutung für die Menschen der damaligen Zeit besser zu erfassen.
6. Redaktionsgeschichte
Die Redaktionsgeschichte befasst sich mit der Entstehung des Matthäusevangeliums und der Rolle der Bibelstelle innerhalb des Gesamttextes. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Intention des Autors und der Gründe für die Einordnung der Bibelstelle an dieser Stelle. Die Redaktionsgeschichte ermöglicht es, die Bedeutung der Bibelstelle im Kontext des gesamten Evangeliums zu verstehen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Matthäusevangelium, Heilung, Auferweckung, Blutfluss, Vorsteher, Wunder, Jesus, Glaube, Redaktionsgeschichte, Formgeschichte, Begriffsgeschichte, Religionsgeschichte, Historischer Ort, Literarkritik, Exegese.
- Citar trabajo
- Denise Böttjer (Autor), 2019, Die Heilung der blutflüssigen Frau. Exegetische Ausarbeitung von Mt 9, 18-26, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1015048