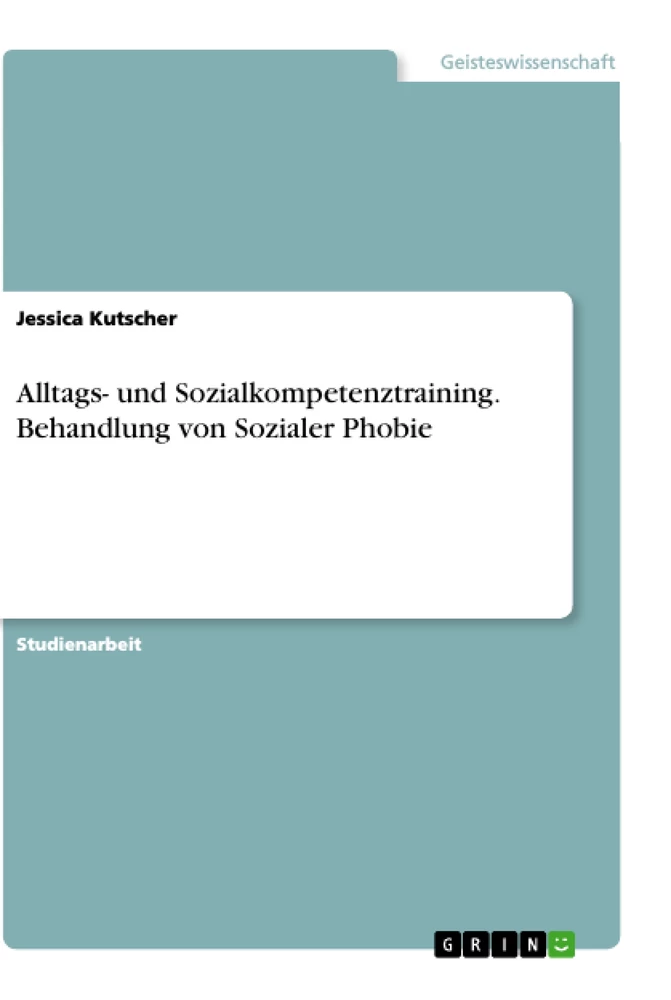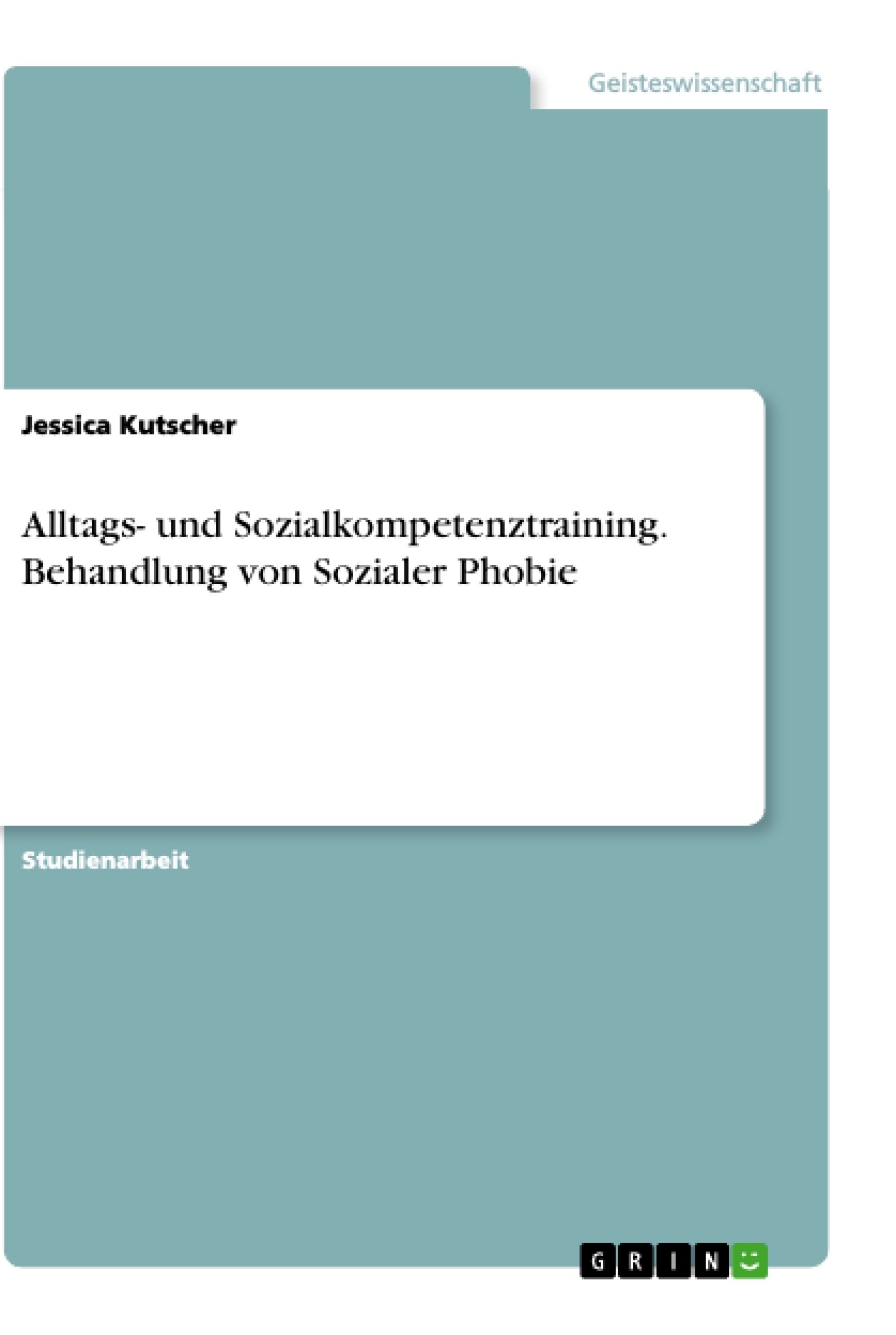In dieser Arbeit wird der multimodale Ansatz des Alltags- und Sozialkompetenztrainings vorgestellt. Der Ansatz gilt als beliebtes Verfahren der Verhaltenstherapie und ist auch in ambulanten und stationären Kontexten der Klinischen Sozialarbeit anwendbar. Des Weiteren stellt er eine bedeutende Interventionsstrategie in der Behandlung der Sozialen Phobie dar.
Diese Arbeit zeigt auf, inwiefern das Alltags- und Sozialkompetenztraining als evidenzbasierte,
integrierte Behandlung des neurotischen Störungsbildes indiziert ist. Durch die Darstellung des Störungsbildes und die Betrachtung des Konzepts der Alltags- und Sozialkompetenzen werden die Zusammenhänge zwischen diesen deutlich gemacht. Durch den Zusammenhang wird sichtbar, dass Defizite in der Sozial- und Alltagskompetenz Wirkverstärker und Vulnerabilitätsfaktoren der Sozialen Phobie sein können.
Das Kompetenztraining bringt eine Reihe an bewusst geplanten und an das Klientel und Setting angepasste Methoden und Interventionstechniken mit sich, die auf kognitiver, emotionaler und behavioraler Ebene wirken. Diese setzen unter anderem an der Psychoedukation, der Angstbewältigung, den Kommunikationsgrundlagen, den Wahrnehmungsfähigkeiten sowie der Stärkung sozialer Orientierung an.
Die Durchführung des sozialen Kompetenztrainings ist eine der breitgefächerten Aufgaben der Klinischen Sozialarbeit, welche hinsichtlich der Behandlung der Sozialen Phobie begleitend und beratend intervenieren kann. Das gemeinsame Ziel der Klinischen Sozialarbeit und des sozialen Kompetenztrainings ist die Befähigung der Klientinnen und Klienten, in einer günstigen Relation zu ihrer sozialen Umgebung eigene Ansprüche äußern zu können und die Fähigkeit zu besitzen, sich für diese einzusetzen. Dabei können in der Praxis einige Schwierigkeiten auftreten, weshalb eine gezielte Indikationsstellung notwendig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Phänomenologie der Sozialen Phobie
- 2.1. Klassifikation und Symptomatik der Sozialen Phobie
- 2.2. Epidemiologie der Sozialen Phobie
- 2.2.1. Ätiologie
- 2.2.2. Prävalenz und Verlauf
- 2.2.3. Psychiatrische Komorbidität
- 2.3. Behandlung
- 3. Konzept der Sozial- und Alltagskompetenz
- 3.1. Begriffsbestimmung soziale Kompetenz
- 3.2. Erklärungsmodell sozialer Kompetenzen
- 3.3. Entstehung sozialer Kompetenzprobleme
- 3.4 Alltagskompetenzen und -fähigkeiten
- 4. Indikation des sozialen Kompetenztrainings bei Sozialer Phobie
- 4.1. Indikation zur Teilnahme am sozialen Kompetenztraining
- 4.2. Kontraindikation zur Teilnahme am sozialen Kompetenztraining
- 5. Alltags- und Sozialkompetenztraining bei Sozialer Phobie
- 5.1. Bausteine des sozialen Kompetenztrainings
- 5.1.1. Themenbereich Angstbewältigung
- 5.1.2. Themenbereich Erhöhung der sozialen Kompetenzen
- 5.1.3. Themenbereich Bearbeitung von Hintergrundproblematiken
- 5.2. Unterschiedliche Therapiesettings
- 5.2.1. Umsetzung des sozialen Kompetenztrainings in Einzel- versus Gruppentherapiesettings
- 5.2.2. Umsetzung des sozialen Kompetenztrainings im ambulanten versus stationären Setting
- 5.3. Gruppentraining sozialer Kompetenzen
- 5.3.1. Aufbau und Struktur
- 5.3.2. Ablauf der Sitzungen
- 5.3.3. Behandlungsmethoden und möglicher Transfer in den Alltag
- 6. Ansatzpunkte zur Stärkung sozialer Kompetenzen durch die Klinische Sozialarbeit
- 7. Diskussion
- 7.1. Schwierige Situationen innerhalb des sozialen Kompetenztraining
- 7.2. Chancen und Grenzen des sozialen Kompetenztrainings
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das multimodale Konzept des Alltags- und Sozialkompetenztrainings im Kontext der Behandlung von Sozialer Phobie. Dabei wird die Indikation des Trainings für diese Störungsgruppe beleuchtet und die Bedeutung des Trainings für die Klinische Sozialarbeit herausgestellt. Ziel der Arbeit ist es, die Wirksamkeit und Relevanz des Ansatzes für die Behandlung sozialer Phobie zu verdeutlichen und die Rolle der Klinischen Sozialarbeit in diesem Zusammenhang zu definieren.
- Das Störungsbild der Sozialen Phobie
- Das Konzept der Sozial- und Alltagskompetenz
- Indikation und Kontraindikation des Alltags- und Sozialkompetenztrainings bei Sozialer Phobie
- Die Anwendung des Alltags- und Sozialkompetenztrainings in verschiedenen Settings
- Der Beitrag der Klinischen Sozialarbeit zur Stärkung sozialer Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Relevanz des Alltags- und Sozialkompetenztrainings für die Behandlung von Sozialer Phobie. Kapitel 2 beleuchtet die Phänomenologie der Sozialen Phobie, inklusive Klassifikation, Symptomatik, Epidemiologie und Behandlungsmöglichkeiten. Kapitel 3 befasst sich mit dem Konzept der Sozial- und Alltagskompetenz und betrachtet deren Bedeutung im Kontext sozialer Phobie. Kapitel 4 analysiert die Indikationsstellung für das soziale Kompetenztraining bei Betroffenen mit Sozialer Phobie. Kapitel 5 stellt die verschiedenen Bausteine des Trainings vor und beleuchtet die Umsetzung in unterschiedlichen Settings, wie Einzel- und Gruppentherapie, ambulante und stationäre Behandlung.
Schlüsselwörter
Soziale Phobie, Alltags- und Sozialkompetenztraining, Verhaltenstherapie, Indikationsstellung, Klinische Sozialarbeit, Angstbewältigung, Kommunikationsgrundlagen, Wahrnehmung, Psychoedukation, Gruppentherapie, Einzeltherapie, ambulante und stationäre Behandlung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Alltags- und Sozialkompetenztrainings?
Das Ziel ist die Befähigung von Klienten, eigene Ansprüche in ihrer sozialen Umgebung zu äußern und sich für diese einzusetzen, insbesondere bei sozialer Phobie.
Wie hängen soziale Phobie und Sozialkompetenz zusammen?
Defizite in der Sozialkompetenz können als Wirkverstärker und Vulnerabilitätsfaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung einer sozialen Phobie fungieren.
Welche Methoden werden im Training eingesetzt?
Es werden Interventionen auf kognitiver, emotionaler und behavioraler Ebene genutzt, darunter Psychoedukation, Angstbewältigung und Kommunikationstraining.
In welchen Settings findet das Kompetenztraining statt?
Das Training kann sowohl in Einzel- als auch in Gruppentherapie sowie in ambulanten oder stationären Kontexten der Klinischen Sozialarbeit durchgeführt werden.
Welche Rolle spielt die Klinische Sozialarbeit dabei?
Sie interveniert begleitend und beratend, um den Transfer der erlernten Fähigkeiten in den realen Alltag der Klienten zu unterstützen.
- Quote paper
- Jessica Kutscher (Author), 2020, Alltags- und Sozialkompetenztraining. Behandlung von Sozialer Phobie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1014895