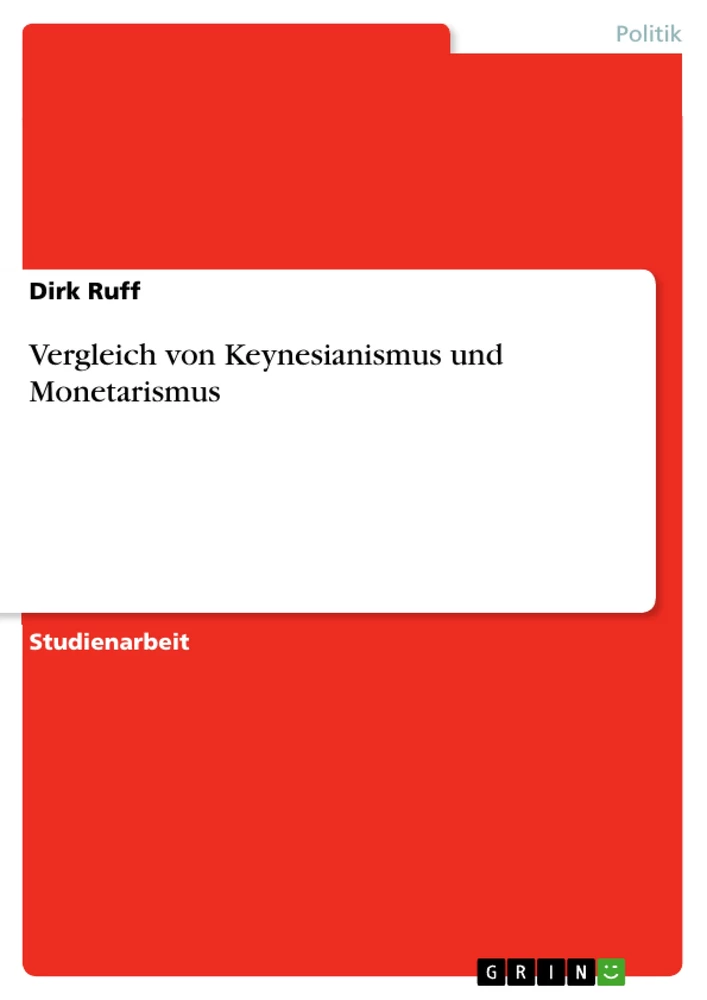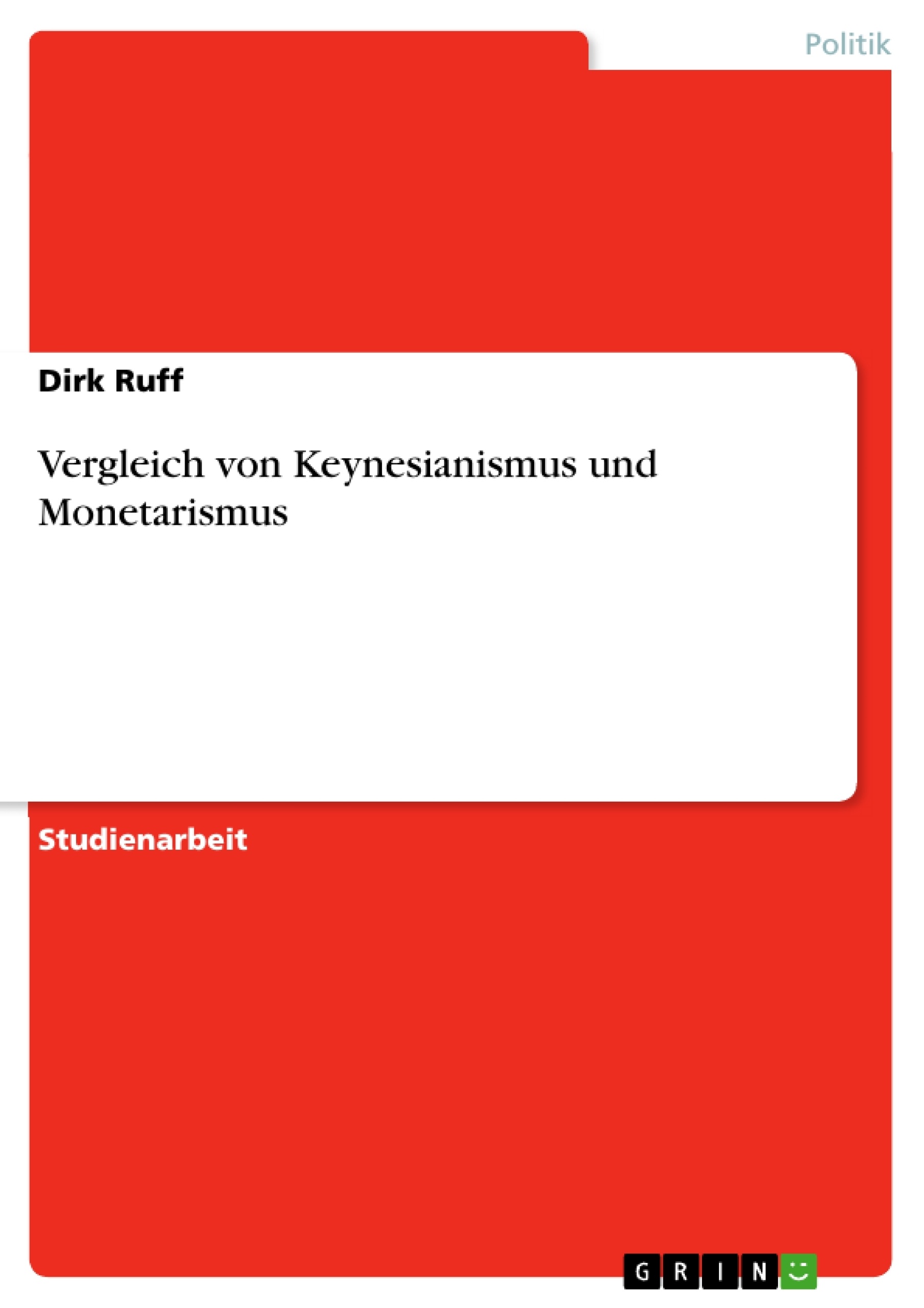Was wäre, wenn die grundlegenden Annahmen unserer Wirtschaftspolitik auf unterschiedlichen Weltanschauungen beruhen? Diese Frage steht im Zentrum dieser aufschlussreichen Analyse, die Keynesianismus und Monetarismus – zwei der einflussreichsten wirtschaftspolitischen Denkschulen des 20. Jahrhunderts – vergleicht. Anstatt eine der beiden Theorien als "richtig" zu verteidigen, beleuchtet diese Arbeit die fundamentalen Unterschiede in ihren Basishypothesen und Ansatzpunkten. Der Leser erhält einen klaren Überblick über die keynesianische Theorie, die auf John Maynard Keynes' "Allgemeiner Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes" basiert, und die monetaristische Konzeption, deren geistiger Vater Milton Friedman ist. Im direkten Vergleich werden die unterschiedlichen Auffassungen des privaten Sektors, der Rolle des Staates in der Marktwirtschaft und des Sayschen Theorems herausgearbeitet. Während der Keynesianismus auf Nachfragesteuerung und staatliche Intervention setzt, um konjunkturelle Ungleichgewichte zu beseitigen, betont der Monetarismus die Bedeutung der Geldmengensteuerung und die Stabilität des privaten Sektors. Diese Gegenüberstellung ermöglicht es dem Leser, die Stärken und Schwächen beider Ansätze zu verstehen und sich ein fundiertes Urteil über ihre Anwendbarkeit in verschiedenen wirtschaftlichen Situationen zu bilden. Ein Muss für alle, die sich für Wirtschaftspolitik, Makroökonomie und die großen Debatten der Wirtschaftswissenschaften interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Wirtschaftstheorien und entdecken Sie die verborgenen Unterschiede, die unsere Finanzwelt prägen. Erfahren Sie, wie unterschiedliche Annahmen über die Stabilität des privaten Sektors, die Rolle des Staates und die Wirksamkeit der Geldpolitik zu völlig unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Empfehlungen führen. Ob Sie Student der Wirtschaftswissenschaften, Politiker oder einfach nur ein interessierter Bürger sind, dieses Buch bietet Ihnen die Werkzeuge, um die komplexen Herausforderungen der modernen Wirtschaft zu verstehen und zu bewältigen. Entdecken Sie die historischen Wurzeln dieser Theorien und ihre Auswirkungen auf die heutige Welt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Keynesianismus
2. Monetarismus
3. Unterschiede zwischen Keynesianismus und Monetarismus
4. Schluß
5. Literaturverzeichnis
Einleitung
In dieser Arbeit werden die Unterschiede zwischen den wirtschaftspolitischen Konzeptionen des Keynesianismus und des Monetarismus besprochen. Ziel der Arbeit ist es die unterschiedlichen Basishypothesen und Ansatzpunkte der Konzeptionen vorzustellen und heraus zu arbeiten. Es ist nicht mein Ziel ein wertendes Urteil über die Theorien ab zu geben, und auch nicht heraus zu finden welche der beiden die „Richtige“ ist. Vielmehr ist diese Arbeit als einfacher Vergleich gedacht.
Zu diesem Zweck werde ich zunächst den Keynesianismus vorstellen. Hierbei belasse ich es bei einem kurzen Überblick über die Theorie, und werde nicht anhand von volkswirtschaftlichen Formeln argumentieren. Ebenso werde ich anschließend bei der Vorstellung der monetaristischen Konzeption verfahren.
Nachdem ich beide Theorien vorgestellt habe werde ich anhand dieser Punkte einen Vergleich vornehmen, bei welchem ich mich auf die Hervorhebung der wichtigsten Unterschiede beschränke. Es werden hauptsächlich die unterschiedliche Betrachtung des privaten Sektors, der Rolle des Staates in einer Marktwirtschaft und des Sayschen-Theorems als Grundlage dieses Vergleichs herangezogen.
Zum Schluß der Arbeit werde ich diese Unterschiede nochmals aufgezählt ohne jedoch erneut kommentiert zu werden.
1. Keynesianismus
Die keynesianische Theorie beruht hauptsächlich auf der Arbeit „The General Theorie of Employment, Interest and Money“ des englischen Ökonomen John Maynard Keyens. Diese veröffentlichte er 1936 vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929-1932. Wie der Titel der Arbeit schon sagt wollte Keyens eine „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ aufstellen.
Hierbei kommt dem Wort „allgemein“ eine besondere Bedeutung zu. Keynes erkannte die Richtigkeit der klassisch-neoklassische Theorie für den speziellen Fall der Vollbeschäftigung durchaus an. Seine Theorie jedoch sollte auch die Unterbeschäftigung erklären können.1 Keynes geht nicht davon aus, daß die ideale Marktwirtschaft zu einem Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung tendiert. Vielmehr glaubt er, ein marktwirtschaftliches System tendiert zu einem Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung.
Diese Tendenz zur Unterbeschäftigung resultiert seiner Meinung nach daraus, daß das Saysche-Theorem (J.B. Say, 1767-1832)2 nicht zutrifft, wonach das Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Alle produzierten Güter werden demnach mit dem im Produktionsprozeß verdienten Einkommen aufgekauft3. Seiner Meinung nach jedoch bestimmt die effektive Nachfrage das Produktionsniveau „Die Nachfrage schafft sich ihr Angebot, nicht umgekehrt.“4 Mit steigendem Einkommen nimmt der Hang zum Verbrauch relativ ab. Damit bleibt die Voraussetzung für das Saysche-Theorem unerfüllt. Die Haushalte vermehren zwar ihren Konsum mit steigendem Einkommen, aber nicht in vollem Umfang. Ein Teil der Einkommenssteigerung wird gespart, wodurch eine Nachfragelücke entsteht. Keynes geht bei der Annahme einer Nachfragelücke davon aus, daß zwischen Sparen und Investieren keine Identität besteht. Dabei stützt er sich auf die Erfahrung, daß Sparer und Investoren nicht identisch sind und nicht alle Sparbeiträge zu Investitionen verwandt werden5. Keynes sieht als Hintergrund für mangelnde Beschäftigung und Arbeitslosigkeit die unzureichende Gesamtnachfrage, die sich bei überschüssiger Ersparnis über die Investitionsnachfrage ergibt.
Damit wird die Gesamtnachfrage zur strategischen Größe, die nach Keyens in staatliche Nachfrage umgesetzt werden muß. Befindet sich die Wirtschaft in einer Rezension, so sind Ankurbelungsmaßnahmen erforderlich. Der Staat soll dann seine Investitionen und Aufträge an die Privatwirtschaft verstärken. Durch den Staatseingriff wird die Gesamtnachfrage nicht steigen, sondern lediglich von den Privaten zum Staat umgeschichtet6. Dadurch schließt der Staat aber die Investitionslücke und stabilisiert die Gesamtnachfrage. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Staatsausgaben sollen nicht durch Steuererhöhungen finanziert werden. Durch diese wird sowohl den privaten Haushalten als auch den Unternehmen zusätzlich Kaufkraft entzogen, was wiederum zu einer sinkenden Nachfrage führt. Vielmehr soll die Finanzierung über die Aufnahme zusätzlicher Kredite erfolgen. Das ist möglich, da liquide Mittel von privaten Unternehmen ungenutzt im Bankensystem „schlummern“7. Gelingt die Ankurbelung der Wirtschaft auf diese Weise, so können die Schulden aus der Rezession durch die nun erhöhten Steuereinnahmen getilgt werden8. Keynes bevorzugt also eine antizyklische Fiskalpolitik, da seiner Meinung nach durch die Variation der Staatsausgaben die Nachfrage unmittelbar beeinflußt werden kann. Die Geldpolitik hingegen hält er für nicht so effektiv. Die Zentralbank sollte jedoch ebenfalls antizyklisch eine zinsorientierte Politik betreiben.
In wirtschaftlichen Abschwungphasen soll durch die Erhöhung der Geldmenge und die Senkung des Zinsniveaus die Konjunktur belebt werden. Dadurch würden gleichzeitig auch die staatlichen Programme erleichtert. In Phasen des Aufschwungs soll genau das Gegenteil erfolgen. Keynes empfiehlt für diesen Fall eine Drosselung der Geldmenge und eine Anhebung des Zinsniveaus.9
Dem Erfolg der Geldpolitik steht vor allem die „Liquiditätsfalle“10 entgegen. Außerdem wirkt sie sich nur indirekt auf die Güternachfrage aus und ist mit langen Wirkungsverzögerungen verbunden.
Der Keynesianismus versucht also über Nachfragesteuerung eine kurzfristige Beseitigung von Gleichgewichtsstörungen zu erreichen. Seine Forderungen nach einer Ausweitung des öffentlichen Sektors und der Erhöhung des Staatskonsums findet man oft zusammengefaßt als „Mehr Staat, weniger Markt“.
2. Monetarismus
Als Begründer und geistiger Kopf des Monetarismus gilt Milton Friedman. Der Kern des Monetarismus liegt in der dominierenden Bedeutung, die er der Geldmengenentwicklung und der Geldmengensteuerung in einer Volkswirtschaft zumißt. Außerdem geht der Monetarismus davon aus, daß die ideale Marktwirtschaft zu einem Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung tendiert11. Der private Sektor wird als stabil angesehen, und das privatwirtschaftliche System schafft es demnach aus eigener Kraft seine Probleme zu lösen. Störungen des Wirtschaftsablaufs und Beschäftigungsschwankungen werden nach Ansicht der Monetaristen durch Staatseingriffe verursacht12. Demnach können konjunkturelle Schwankungen auch nicht durch eine antizyklische Fiskalpolitik bekämpft werden. Arbeitslosigkeit ist den Monetaristen nach nur eine Folge mangelnder Flexibilität der Löhne auch nach unten. Der Arbeitsmarkt wird von ihnen genauso wie der Gütermarkt betrachtet. Auf diesem wird um so mehr Nachgefragt, je niedriger der Güterpreis ist. Für den Arbeitsmarkt bedeutet dies je niedriger die Lohnkosten sind, desto eher sind die Unternehmer bereit Arbeitsplätze anzubieten.
Um die Geldwertstabilität zu gewährleisten muß die Notenbank dafür sorgen, daß sich die Geldmenge gleichmäßig mit den Produktionsmöglichkeiten entwickelt. Übersteigt das Wachstum der Geldmenge das der Produktionsmöglichkeiten so resultiert daraus eine Inflation. Diese würde das ökonomische Wachstum gleich in mehrfacher Hinsicht gefährden13.
Als theoretische Basis des Monetarismus kann das Saysche-Theorem gesehen werden. Wenn dies zutrifft, und alles Einkommen von den Wirtschaftssubjekten wieder ausgegeben wird, so ist die Nachfrage nur Konsumnachfrage. Sparen die Haushalte jedoch einen Teil des Einkommens, so tritt über den Zinsmechanismus an die Stelle des Konsumverzichts eine Investitionsnachfrage gleichen Umfangs.
Die Verfechter des Monetarismus beschränken sich jedoch nicht auf die Geld- und Kreditpolitik. Vielmehr fordern sie die Unternehmen von Kosten zu entlasten und die Ausgaben des Staates zu kürzen. Durch die Kürzung der Staatsausgaben sinkt dessen Kreditaufnahme wodurch der Kapitalmarkt entlastet wird und die Zinsen sinken können.
Ein niedriges Zinsniveau wiederum erhöht die Bereitschaft zu Investitionen in der Privatwirtschaft. Insgesamt geht der Monetarismus also davon aus, daß ein marktwirtschaftliches System langfristig zu Stabilität und stabilem Wachstum tendiert, wenn es möglichst frei von staatlichen Eingriffen bleibt.
3. Unterschiede zwischen Keynesianismus und Monetarismus
Während es sich bei der keynesianischen Theorie um eine nachfrageorientierte Theorie handelt, deren Grundlage die „Theorie der effektiven Nachfrage“14 bildet, handelt es sich bei dem Monetarismus um eine angebotsorientierte Theorie, die sich auf die Gültigkeit des Sayschen-Theorems beruft. Dieser Unterschied läßt sich am besten anhand der Gleichung Gewinn = Preis x Absatzmenge ./. Kosten darlegen.
Setzt der Keynesianismus im Falle eines Gewinnrückgangs bei der Absatzmenge an, so versucht der Monetarismus die Kosten zu senken um eine Steigerung bzw. eine Stabilisierung des Gewinns zu erreichen. Dieser Unterschied bleibt nicht ohne gesellschaftspolitische Folgen. Der Monetarismus versucht die Kosten auch durch Senkung der Löhne zu verringern, was zu Lasten des Lebensstandards der Arbeitnehmer geht. Beim Keynesianismus wird hingegen versucht durch eine Steigerung der Absatzmenge die Gewinne zu stabilisieren was auf den Lebensstandard der Arbeitnehmer keine negativen Auswirkungen hat15. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen beiden Theorien ist die Rolle die sie dem Staat in einem marktwirtschaftlichem System zukommen lassen. Diese bedingt sich teilweise aus der unterschiedlichen Betrachtung des privaten Sektors. Sehen die Monetaristen den privaten Sektor als stabil an, so bezweifeln dies die Keynesianer. Da die Monetaristen von der Gültigkeit des Sayschen-Theorems ausgehen tendiert ihrer Meinung nach eine Marktwirtschaft zu einem Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung. Die Keynesianer hingegen bezweifeln dieses Gleichgewicht und erklären dies mit der sogenannten „Liquiditätsfalle“16 aus der sich auch die Arbeitslosigkeit ergibt, bzw. ein Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung.
Um dieses zu verhindern muß nach dem Keynesianismus der Staat den Nachfragerückgang ausgleichen und somit der Fehlentwicklung entgegen wirken. Demgegenüber vertrauen die Monetaristen auf den Preis- und Wettbewerbsmechanismus der das Gleichgewicht wieder herstellt. Ist die Nachfrage Rückläufig, so geht man im Monetarismus davon aus, daß sowohl die Güterpreise als auch die Kosten sinken. Durch die sinkenden Preise steigt wiederum die Nachfrage und die Absatzmenge und der Umsatz bleibt gleich. Zu diesem Prozeß ist kein Staat notwendig. Im Gegenteil sehen die Monetaristen den Grund für konjunkturelle Schwankungen in dem Eingreifen des Staates in die Wirtschaftsabläufe17.
Grundsätzlich gibt es auch Unterschiede in der Zielsetzung der beiden Konzeptionen. Die keynesianische Theorie beschränkt sich hauptsächlich auf die Beseitigung konjunkturell bedingter, kurzfristiger Gleichgewichtsstörungen durch eine antizyklische Fiskalpolitik18. Demgegenüber steht bei den Monetaristen die Geldpolitik im Vordergrund. Wie vorher bereits erwähnt soll die Geldmengensteigerung an dem Zuwachs der Produktionsmittel ausgerichtet werden. Diese Änderung der Produktionsmittel geht aber nur langsam von statten, was auch der Geldpolitik eine gewisse Stetigkeit verleiht. Daraus resultiert für den monetaristischen Ansatz ebenfalls ein längerfristiger Charakter19.
Auch die wirtschaftspolitische Zielpriorität ist bei beiden Konzeptionen eine unterschiedliche. Legt der Keynesianismus seine Priorität eindeutig auf die Vollbeschäftigung, so dürfte es diese dem Monetarismus zu folge gar nicht geben, und dieser legt seine Priorität auf die Preisniveaustabilität.
4. Schluß
Wie im Verlauf dieser Arbeit gezeigt, unterscheiden sich die beiden wirtschaftspolitischen Konzeptionen des Monetarismus und des Keynesianismus grundlegend von einander. Sie setzten unterschiedliche Prioritäten bei den wirtschaftspolitischen Zielen, haben andere Ansichten bezüglich der Rolle des Staates in einem marktwirtschaftlichen System und sehen den privaten Sektor anders. Diese Unterschiede in der Betrachtungsweise der wirtschaftlichen Probleme erlaubt es jedoch nicht ein Urteil zu fällen welche dieser beiden Konzeptionen richtig und welche falsch ist, was auch nicht Ziel dieser Arbeit war. Auch eine Aussage welche Theorie besser geeignet ist mit
Problemen fertig zu werden läßt sich auf Grund dieser Unterschiede nicht treffen. Es muß von Fall zu Fall entschieden werden welcher der Ansätze zu bevorzugen ist, da beide Theorien nicht falsch sind. Ist die beim Keynesianismus geforderte Vollbeschäftigung aus sozialen Gründen durchaus wünschenswert und wird vermutlich von vielen bevorzugt, so hat auch die Preisniveaustabilität wie sie von den Monetaristen verlangt wird ihre Berechtigung und ihre Wichtigkeit.
Es läßt sich also nicht pauschal sagen welche der Theorien die wirksamere in Phasen einer Rezession ist, da beide keine Patentlösung beinhalten.
5. Literaturverzeichnis
Adam, Hermann. Wirtschaftspolitik und Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung, (Opladen: Leske+Budrich, 1995).
Baßeler, Ulrich. Heinrich, Jürgen. Koch, Walter. Grundlagen und Probleme der Wirtschaftspolitik, (Köln: Bachem,1995).
Felderer, Bernhard. Homburg, Stefan. Makroökonomik und neue Makroökonomik, (Berlin: Springer, 1994).
Hartwig, Jochen. Keynes versus Pigou. Rekonstruktion einer Beschäftigungstheorie jenseits des Marktparadigmas, (Marburg: Metropolis, 1999).
Hödl, Erich. Müller, Gernot. (Hg.), Die Neoklassik und ihre Kritik, (Frankfurt a.M.: Campus, 1986).
Klausinger, Hansjörg. Theorien der Geldwirtschaft. Von Hayek und Keynes zu neueren Ansätzen, (Berlin: Duncker&Humbolt, 1991).
Mussel, Gerhard. Pätzold, Jürgen. Grundfragen der Wirtschaftspolitik, (München: Vahlen,1998).
Peters, Hans-Rudolf. Wirtschaftspolitik, (München: Oldenbourg, 1995).
Schröder, Wolfgang. Theoretische Grundstrukturen des Monetarismus, (Baden-Baden: Nomos, 1978).
Sommer, Albrecht. Grundlagen der modernen monetären Konjunkturtheorie der Neoklassik, (Regensburg: Transfer, 1991).
Togati, Teodoro Dario. Keynes and the Neoclassical Synthesis. Einsteinian versus Newtonian macroeconomics, (London: Routledge, 1998).
[...]
1 Felderer, Bernhard / Homburg, Stefan. Makroökonomik und neue Makroökonomik, (Berlin: Springer-Verlag, 1994), 98f.
2 Mussel, Gerhard / Pätzold, Jürgen. Grundfragen der Wirtschaftspolitik, (München: Franz Vahlen, 1998), 12
3 Peters, Hans-Rudolf. Wirtschaftspolitik, (München: Oldenbourg Verlag, 1995), 234.
4 Felderer / Homburg, Makroökonomik und neue Makroökonomik, 102.
5 Peters, Wirtschaftspolitik, 234.
6 Adam, Hermann. Wirtschaftspolitik und Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, (Opladen: Leske+Budrich, 1995),145.
7 Ebd., 145.
8 Mussel / Pätzold, Grundfragen der Wirtschaftspolitik, 19..
9 Ebd., 19.
10 Nach: Adam, Wirtschaftspolitik und Regierungssystem, 143f.
11 Adam, Hermann. Wirtschaftspolitik und Regierungssystem, 138.
12 Baßeler, Ulrich / Heinrich, Jürgen / Koch, Walter. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft, (Köln: Bachem, 1995), 387.
13 Genauer bei: Nissen, Hans-Peter, Monetarismus, in: Nohlen, Dieter, Wörterbuch Staat und Politik, (München: R. Piper, 1991), 451 f.
14 Klausinger, Hansjörg, Theorien der Geldwirtschaft. Von Hayek und Keynes zu neueren Ansätzen, (Berlin: Duncker & Humbolt, 1991),147ff.
15 Adam, Wirtschaftspolitik und Regierungssystem, 145.
16 Ebd.143.
17 Peters, Wirtschaftspolitik, 240.
18 Mussel / Pätzold, Grundfragen der Wirtschaftspolitik, 17f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Keynesianismus und Monetarismus?
Diese Arbeit vergleicht die wirtschaftspolitischen Konzeptionen des Keynesianismus und des Monetarismus. Ziel ist es, die unterschiedlichen Basishypothesen und Ansatzpunkte beider Theorien herauszuarbeiten und zu vergleichen, ohne eine wertende Beurteilung vorzunehmen.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Keynesianismus und Monetarismus?
Die wichtigsten Unterschiede liegen in der Betrachtung des privaten Sektors, der Rolle des Staates in einer Marktwirtschaft und der Gültigkeit des Sayschen Theorems. Keynesianer sehen den privaten Sektor als instabil und befürworten staatliche Eingriffe zur Nachfragesteuerung, während Monetaristen den privaten Sektor als stabil ansehen und staatliche Eingriffe ablehnen.
Was ist das Saysche Theorem und welche Rolle spielt es im Keynesianismus und Monetarismus?
Das Saysche Theorem besagt, dass das Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Monetaristen gehen von der Gültigkeit dieses Theorems aus, während Keynesianer es ablehnen und argumentieren, dass die effektive Nachfrage das Produktionsniveau bestimmt.
Welche Rolle spielt der Staat in keynesianischer und monetaristischer Sichtweise?
Keynesianer befürworten staatliche Eingriffe, um Nachfragelücken zu schließen und die Wirtschaft zu stabilisieren (antizyklische Fiskalpolitik). Monetaristen sind gegen staatliche Eingriffe und plädieren für eine freie Marktwirtschaft mit minimalen staatlichen Interventionen.
Was ist die "Liquiditätsfalle" im Kontext des Keynesianismus?
Die "Liquiditätsfalle" beschreibt eine Situation, in der Zinssenkungen keine Auswirkungen auf die Investitionsnachfrage haben, weil die Wirtschaftssubjekte das zusätzliche Geld lieber halten, anstatt es zu investieren.
Welche Bedeutung hat die Geldpolitik im Keynesianismus und Monetarismus?
Keynesianer halten die Geldpolitik für weniger effektiv als die Fiskalpolitik, während Monetaristen die Geldpolitik als das wichtigste Instrument zur Steuerung der Wirtschaft betrachten. Sie fordern eine stabile Geldmengenentwicklung, die sich am Wachstum der Produktionsmöglichkeiten orientiert.
Welche wirtschaftspolitischen Ziele werden im Keynesianismus und Monetarismus priorisiert?
Keynesianer legen den Schwerpunkt auf die Vollbeschäftigung, während Monetaristen die Preisniveaustabilität priorisieren.
Was ist das Fazit der Arbeit zum Vergleich von Keynesianismus und Monetarismus?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass beide Konzeptionen unterschiedliche Vor- und Nachteile haben und keine pauschale Aussage darüber getroffen werden kann, welche Theorie in bestimmten Situationen besser geeignet ist. Die Wahl des geeigneten Ansatzes hängt von den jeweiligen wirtschaftlichen Umständen ab.
- Quote paper
- Dirk Ruff (Author), 2000, Vergleich von Keynesianismus und Monetarismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101486