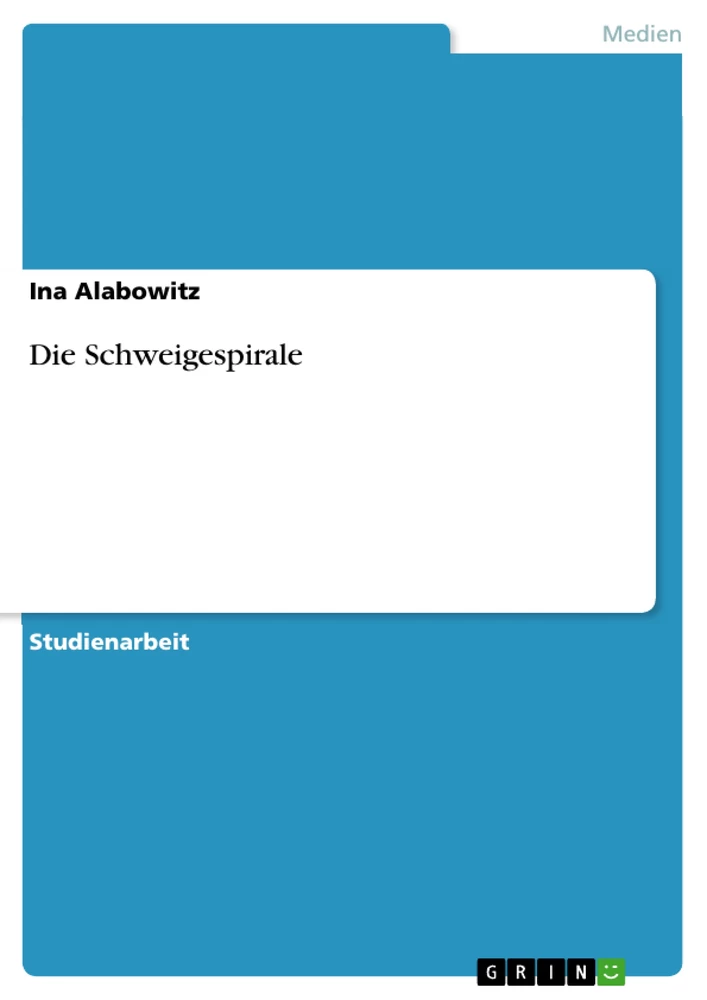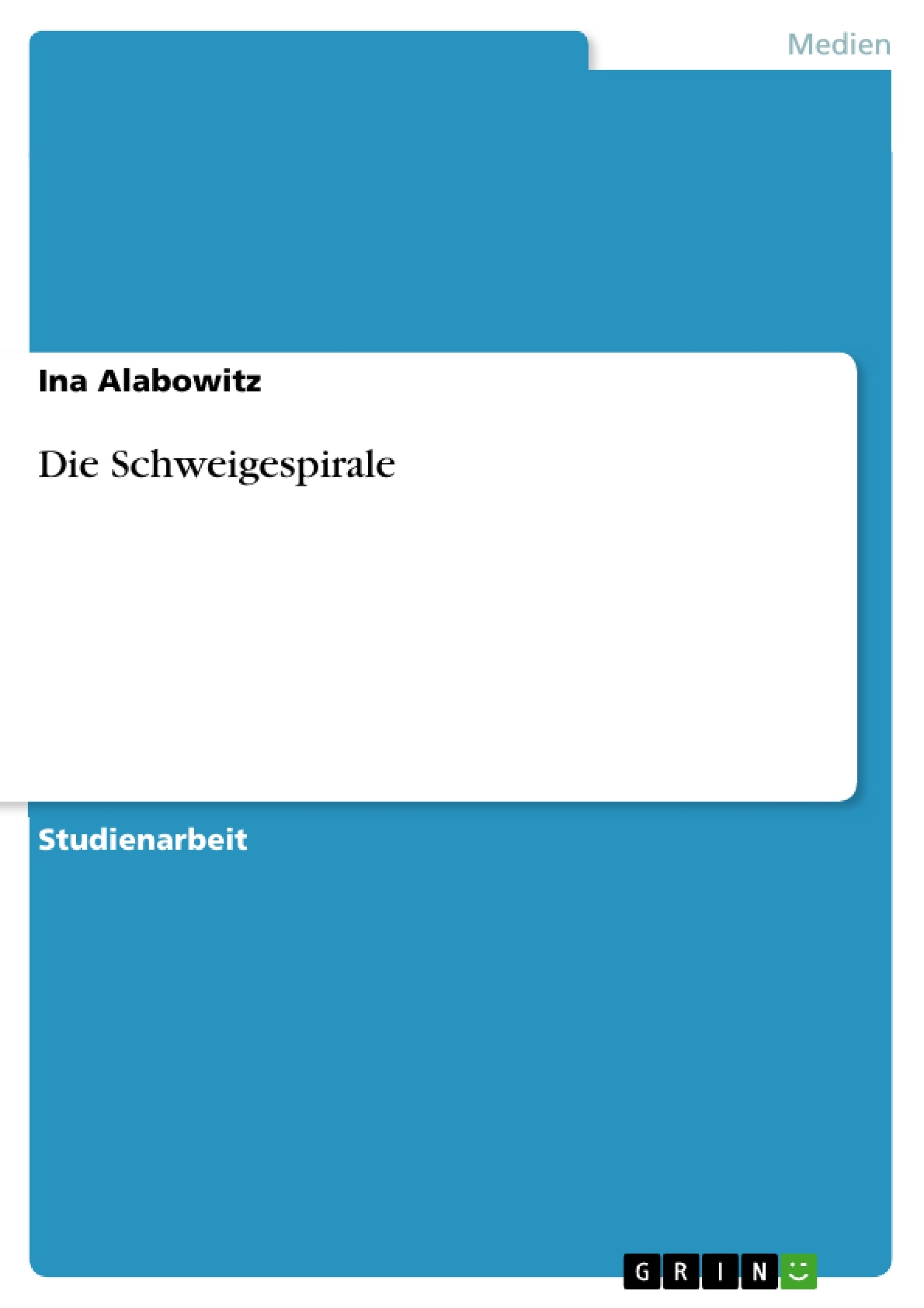Haben Sie sich jemals gefragt, warum bestimmte Meinungen in der Öffentlichkeit so dominant erscheinen, während andere verstummen? Dieses Buch enthüllt das faszinierende Phänomen der Schweigespirale, ein Konzept, das unser Verständnis von öffentlicher Meinung, sozialem Druck und politischer Meinungsbildung revolutioniert hat. Entdecken Sie, wie die Angst vor sozialer Isolation unsere Bereitschaft beeinflusst, unsere Überzeugungen zu äußern, und wie dies zu einer verzerrten Wahrnehmung der tatsächlichen Meinungsverteilung in der Gesellschaft führen kann. Anhand von Fallstudien, Experimenten und historischen Beispielen – von Wahlen bis hin zu gesellschaftlichen Tabuthemen – analysiert dieses Werk, wie die Schweigespirale entsteht, welche Bedingungen ihre Entstehung begünstigen und welche Konsequenzen sie für die Demokratie und den gesellschaftlichen Diskurs hat. Erfahren Sie mehr über Elisabeth Noelle-Neumanns bahnbrechende Forschung, die uns ein tieferes Verständnis der Dynamiken von Mehrheits- und Minderheitsmeinungen vermittelt. Tauchen Sie ein in die Mechanismen der Meinungsbildung, lernen Sie das "quasi-statistische Wahrnehmungsorgan" kennen und verstehen Sie, wie subtile Signale in unserer Umwelt unsere Entscheidungen beeinflussen, ob wir sprechen oder schweigen. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Kommunikationswissenschaft, Sozialpsychologie, Politikwissenschaft und die Funktionsweise der öffentlichen Meinung interessieren. Es bietet wertvolle Einblicke für Journalisten, Politiker, Meinungsforscher und jeden, der die komplexen Wechselwirkungen zwischen individueller Überzeugung und sozialem Kontext verstehen möchte. Lassen Sie sich von den aktuellen Beispielen und Analysen inspirieren und entwickeln Sie ein kritisches Bewusstsein für die Manipulationsmöglichkeiten und die Bedeutung einer vielfältigen und offenen Diskussionskultur. Werden Sie Zeuge, wie die Schweigespirale unsere Gesellschaft prägt und entdecken Sie Wege, um eine freie und informierte Meinungsbildung zu fördern. Verstehen Sie die Macht der öffentlichen Meinung und ihren Einfluss auf unser tägliches Leben, politische Entscheidungen und gesellschaftliche Veränderungen. Die hier dargelegten Erkenntnisse werden Ihr Verständnis von sozialer Interaktion und politischer Kommunikation grundlegend verändern und Ihnen neue Perspektiven auf die Herausforderungen unserer Zeit eröffnen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Hypothese der Schweigespirale
2.1 Begriffsbestimmung „Meinung“
2.2 Ursprung der Schweige-Hypothese
2.3 Die Bundestagswahl von 1965
2.4 Erklärung
3. Möglichkeiten, die Hypothese der Schweigespirale zu überprüfen
4. Prüfung mit demoskopischen Instrumenten
5. Der Eisenbahntest
5.1 Ziel
5.2 Problem und Technik
6. Laborexperiment von Salmon Asch
6.1 Versuchsaufbau
6.2 Ergebnis
7. Bedingungen für die Schweigespirale
8. Kritik an der Schweigespirale von Noelle-Neumann
9. Die Schweigespirale an aktuellen Beispielen
10. Schlußwort
11. Bibliografie
12.Anhang
1. Einleitung
Elisabeth Noelle-Neumann wurde 1916 in Berlin geboren, studierte Philosophie, Geschichte, Zeitungswissenschaften und Amerikanistik in Berlin, Königsberg und München. 1940 promovierte sie über amerikanische Meinungsforschung. Sie arbeitete zwei Jahre bei der Wochenzeitung „Das Reich“, wo sie nach Weisung von Goebbel fristlos gekündigt wurde.
Nach dem Krieg heiratete sie ihren Kollegen Erich Peter Neumann. Am 8. Mai gründeten sie zusammen das erste deutsche Meinungsforschungsinstitut, das „Institut für Demoskopie“ in Allensbach.12
Ihr Buch „Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung - unsere soziale Haut“ erschien erstmals 1980, erreichte inzwischen mehrere aktualisierte Auflagen und wurde in neun Sprachen übersetzt, darunter unter anderem in englisch, spanisch, chinesisch, japanisch, koreanisch und russisch. Die Schweigespirale ist mit Sicherheit die bedeutendste Entdeckung von Elisabeth Noelle-Neumann und ist in der internationalen Kommunikationsforschung nicht mehr wegzudenken.
Interessant dabei ist, dass sich die Hypothese der Schweigespirale durch sämtliche Themenbereiche - von Wahlen über Abtreibung bis hin zu Erziehungsfragen - zieht und sich jeden Tag aufs Neue Beispiele dafür finden lassen.
Als schwierig erwies es sich jedoch, den Wirklichkeitsgehalt dieser Hypothese empirisch zu untersuchen. Im folgenden Text wird die Hypothese der Schweigespirale sowie der Beweis ihrer Existenz mit Hilfe von demoskopischen Instrumenten näher erläutert und auf Beispiele in der aktuellen Berichterstattung eingegangen.
2. Die Hypothese der Schweigespirale
„Schweigespirale heißt: Menschen wollen sich nicht isolieren, beobachten pausenlos ihre Umwelt, können aufs feinste registrieren, was zu-, was abnimmt.“3 „Diese Fähigkeit beschränkt sich nicht auf die Wahrnehmung von Meinungen in der Bezugsgruppe der Individuen, sondern schließt auch die anonyme Öffentlichkeit ein. NOELLE-NEUMANN nennt diese Fähigkeit das „quasi-statistische Wahrnehmungsorgan“ der Menschen.“4
„Wer feststellt, daß sich seine Meinung ausbreitet, fühlt sich dadurch gestärkt und äußert seine Meinung sorglos, redet, ohne Isolation zu fürchten. Wer feststellt, daß seine Meinung Boden verliert, wird verunsichert und verfällt in Schweigen. Durch diese Reaktionsweisen wirken die Meinungen der ersteren, da sie laut und selbstbewußt in der Öffentlichkeit geäußert werden, stärker, als sie wirklich sind, und ziehen weitere Befürworter an; die Meinungen des anderen Lagers wirken durch das Schweigen ihrer Anhänger noch schwächer, als sie tatsächlich sind. Dadurch werden andere wiederum zum Schweigen oder Meinungswechsel bewogen, bis in einem Prozeß der „Schweigespirale“ die eine Meinung die ganze Öffentlichkeit beherrscht und die Gegenmeinung so gut wie verschwunden ist.“5
2.1 Begriffsbestimmung „Meinung“
Im Zusammenhang mit der Schweigespirale, ist es wichtig zu erklären, was Elisabeth Noelle- Neumann unter "Meinung" versteht. Für sie ist Meinung alles, was man in der Öffentlichkeit äußern und zeigen kann, ohne sich zu isolieren. So zeigt man seine Meinung beispielsweise auch durch einen Aufkleber auf dem Auto, einen Aufdruck auf dem T-Shirt oder ein Abzeichen am Jackenaufschlag. „Der Begriffsbestandteil „Meinung“ bezieht sich nicht nur auf „Meinungen“ im engeren Sinn, sondern auch auf den öffentlich sichtbaren Ausdruck von Meinungen im Handeln wie in Symbolen (Abzeichen, Kleidung, Haartracht).“6
2.2 Ursprung der Schweige-Hypothese
Noelle-Neumann sagt, dass sie die Hypothese in erster Linie den Studentenunruhen Ende der 60er Jahre verdankt. Sie traf eines Tages in dem Vorraum eines Hörsaals eine Studentin, die an ihrem Jackenaufschlag ein CDU-Abzeichen trug und sagte zu ihr, dass sie gar nicht gewusst habe, dass die Studentin CDU-Anhänger sei, worauf diese erklärte, dass sie das auch nicht wäre, sondern nur einmal sehen wolle, wie das so sei. Als Noelle-Neumann die Studentin am Nachmittag wieder traf, trug diese das Abzeichen nicht mehr. Als sich die Demoskopin nach der Ursache dafür erkundigte, bekam sie zur Antwort: „ich habe es abgemacht, es war zu furchtbar.“78 Hintergrund dieser Aussage ist, dass die Anhänger von SPD und CDU der Anzahl nach zwar gleich sein können, sie ihre Überzeugung aber unterschiedlich zeigten. Öffentlich sah man damals nur SPD-Abzeichen und so gut wie keine CDU-Abzeichen. Das führte dazu, „daß das Kräfteverhältnis von der Bevölkerung falsch eingeschätzt wurde“.9
Wer von der SPD überzeugt war, spürte, wie das, was er dachte von allen gebilligt wurde und war dadurch bereit, seine Meinung öffentlich zu zeigen. Diejenigen, die ihre SPD-Zugehörigkeit nicht bekundeten, fühlten sich allein gelassen, zogen sich zurück und verfielen in schweigen.
Dieser Prozess verstärkt sich selbst, weshalb hierfür auch der Begriff der Schweigespirale10 gewählt wurde.
2.3 Die Bundestagswahl von 1965
Die Bundestagswahlen von 1965 stellten die Demoskopen vor ein Rätsel. Die beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD lagen von Dezember 1964 an bis fast zum Wahltag am 19.
September 1965 in ihren Anhängerzahlen Kopf an Kopf. Eine andere Zahlenreihe bewegte sich dagegen völlig anders. Leute wurden gefragt: „Wissen kann das natürlich niemand, aber was glauben sie, wer die Wahl gewinnt?“ Im Dezember 1964 waren es ungefähr gleich viele, die einen Sieg von CDU/CSU oder einen Sieg der SPD erwarteten, die SPD hatte einen leichten Vorsprung“.11 Dann stieg die Siegeserwartung für die CDU/CSU und fiel für die SPD, bis die CDU/CSU im August 1965 einen Vorsprung von fast 50 Prozent hatte. Das Wahlergebnis lautete dann 49,5% für die CDU/CSU und 38,5% für die SPD.
Elisabeth Noelle-Neumann schreibt darüber in ihrem Buch: „Es war, als ob die beiden Messungen, die Messung der Wahlabsicht und die Messung der Siegeserwartung, auf verschiedenen Planeten vorgenommen worden seien. Und dann ganz am Ende erst kam der Mitläufereffekt. Wie von einer Strömung wurden drei bis vier Prozent der Wähler in der Richtung der allgemeinen Siegeserwartungen getragen“.12
2.4 Erklärung
Paul F. Lazarsfeld hatte diesen Effekt schon bei seiner „The Peoples Choice“-Studie bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 1940 festgestellt und „bandwaggon effect“ genannt. Bandwaggon effect deshalb, weil es daran erinnern soll, dass bei einem Umzug die Leute dem Wagen mit der Kapelle an der Spitze des Zuges nachlaufen. Seine Begründung war, dass jeder auf der Siegerseite sein will.13
[...]
1 Nach URL: http://www.welt.de/daten/1996/12/18/1218s3109/99.htx
2 Nach URL: http://www.medienrezeption.de/forum97/referenten/noelle-neumann.html
3 Noelle-Neumann, Elisabeth (1982): Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung - unsrer soziale Haut, 1. Auflage, S. 13
4 Schenk, Michael (1987): Medienwirkungsforschung, 1. Auflage, S. 325
5 Neidhardt, Friedhelm / Lepsius, Rainer M. / Esser, Hartmut: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. In: Massenkommunikation - Theorien, Methoden, Befunde, 30, Jg. 1989, S. 419f.
6 Neidhardt, Friedhelm / Lepsius, Rainer M. / Esser, Hartmut: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. In: Massenkommunikation - Theorien, Methoden, Befunde, 30, Jg. 1989, S. 419
7 nach Noelle-Neumann, Elisabeth (1991): Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung - unsrer soziale Haut, 3. Auflage, S. 17
8 Noelle-Neumann, Elisabeth (1991): Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung - unsrer soziale Haut, 3. Auflage, S. 17
9 Noelle-Neumann, Elisabeth (1991): Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung - unsrer soziale Haut, 3. Auflage, S. 18
10 wird auch Spiralmodell, Spiralprozeß oder Schweigehypothese genannt
11 Noelle-Neumann, Elisabeth (1991): Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung - unsrer soziale Haut, 3. Auflage, S. 15
12 Noelle-Neumann, Elisabeth (1991): Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung - unsrer soziale Haut, 3. Auflage, S. 16
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptaussage des Textes zur Schweigespirale?
Der Text beschreibt Elisabeth Noelle-Neumanns Theorie der Schweigespirale, die besagt, dass Menschen, die das Gefühl haben, ihre Meinung wird in der Öffentlichkeit nicht geteilt, eher dazu neigen, zu schweigen, um Isolation zu vermeiden. Dies führt dazu, dass die vermeintliche Mehrheitsmeinung in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird als sie tatsächlich ist, während Gegenmeinungen durch das Schweigen ihrer Anhänger schwächer erscheinen. Der Text beleuchtet auch die Ursprünge der Theorie, die Rolle der Meinungsforschung und gibt Beispiele.
Wer ist Elisabeth Noelle-Neumann?
Elisabeth Noelle-Neumann war eine deutsche Meinungsforscherin und Professorin, geboren 1916 in Berlin. Sie gründete das Institut für Demoskopie in Allensbach und entwickelte die Theorie der Schweigespirale, die zu ihren bedeutendsten Beiträgen zur Kommunikationsforschung zählt.
Was versteht Noelle-Neumann unter "Meinung" im Kontext der Schweigespirale?
Für Noelle-Neumann umfasst "Meinung" nicht nur die verbale Äußerung, sondern auch jede Form des öffentlichen Ausdrucks von Überzeugungen, wie beispielsweise durch Aufkleber, Kleidung oder Abzeichen, also alles, womit man öffentlich seine Haltung zeigen kann, ohne soziale Ausgrenzung zu riskieren.
Wie kam Noelle-Neumann zur Hypothese der Schweigespirale?
Noelle-Neumann entwickelte die Hypothese inspiriert durch die Studentenunruhen Ende der 1960er Jahre. Eine Schlüsselerfahrung war die Beobachtung, wie unterschiedlich Studenten ihre politischen Überzeugungen (CDU vs. SPD) durch das Tragen von Abzeichen öffentlich zeigten, was zu einer verzerrten Wahrnehmung der Kräfteverhältnisse führte.
Was sind die zentralen Elemente der Schweigespirale?
Die zentralen Elemente sind die Angst vor Isolation, die ständige Beobachtung der öffentlichen Meinung, die Bereitschaft, die eigene Meinung zu äußern, wenn sie als mehrheitsfähig wahrgenommen wird, und die Neigung, zu schweigen, wenn die eigene Meinung als Minderheitsmeinung erscheint. Diese Dynamik führt zu einer sich selbst verstärkenden Spirale, in der eine Meinung immer dominanter wird.
Welche Rolle spielt die Bundestagswahl von 1965 in der Erklärung der Schweigespirale?
Die Bundestagswahl von 1965 lieferte ein frühes Beispiel für die Schweigespirale. Obwohl CDU/CSU und SPD in den Umfragen fast gleichauf lagen, erwartete die Mehrheit der Befragten einen Sieg der CDU/CSU. Dieses Auseinanderklaffen von Wahlabsicht und Siegeserwartung deutete darauf hin, dass Wähler ihre Präferenz aufgrund des erwarteten Wahlausgangs änderten ("Mitläufereffekt").
Was ist der "Bandwagon-Effekt" und wie hängt er mit der Schweigespirale zusammen?
Der "Bandwagon-Effekt", auch "Mitläufereffekt" genannt, beschreibt die Tendenz von Menschen, sich der vermeintlichen Mehrheitsmeinung anzuschließen, um auf der "Siegerseite" zu stehen. Noelle-Neumann bezieht sich auf diese Theorie von Paul F. Lazarsfeld, um zu erklären, warum sich bei der Bundestagswahl 1965 einige Wähler am Ende der Partei anschlossen, von der sie einen Wahlsieg erwarteten.
- Quote paper
- Ina Alabowitz (Author), 2000, Die Schweigespirale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101425