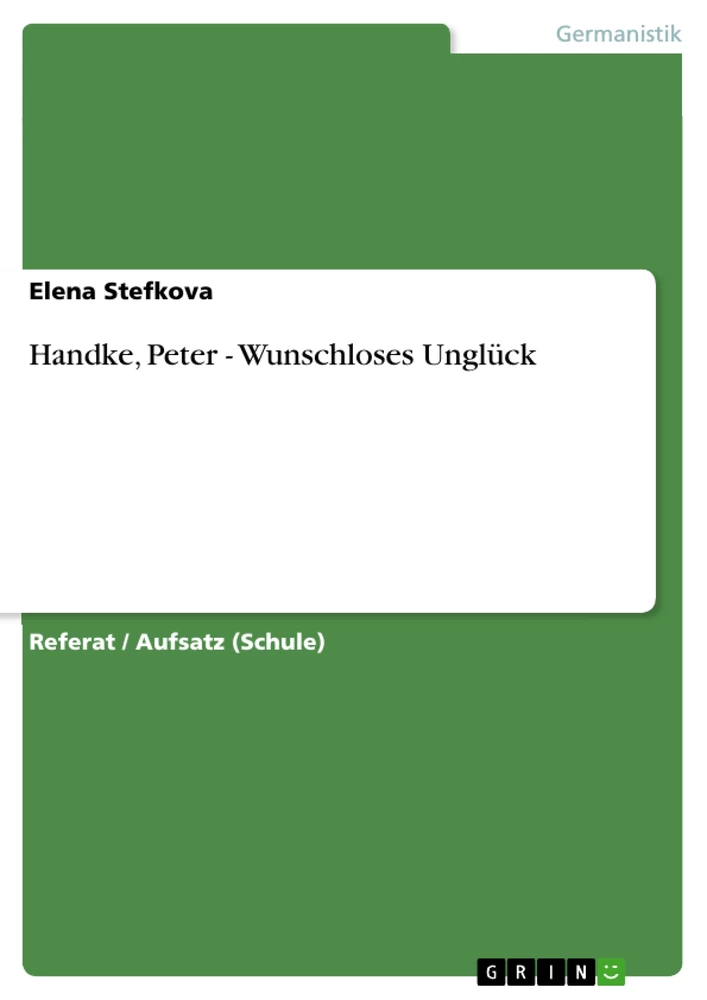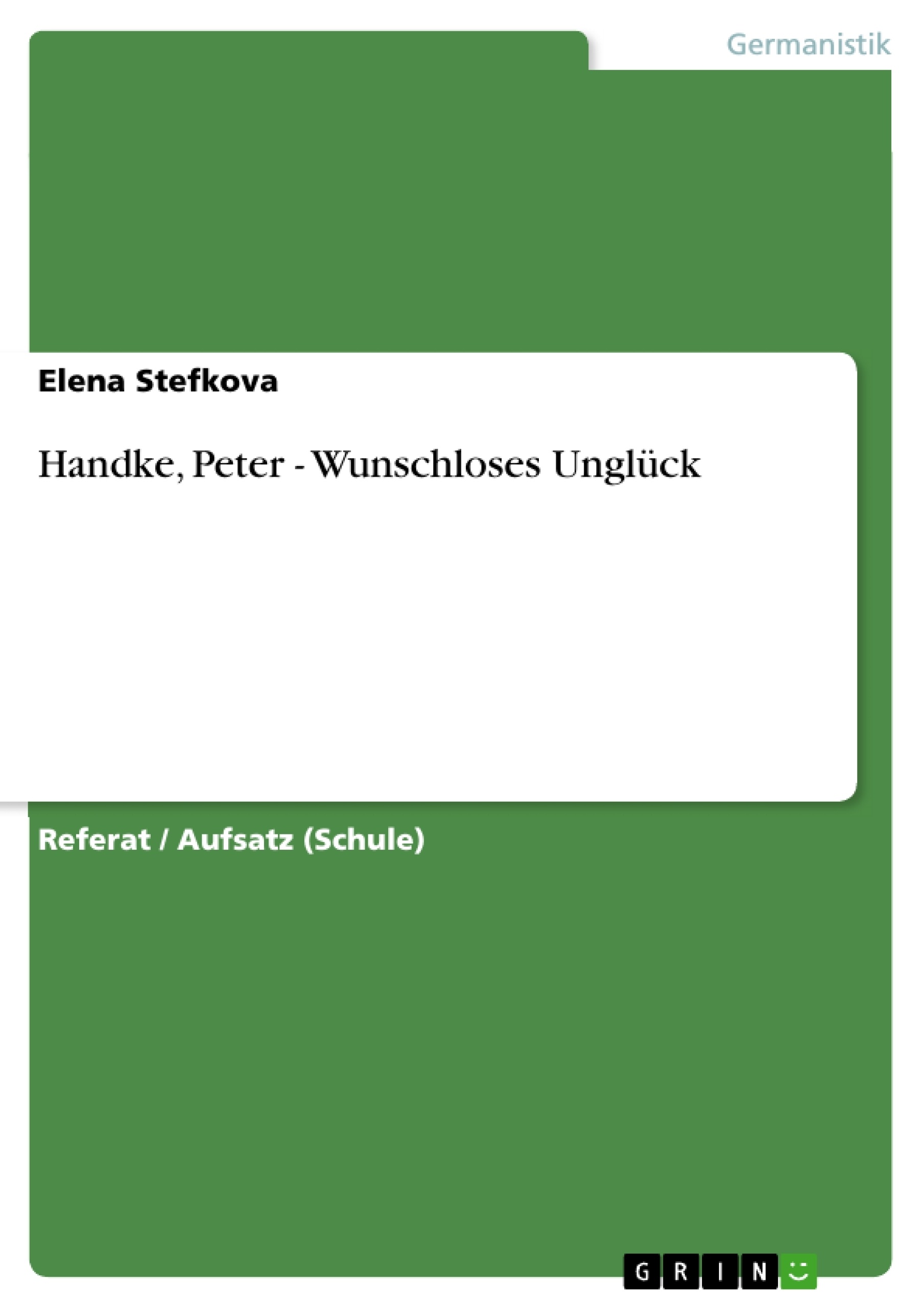Ein erschütternder Bericht über das Leben einer Frau, gefangen in den Zwängen ihrer Zeit, enthüllt sich in Peter Handkes "Wunschloses Unglück". Der Leser wird Zeuge einer Kindheit in Kärnten, geprägt von kirchlicher Dominanz und dem Echo feudaler Strukturen, in denen weibliche Lebensentwürfe kaum Raum fanden. Die Erzählung folgt dem Weg einer intelligenten, lebensfrohen jungen Frau, deren Bildungswünsche an den patriarchalischen Strukturen scheitern und die sich in die vermeintliche Geborgenheit der Nachkriegszeit flüchtet. Der Anschluss Österreichs, Kriegserlebnisse und die Ehe mit einem ihr zuwideren Mann formen ihr Schicksal. Handke zeichnet ein eindringliches Psychogramm einer Frau, die sich zwischen Anpassung und dem Wunsch nach Selbstverwirklichung aufreibt. Ihre Erfahrungen in Berlin, die Rückkehr in die Heimat, die Erlebnisse des Wiederaufbaus und die aufkommende Moderne, all dies spiegelt sich in ihrem inneren Kampf wider. Das Buch ist nicht nur eine Biographie, sondern auch eine Auseinandersetzung mit der österreichischen Geschichte, der Rolle der Frau in der Gesellschaft und den Auswirkungen von Krieg und Trauma auf die menschliche Psyche. Die wachsende Entfremdung von ihrem Mann, die Sorgen um ihren Sohn und die zunehmende innere Leere führen schließlich zu einem tragischen Entschluss. Handkes Sprache ist präzise und einfühlsam, er vermeidet jede Sentimentalität und schafft dennoch ein tief berührendes Porträt einer Frau, deren "wunschloses Unglück" exemplarisch für die verlorenen Träume einer ganzen Generation steht. Dieses Buch ist ein Muss für Leser, die sich für österreichische Literatur, Frauengeschichte und die Abgründe der menschlichen Seele interessieren. Es ist ein Denkmal für eine Mutter und eine Mahnung, die individuellen Schicksale hinter den großen historischen Ereignissen nicht zu vergessen. Ein wichtiges Werk über Familiengeschichte, Frauenschicksal, Selbstmord, österreichische Geschichte, Nachkriegszeit, Trauma, Emanzipation, und die Suche nach dem eigenen Ich.
Peter Handke: Wunschloses Unglück
Autor:
Ein österreichischer Schriftsteller, der im Jahre 1942 in Griffen geboren wurde. Er schrieb unkonventionelle Dramen, Erzählungen, Essays. Publikumsbeschimpfung (1966), Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt (1969), Der kurze Brief zum langen Abschied (1972), Die linkshändige Frau (1976), Über die Dörfer (1981).
,,Natürlich ist es ein bisschen unbestimmt, was da über jemand Bestimmten geschrieben steht; aber nur die von meiner Mutter als einer möglicherweise einmaligen Hauptperson in einer vielleicht einzigartigen Geschichte ausdrücklich absehenden Verallgemeinerungen können jemanden außer mich selber betreffen - die bloße Nacherzählung eines wechselnden Lebenslaufs mit plötzlichem Ende wäre nichts als eine Zumutung. Ich vergleiche also den allgemeinen Formelvorrat für die Biographie eines Frauenlebens Satzweise mit dem besonderen Leben meiner Mutter, aus den Übereinstimmungen und Widersprüchlichkeiten ergibt sich dann die eigentliche Schreibtätigkeit."Peter Handke
Personenbeschreibung (Inhalt):
Der Erzähler liest in der Kärntner Zeitung einen Bericht, dass seine Mutter Selbstmord verübt hat. ,,In der Nacht zum Samstag verübte eine 51jährige Hausfrau aus A. (Gemeinde G.) Selbstmord durch einnehmen einer Überdosis von Schlaftabletten." Er hat einer gewissen Zeit das Bedürfnis, über sie zu schreiben. ,,Endlich keine Langeweile mehr, ein widerstandsloser Körper, keine anstrengenden Entfernungen, ein schmerzloses Zeitvergehen." Eigentlich hat er keine Lust mit den anderen über den Tod seiner Mutter zu sprechen, aber wenn schon, dann ärgert es ihn nur, wenn die anderen dazu etwas zu bemerken haben. ,,Und ich schreibe die Geschichte meiner Mutter, einmal, weil ich von ihr und wie es zu ihrem Tod kam mehr zu wissen glaube als irgendein fremder Interviewer,... dann im eigenen Interesse, weil ich auflebe, wenn mir etwas zu tun gibt, und schließlich, weil ich diesen Freitod geradeso wie irgendein außenstehender Interviewer, wenn auch auf andre Weise, zu einem Fall machen möchte."1 Er ist sich der Schwierigkeit bewusst und macht sich an die Arbeit:
Seine Mutter wurde in einer Gegend geboren, in der fast alles der Kirche angehörte und wo fast noch die Zustände von der Zeit der Leibeigenschaft herrschten. Sein Großvater, ein uneheliches Kind slowenischer Abstammung und später ein Zimmermann, wuchs ,,als erster in einer Umgebung auf, in der er sich auch wirklich zu Hause fühlen konnte, ohne gegen tägliche Arbeitsleistung nur geduldet zu sein." Für ihm hat sein kleiner Besitz ,,verdinglichte Freiheit" bedeutet, dass er noch freier werden wollte, was damals hieß - den Besitz zu vergrößern und beginnen zu sparen. Durch die Inflation verlor er das Ersparte, was ihn aber nicht hinderte weiter zu sparen. Später unterdrückte er sogar seine eigenen Bedürfnisse, um mehr Geld zu ersparen. ,,Und hat als Staatsrentner bis heute damit nicht aufgehört." Sein Sohn, als Zimmermeister, spart nicht, sondern investiert und amüsiert sich umso mehr. Die Frauen in der Zeit hatten aber keine Zukunft - ,,als Frau in diese Umstände geboren zu werden, ist von vornherein schon tödlich gewesen jedenfalls keine Zukunftsangst." Alles war schon vorhergesehen, und ihre Zukunft ,,nichts als ein Witz". Seine Mutter war eine sehr gute Schülerin, und eine fröhliche Person. ,,Es wurden keine Zeitungen gelesen als das Sonntagsblatt der Diözese und darin nur der Fortsetzungsroman." ,,Selten wunschlos und irgendwie glücklich und meistens wunschlos und ein bisschen unglücklich." Ihr Vater ließ sie nicht weiterlernen, auch wenn sie ihn vergeblich gebettelt hatte, endlich hatte sie zu etwas Lust, aber die wurde einfach abgewiesen. Sie ging weg von Zuhause, in ein Hotel, wo sie bald kochen gelernt hat. ,,Eine geheimnislose, überschwengliche Lust zur Geselligkeit." Da sie sich nicht für Politik interessierte, genoss sie den Jubel und die Feste beim Anschluss Österreichs an Deutschland 1938. ,,Der ländlichen Bevölkerung wurden die geschichtlichen Ereignisse als Naturschauspiel vorgestellt." Zum ersten mal gab es Gemeinschaftserlebnisse - ,,selbst das befremdend automatische Arbeit wurde sinnvoll, als Fest. Die Bewegungen... montierten sich dadurch... zu einem sportlichen Rhythmus - und das Leben bekam damit eine Form, in der man sich gut aufgehoben und doch frei fühlte." ,,Gemeinnutz geht vor Eigennutz, Gemeinsinn geht vor Eigensinn." - so war man plötzlich überall zu Hause, hatte viele neue Bekannte, dass man etwas vergessen konnte. Sie war zum ersten Mal stolz, allgemein stolz, ,,weil nun alles, was man tat, irgendwie wichtig war,... als Ausdruck eines endlich erreichten Lebensgefühls. In dieser Zeit wurde sie selbstständig - selbst der beginnende Krieg brachte zuerst nur ,,ein neues Gefühl für Entfernungen" und ,,das Erlebnis einer sagenhaften Welt". Erstmals auch ein Familiengefühl. Und so die erste Liebe in einen verheirateten Zahlmeister; sie leistete ihm Gesellschaft. "Es belustigte sie selber, dass sie einmal jemanden, und gerade so einen, liebgehabt hatte." Er war viel älter als sie. Von ihm bekam sie auch ihr erstes Kind - Peter. Es gab keinen anderen mehr, für den sie noch so was fühlen könnte. Kurz vor der Entbindung heiratete sie einen Unteroffizier der deutschen Wehrmacht, der sie schon lange verehrte. ,,Er war ihr zuwider, aber man redete ihr das Pflichtbewusstsein ein (dem Kind einen Vater geben)", denn ein uneheliches Kind war damals undenkbar. Mit dem Kind fuhr sie nach Berlin zu den Eltern ihres Mannes. Doch als die ersten Bomben fielen, fuhr sie zurück. Ihren Ehemann hat sie gleich vergessen und hat sich um ihr Kind gekümmert. Doch ,,eine Äußerung von weiblichem Eigenleben in diesem ländlich-katholischen Sinnzusammenhang war überhaupt vorlaut und unbeherrscht". Eine Frau wurde schief angeschaut, wenn sie zufällig errötete, und sie musste sich dafür schämen. ,,Nun merkte sie, dass die Lebensform der andern, in dem sie jede zweite Möglichkeit ausschloss, auch als alleinseligmachender Lebensinhalt auftrat." Die Gesellschaft lebte ihr Leben nur zum Beispielnehmen vor. So wurde man ausgehungert. ,,Man fühlte sich ja frei - konnte aber nicht heraus damit." Bald nach dem Krieg fuhr sie wieder nach Berlin zu ihrem Mann und beide befolgten lustlos das Pflichtprinzip. In diesem Elend wurde sie eine recht elegante Frau. Ihr betrunkener Mann konnte ich nichts mehr anhaben. Sie gingen aber zusammen aus und waren ein schönes Paar. Sie lebte auf, wurde aber trotzdem nichts, weil sie einfach nur eine ,,Frau" war. ,,Sie nahm Verstand an, ohne etwas zu verstehen." Wegen den Umständen musste sie kleinlich und haushälterisch werden. Sie wurde hilflos und war leicht zu erniedrigen. Aber bei den Nachbarn war sie beliebt. Aber sie fühlte sich wie etwas Halbes. Man musste sich an die allgemeine Entschlossenheit anpassen, denn man konnte sich nicht persönlich entschließen. ,,Das alles, nicht um ein andrer Mensch, sondern um ein Typ zu werden." Man fühlte sich ,,von seiner eigenen Geschichte" befreit und litt nicht mehr unter irgendeinen Vorwürfen. Motto: ,,Heute will ich an nichts denken, heute will ich nur lustig sein." Und so verwandelte sich alles Persönliche in das Typische. Zu Hause bei dem Mann war es kein Leben.
,,Im Frühsommer 1948 verließ meine Mutter mit dem Ehemann und den zwei Kindern, das knapp einjährige Mädchen in einer Einkaufstasche, ohne Papiere den Ostsektor." Heimlich überquerten sie im Morgendämmerung zwei Grenzen. Endlich sind sie bei ihrer Familie angekommen. Ihr Mann wird eingestellt und sie selber arbeitet im Haushalt und bekommt ihr drittes Kind. ,,Sie ließ sich von niemandem mehr etwas sagen jetzt lachte sie die anderen einfach aus", dass sie lieber still wurden. ,,Es war lächerlich, ernstlich Wünsche zu äußern." Die Menschen wollten von einem gar nicht wissen, wie es ihm geht, denn man sprach nicht mehr über sich selbst. ,,Spontan zu leben - ...das hieß schon, eine Art von Unwesen treiben." Man war als Mensch einfach nichts Besonderes. Aber sie wollte so nicht leben - sie wurde leichtsinnig. Aber sparen musste sie auch. Selbst zu Weihnachten überraschte man sich gegenseitig mit dem Notwendigsten - und man meinte, man habe sich gerade das gewünscht, was man von dem anderen bekommen hat. Der Mann schlug sie, weil er oft betrunken nach Hause kam - sie lachte ihn aber nur aus, die Kinder ängstigten sich in der Stille vor ihren Mutter. Die Familie war arm. Dieses Verhalten wurde schon den Kindern in der Schule beigebracht - arm, aber rein. "Die gänzlich Ausgebrannten genierten sich nur, die Armut war tatsächlich eine Schande." Sogar das, auf was man gesetzlichen Anspruch hatte, musste man nachweisen - so war die damalige Zeit.
Als sich schließlich moderne Haushaltsgeräte durchsetzten, wusste man zuerst gar nicht, was man mit der freien Zeit anfangen soll. Die Mutter fand langsam wieder zu sich zurück und fing an, sich zu behaupten. Sie las Bücher mit Peter, ,,wo sie die Geschichten mit dem eigenen Lebenslauf vergleichen konnte" und lernte so über sich zu reden. ,,So erfuhr ich allmählich etwas von ihr." Beim Lesen und Reden tauchte sie wieder mit einem neuen Selbstgefühl auf, sie dachte einmal auch an sich selbst und kümmerte sich nicht mehr so, was die anderen dazu sagen. ,,Sie wurde nachsichtig zum Ehemann." Aber sie konnten zusammen gar nicht mehr reden, doch sie ,,haben sich nicht auseinandergelebt". Sie interessierte sich auch bisschen mehr für Politik, die ihr aber nicht helfen konnte. Sie wurde ruhiger und schrie nicht mehr beim Niesen und lachte weniger laut. Niemand mehr konnte sie aus der Fassung bringen. Aber ,,sie fühlte sich schuldig an allem" - ihr Sohn trank und fuhr das Auto zwei mal kaputt. ,,Gern wäre sie einfach so weggestorben, aber sie hatte Angst vor dem Sterben." Sie hatte sonst keine Interessen und nahm am öffentlichen Leben nie statt. ,,Sie bekam starke Kopfschmerzen." Keine Tabletten halfen ihr, und es wurde immer schlimmer, dass sie schließlich jedes Körpergefühl verloren hat - es sei ein Nerv eingeklemmt. ,,Wie in einem Zoo lag da die fleischgewordene animalische Verlassenheit." ,,Seit dieser Zeit erst nahm ich meine Mutter richtig wahr." Vorhin hat er sie ab und zu vergessen, aber jetzt konnte man ihren Zustand nicht mehr übersehen. ,,Sie wurde fühllos, erinnerte sich an nichts mehr... hatte überhaupt kein Zeit- und Ortsgefühl mehr." Schließlich fuhr sie zu einem Nervenarzt, der ihr einen Nervenzusammenbruch festgestellt hat und verschrieb ihr eine Medizin oder in Abwechslung eine Reise. Sie fuhr im Sommer also nach Jugoslawien. Dort bekam sie wieder den Sinn für die Zeit und und Umgebung und die Kopfschmerzen hörten auch auf. Zu Hause erzählte sie dann viel und ging mit Peter oft essen. ,,Dachte daran, ein Fürsorgekind bei sich aufzunehmen." Peter führte sein eigenes Leben und sie schrieb ihm Briefe, die immer voller Einsamkeit waren. Ihr ging es immer schlechter und schlechter, und sie würde gerne tot sein. Das Zusammenleben mit ihrem Mann war nicht mehr vorstellbar. ,,Sie war zu allen sehr streng, winkte ab, lachte kurz aus." Das bloße Existieren wurde zu einer Tortur. Aber ebenso grauste sie sich vor dem Sterben. ,,Sie brachte die Augen nicht mehr zu." Kurz vor ihrem Selbstmord schrieb sie an alle ihre Angehörigen Abschiedsbriefe - an ihrem Mann auch: ,,Du wirst es nicht verstehen. Aber an ein Weiterleben ist nicht zu denken." Einen tag darauf fuhr sie in die Stadt und hat sich hundert Schlaftabletten besorgt. ,,Sie nahm alle Schmerztabletten, mischte ihre sämtlichen Antidepressiva darunter." An Peter schrieb sie noch, ,,sie sei ruhig und glücklich, endlich in Frieden einzuschlafen".
Gleich am nächsten Abend flog er nach Österreich. ,,Und während des ganzen Fluges war ich außer mir vor Stolz, dass sie Selbstmord begangen hatte." ,,Noch der tote Körper kam mir entsetzlich verlassen und liebebedürftig vor." Nach der Beerdigung wollten alle gleich weg gehen und Peter hatte das Bedürfnis über seine Mutter zu schreiben. ,,Sie nahm ihr Geheimnis mit ins Grab!"
,,Später werde ich über das alles Genaueres schreiben."
Erzählzeit, Erzählsituation und Figuren:
- der Autor erzählt im Rückblick über seine Mutter und ihre Kindheit, wie die Verhältnisse in ihrer Zeit waren und wie es überhaupt mit dem Leben damals war. Ihr Leben wird als Vergangenheit gezeigt, aber beim Lesen kann man es sich oft als Gegenwart vorstellen. Ihr Leben wird von Kindheit bis zu ihrem Tod beschrieben, in einer gewissen Chronologie - wie ihr Leben abgelaufen ist.
- die Handlung spielt nicht nur an einem Ort statt, bindet sich zu der Hauptperson und ihren Wanderungen. Zuerst spielt es sich bei ihr zu Hause und dann in Deutschland, doch dann kommt sie wieder nach Hause zurück. Ein mal war sie im Urlaub. Die Orte wechseln im Zusammenhang mit der Person. Es ist auch wichtig, wo es sich abspielt, denn es war gerade in der Zeit des Krieges, die Umstände waren anders als sonst. Die Bombardierung von Deutschland kommt da auch vor.
- Der Erzähler ist der Autor selbst und er erzählt über seine Mutter und ihren Selbstmord, weil er es lieber selber erzählen will, als wenn darüber ein Journalist schreiben würde. In dieser Erzählung ist also die Hauptperson seine Mutter. Ihr ganzes Leben wird beschrieben, wie er es von ihr erzählt bekommen hat und auch wie er sie selber erlebt hat. Ihre Handlung, aber auch Gedanken oder wie sie damals gedacht hat und wie sie sich mit der fortschreitenden Zeit geändert hat. Die Umgebung und die Gesellschaft, aber auch ihre Familie haben in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt. Später wurde sie selbstständig und hat Ansehen erworben. Sie wollte eine Zukunft haben.
Ihren Mann und die Familie könnte man als Platzhalter benennen, weil sie nicht die Wichtigsten der Handlung sind, aber an der Handlung und Veränderung der Hauptperson teilnehmen.
Der Autor schreibt auch bisschen über sich selbst, wie er zu dem Schreiben über seine Mutter gekommen ist und auch wie er selber über ihren Selbstmord denkt.
Stellungnahme:
Das Buch kann man ganz sicher als ein außergewöhnliches Buch bezeichnen, es ist anders als die anderen Bücher über Menschen. Dieses Buch ist eine Erzählung über Autors Mutter, voll von Gefühlen und Gedanken, und doch behält er einen gewissen Abstand. Er braucht über sie zu schreiben, sie ist eine reale Figur, keine Kunstfigur, wie man es in anderen solchen Werken bemerkt. Irgendwie war der Anfang für mich nicht so sehr verständlich, ich wusste nicht worüber er eigentlich schreiben will, aber später begann die Erzählung persönlicher zu sein, und ich wollte wissen, wie es weiter geht und warum es so mit seiner Mutter geendet hatte. Nicht mehr ihre Familie und die Umstände, sondern auch ihre Gedanken und Vorlieben werden beschrieben. Auch von dem Geschichtlichen ist es ganz interessant, wenn man über die Verhältnisse damals liest. Aber an einem bestimmten Beispiel, an einem Leben einer Frau, die dann am Ende zusammen gebrochen ist, aber sich vor dem Tode fürchtete. Sie wollte ihr eigenes Leben führen - ein Bild der Emanzipation. Eigene und allgemeine Tatsachen werden vermischt, Zusammenhänge zwischen eigenem Leben und dem Leben der Gesellschaft. Es soll uns zeigen, wie schwer es damals war, sich selbst zu verwirklichen. Er betont, dass es wichtig ist, von den anderen abzuweichen und sich zu verändern. Vielleicht sollte man das Buch mehrmals lesen um manche Sachen und Zusammenhänge zu verstehen. Für mich waren es zu viele Fakten über das Leben seiner Mutter auf einem Platz eingehäuft, aber wenn man es dann weiter liest, werden die vorigen Sachen klarer.
[...]
Häufig gestellte Fragen zu Peter Handke: Wunschloses Unglück
Wer ist Peter Handke?
Peter Handke ist ein österreichischer Schriftsteller, geboren 1942 in Griffen. Er ist bekannt für seine unkonventionellen Dramen, Erzählungen und Essays wie Publikumsbeschimpfung (1966), Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt (1969), Der kurze Brief zum langen Abschied (1972), Die linkshändige Frau (1976) und Über die Dörfer (1981).
Worum geht es in Wunschloses Unglück?
Das Buch handelt vom Selbstmord der Mutter des Erzählers. Nach einem Bericht in der Kärntner Zeitung über ihren Tod verspürt der Erzähler das Bedürfnis, über sie zu schreiben. Er möchte die Geschichte seiner Mutter erzählen, weil er glaubt, mehr über sie und die Umstände ihres Todes zu wissen als ein fremder Interviewer. Er betrachtet es als eine Art Fallstudie, aber auch als Möglichkeit, mit dem Verlust umzugehen.
Wie wird die Mutter des Erzählers beschrieben?
Die Geschichte beschreibt das Leben der Mutter von ihrer Kindheit in einer ländlichen, von der Kirche geprägten Gegend bis zu ihrem Selbstmord. Sie war eine fröhliche und intelligente Schülerin, die jedoch nicht weiterlernen durfte. Sie arbeitete in einem Hotel, heiratete unter Zwang, erlebte den Zweiten Weltkrieg und kämpfte nach dem Krieg mit den gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und den Belastungen des Familienlebens.
Welche Rolle spielt die Zeitgeschichte im Buch?
Die Zeitgeschichte, insbesondere die Zeit des Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit, spielt eine wichtige Rolle. Der Anschluss Österreichs an Deutschland, der Krieg und seine Folgen prägen das Leben der Mutter und beeinflussen ihre Entscheidungen und ihr Lebensgefühl. Die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen, besonders an Frauen, werden detailliert dargestellt.
Wie wird die Beziehung zwischen Mutter und Sohn dargestellt?
Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird aus der Perspektive des Sohnes beschrieben, der versucht, das Leben und die Motive seiner Mutter zu verstehen. Er reflektiert über ihre Briefe, ihre Einsamkeit und ihre wachsende Verzweiflung. Er thematisiert auch seine eigene Reaktion auf ihren Selbstmord und sein Bedürfnis, über sie zu schreiben.
Was sind die zentralen Themen des Buches?
Zentrale Themen des Buches sind das Leben einer Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft, der Einfluss der Zeitgeschichte auf das individuelle Schicksal, die Schwierigkeit der Selbstverwirklichung, die Entfremdung und Einsamkeit sowie die Auseinandersetzung mit dem Tod der Mutter. Es geht auch um Emanzipation und die Schwierigkeit, von gesellschaftlichen Normen abzuweichen.
Welche Erzählperspektive wird verwendet?
Der Autor selbst ist der Erzähler und blickt auf das Leben seiner Mutter zurück. Er vermischt persönliche Erinnerungen mit historischen und gesellschaftlichen Kontexten. Die Erzählung ist chronologisch aufgebaut, wobei die Lebensgeschichte der Mutter von der Kindheit bis zum Tod nachgezeichnet wird.
Wie wird der Schreibstil des Autors beschrieben?
Der Schreibstil wird als distanziert, aber dennoch von Gefühlen und Gedanken geprägt beschrieben. Der Autor behält einen gewissen Abstand zur Geschichte seiner Mutter, obwohl er gleichzeitig versucht, ihr Leben und ihre Motive zu verstehen. Es werden sowohl persönliche als auch allgemeine Fakten vermischt.
- Quote paper
- Elena Stefkova (Author), 2000, Handke, Peter - Wunschloses Unglück, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101398