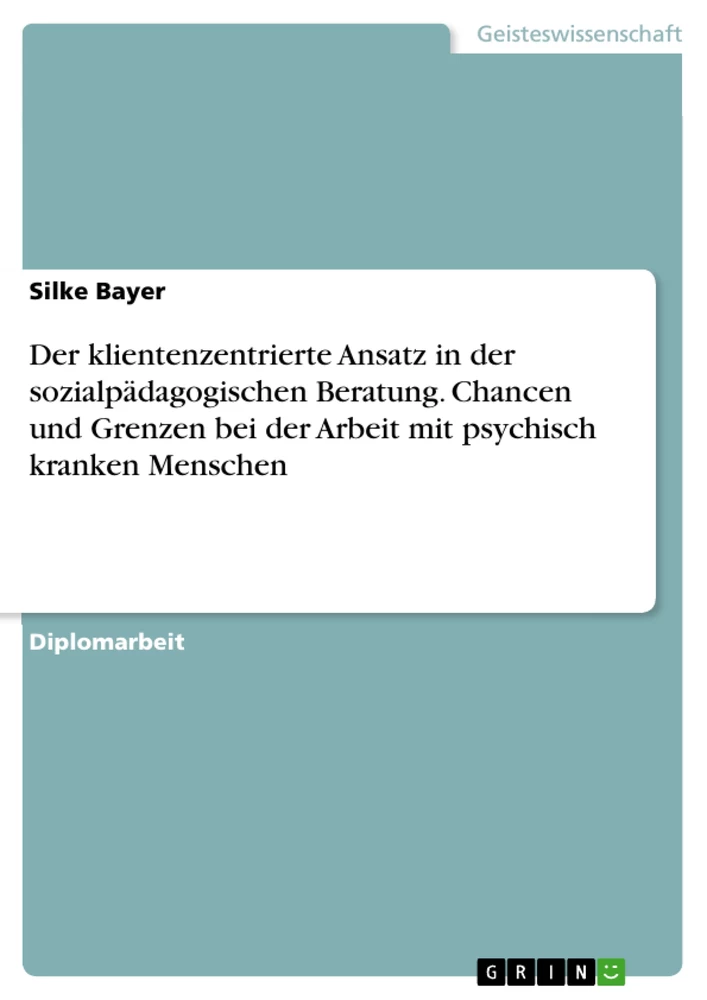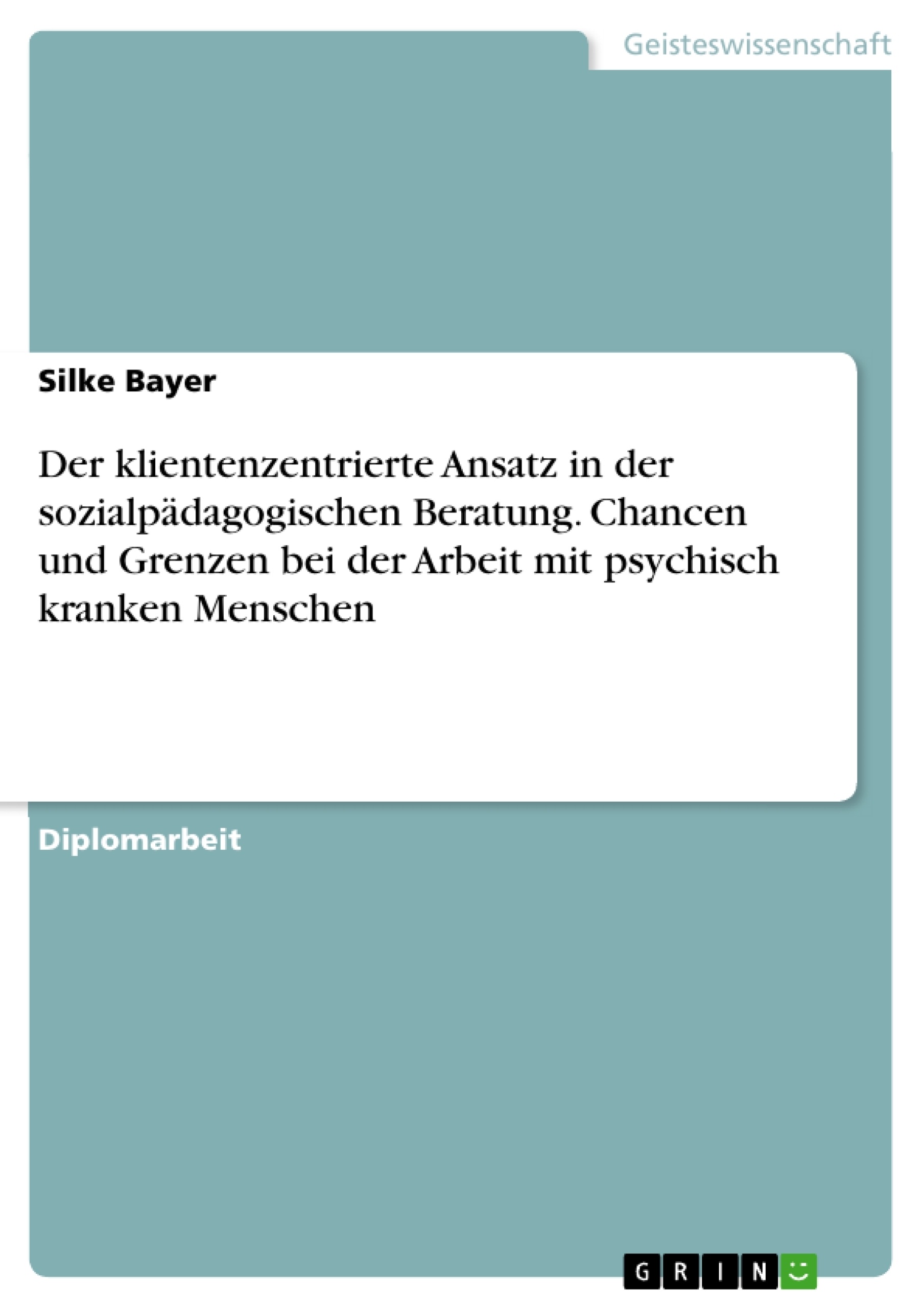In der vorliegenden Arbeit wird die „klientenzentrierte Gesprächsführung" genauer betrachtet. Außerdem wird untersucht, inwieweit der Ansatz in die Arbeit bzw. in die Beratung mit psychisch kranken Menschen einbezogen werden kann.
Mein Interesse am ersten Bereich, dem klientenzentrierten Ansatz, wuchs seit Beginn meines Sozialpädagogik-Studiums, nachdem ich in der
Lehrveranstaltung „Gesprächsführung nach Rogers" damit zum ersten Mal in Berührung kam. Mich sprach die Forderung Rogers´ nach einem echten und unmittelbar menschlichen Kontakt mit dem Gegenüber an: In den
Übungsgesprächen wurden keine Verhaltensmuster erprobt. Vielmehr waren die Öffnung zum Gesprächspartner hin, das Einfühlen in seine Situation und das akzeptierende Verstehen von Bedeutung.
Meine ersten positiven Erfahrungen bei der Anwendung des Konzepts machte ich in meinem studienbegleitenden Praktikum mit älteren Menschen und auch im privaten Umfeld. Das gab mir die Motivation, mich mit dem Ansatz weiter auseinander zu setzen. Ich wollte eine Vertiefung und mehr Handlungssicherheit erreichen. Zum einen weil ich nach meinem Abschluss gerne an einer Beratungsstelle arbeiten würde, zum anderen weil ich Kenntnisse in Gesprächsführung auch in sämtlichen anderen Tätigkeitsfeldern des Sozialwesens für essentiell halte. Da das Fachhochschulstudium sehr breit angelegt ist – was natürlich seine Berechtigung hat –, ist eine Spezialisierung auf eine bestimmten Ansatz und das Erlernen dessen praktischer Umsetzung meist nicht möglich. Daher begann ich eine Zusatzausbildung in „Klientenzentrierter Gesprächsführung" gemäß den Richtlinien der Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG).
Inhaltsverzeichnis
- A. EINFÜHRUNG
- 1. THEMATISCHER KONTEXT UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT
- 2. METHODENAUSWAHL UND AUFBAU DER ARBEIT
- B. DIE KLIENTENZENTRIERTE PSYCHOTHERAPIE NACH CARL R. ROGERS
- 1. URSPRUNG UND ENTWICKLUNG DER GESPRÄCHSPSYCHOTHERAPIE
- 1.1 Ursprung
- 1.2 Entwicklung
- 2. ROGERS' PERSÖNLICHKEITSTHEORIE
- 2.1 Aktualisierungstendenz und organismisches Wertesystem
- 2.2 Selbstkonzept und Wunsch nach positiver Beachtung
- 2.3 Zustand der Inkongruenz
- 2.4 Zustand der Kongruenz
- 3. DAS THERAPEUTISCHE BEZIEHUNGSANGEBOT UND DIFFERENZIERUNGEN DER GESPRÄCHSPSYCHOTHERAPIE
- 3.1 Die therapeutische Beziehung
- 3.1.1 Empathie oder einfühlendes Verstehen
- 3.1.2 Akzeptanz oder positive Wertschätzung
- 3.1.3 Echtheit oder Kongruenz
- 3.2 Der therapeutische Prozess
- 3.3 Differentielle Interventionsformen und integrative Ansätze
- 4. PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM KLIENTENZENTRIERTEN KONZEPT
- 4.1 Rogers' Verständnis von psychischen Störungen: ein allgemeines Störungsmodell
- 4.2 Behandlung von psychischen Störungen
- 4.2.1 Die Gesprächspsychotherapie in der Psychiatrie
- 4.2.2 Die Entwicklung einer störungsspezifischen Krankheitslehre
- 5. FORSCHUNG UND WISSENSCHAFTLICHE ANERKENNUNG
- C. DER KLIENTENZENTRIERTE ANSATZ IN DER SOZIALPÄDAGOGISCHEN BERATUNG
- 1. SOZIALPÄDAGOGISCHE BERATUNG
- 1.1 Begriffsklärung
- 1.1.1 Was ist Beratung?
- 1.1.2 Was ist sozialpädagogische Beratung?
- 1.2 Wo findet sozialpädagogische Beratung statt?
- 2. DER RECHTLICHE RAHMEN DER SOZIALPÄDAGOGISCHEN BERATUNG
- 2.1 Gesetzesgrundlagen
- 2.2 Vertrauensschutz
- 2.2.1 Schweigepflicht und Wahrung des Sozialgeheimnisses
- 2.2.2 Zeugnisverweigerungsrecht
- 2.3 Haftung
- 3. DIE BEDEUTUNG DES KLIENTENZENTRIERTEN ANSATZES IN DER SOZIALPÄDAGOGISCHEN BERATUNG
- 3.1 Psychotherapeutische Methoden in der sozialpädagogischen Beratung
- 3.2 Integration des klientenzentrierten Konzepts in die sozialpädagogische Beratung
- 3.3 Die Zusatzausbildung in klientenzentrierter Gesprächsführung und die Verbreitung des Ansatzes im psychosozialen Bereich
- 3.4 Das klientenzentrierte Vorgehen im Spannungsfeld der sozialpädagogischen Beratung
- 3.5 Kompatibilität der klientenzentrierten Gesprächsführung mit anderen Methoden und Interventionsformen
- D. ABGRENZUNG DER SOZIALPÄDAGOGISCHEN BERATUNG ZUR PSYCHOTHERAPIE
- 1. ABGRENZUNG BEZÜGLICH ÄUBERER STRUKTURELEMENTE
- 1.1 Institutionelle Gegebenheiten
- 1.2 Dauer der Maßnahme
- 1.3 Die Klientel
- 1.4 Geh-Struktur versus Komm-Struktur
- 2. FACHLICHE ABGRENZUNG
- 3. RECHTLICHE ABGRENZUNG
- 3.1 Psychotherapeutengesetz
- 3.2 Zeugnisverweigerungsrecht
- 4. ZUSAMMENFASSENDE DISKUSSION
- E. KLIENTENZENTRIERTE GESPRÄCHSFÜHRUNG MIT PSYCHISCH KRANKEN MENSCHEN
- 1. BETRACHTUNGEN BEZÜGLICH DER EIGENEN PRAXIS: EINE BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSKONTEXTES
- 1.1 Arbeitskontext
- 1.2 Zielgruppe
- 1.2.1 Um welche Gruppe der psychisch Kranken geht es?
- 1.2.2 Weitere Informationen zur Zielgruppe
- 1.3 Abgrenzung zur Soziotherapie
- 1.4 Der klientenzentrierte Ansatz in der Beratung von psychisch Kranken
- 1.4.1 Chancen
- 1.4.2 Grenzen
- 2. DURCHFÜHRUNG UND AUSWERTUNG EINES QUALITATIVEN INTERVIEWS
- 2.1 Fragestellung und Begründung der Untersuchung
- 2.2 Darstellung und Begründung der Untersuchungsmethode
- 2.2.1 Klassifikation der qualitativen Befragung
- 2.2.2 Begründung der Untersuchungsmethode
- 2.3 Stichprobenbeschreibung
- 2.4 Die Interviewsituation
- 2.5 Durchführung des Interviews anhand eines Interviewleitfadens
- 2.6 Datenaufbereitung durch wörtliche Transkription
- 2.7 Datenauswertung
- F. ZUSAMMENFASSENDE PRÄSENTATION DER ERGEBNISSE
- 1. WELCHE ERWARTUNGEN / WÜNSCHE WERDEN AN DIE BERATUNG GESTELLT?
- 1.1 Darstellung der Ergebnisse
- 1.2 Diskussion mit Schlussfolgerungen für die Praxis
- 2. WOMIT SIND DIE KLIENTEN ZUFRIEDEN, WAS HILFT IHNEN?
- 2.1 Darstellung der Ergebnisse
- 2.2 Diskussion mit Schlussfolgerungen für die Praxis
- 3. WOMIT SIND DIE KLIENTEN UNZUFRIEDEN BZW. WOMIT FÜHLEN SIE SICH UNWOHL?
- 3.1 Darstellung der Ergebnisse
- 3.2 Diskussion mit Schlussfolgerungen für die Praxis
- 4. WELCHE AUSWIRKUNGEN HABEN DIE GESPRÄCHE?
- 4.1 Darstellung der Ergebnisse
- 4.2 Diskussion mit Schlussfolgerungen für die Praxis
- 5. WIE WIRD DER BERATER BZW. DER KONTAKT MIT DIESEM WAHRGENOMMEN?
- 5.1 Darstellung der Ergebnisse
- 5.2 Diskussion mit Schlussfolgerungen für die Praxis
- 6. KÖNNEN DIE KLIENTEN IN DER BERATUNG ÜBER IHRE GEFÜHLE SPRECHEN?
- 6.1 Darstellung der Ergebnisse
- 6.2 Diskussion mit Schlussfolgerungen für die Praxis
- Die Relevanz des klientenzentrierten Ansatzes in der sozialpädagogischen Beratung von psychisch Kranken
- Die Chancen und Grenzen des klientenzentrierten Ansatzes in der Arbeit mit psychisch Kranken
- Die Auswirkungen der klientenzentrierten Gesprächsführung auf die Lebensqualität der Klienten
- Die Wahrnehmung des Beraters und die Beziehung zwischen Berater und Klient
- Die Möglichkeiten der Klienten, in der Beratung über ihre Gefühle zu sprechen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung des klientenzentrierten Ansatzes in der sozialpädagogischen Beratung von psychisch Kranken. Sie befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl R. Rogers und analysiert die Relevanz und die Einsatzmöglichkeiten dieses Ansatzes in der Praxis.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt den Leser in den thematischen Kontext der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Methode der Arbeit und erläutert den Aufbau der Arbeit. Kapitel drei gibt eine umfassende Einführung in die klientenzentrierte Psychotherapie nach Carl R. Rogers, wobei die Ursprünge und die Entwicklung der Gesprächspsychotherapie, Rogers' Persönlichkeitstheorie sowie das therapeutische Beziehungsangebot und die Differentiellen Interventionsformen in den Fokus gerückt werden. Kapitel vier widmet sich der Thematik der psychischen Störungen im klientenzentrierten Konzept und erläutert Rogers' Störungsmodell und die Behandlung von psychischen Störungen. Kapitel fünf beleuchtet die Forschung und die wissenschaftliche Anerkennung der klientenzentrierten Gesprächsführung. Kapitel sechs beschäftigt sich mit der sozialpädagogischen Beratung und den rechtlichen Rahmenbedingungen, die für diese Tätigkeit relevant sind. Kapitel sieben untersucht die Bedeutung des klientenzentrierten Ansatzes in der sozialpädagogischen Beratung, wobei der Fokus auf die Integration des Konzepts in die sozialpädagogische Beratung und die Kompatibilität mit anderen Methoden gelegt wird. Kapitel acht greift die Abgrenzung der sozialpädagogischen Beratung zur Psychotherapie auf und diskutiert die Unterschiede in Bezug auf äußere Strukturelemente, fachliche Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen. Kapitel neun beleuchtet die Anwendung des klientenzentrierten Ansatzes in der Beratung von psychisch Kranken. In diesem Kapitel wird der eigene Praxis-Kontext beschrieben und es werden die Chancen und Grenzen des Ansatzes im Umgang mit psychisch Kranken beleuchtet. Kapitel zehn widmet sich der Durchführung und Auswertung eines qualitativen Interviews mit psychisch Kranken. Dabei werden die Fragestellung, die Untersuchungsmethode, die Stichprobenbeschreibung, die Interviewsituation und die Datenaufbereitung und -auswertung erläutert. Kapitel elf präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und analysiert die Erwartungen und Wünsche der Klienten an die Beratung, die Zufriedenheits- und Unzufriedenheitsfaktoren, die Auswirkungen der Gespräche, die Wahrnehmung des Beraters und die Möglichkeit der Klienten, über ihre Gefühle zu sprechen. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt mit Schlussfolgerungen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Klientenzentrierte Gesprächsführung, Carl R. Rogers, Sozialpädagogische Beratung, Psychisch Kranke, Empathie, Akzeptanz, Echtheit, Psychotherapie, Beratung, Interviews, Qualitative Forschung, Praxis
- Quote paper
- Silke Bayer (Author), 2002, Der klientenzentrierte Ansatz in der sozialpädagogischen Beratung. Chancen und Grenzen bei der Arbeit mit psychisch kranken Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10135