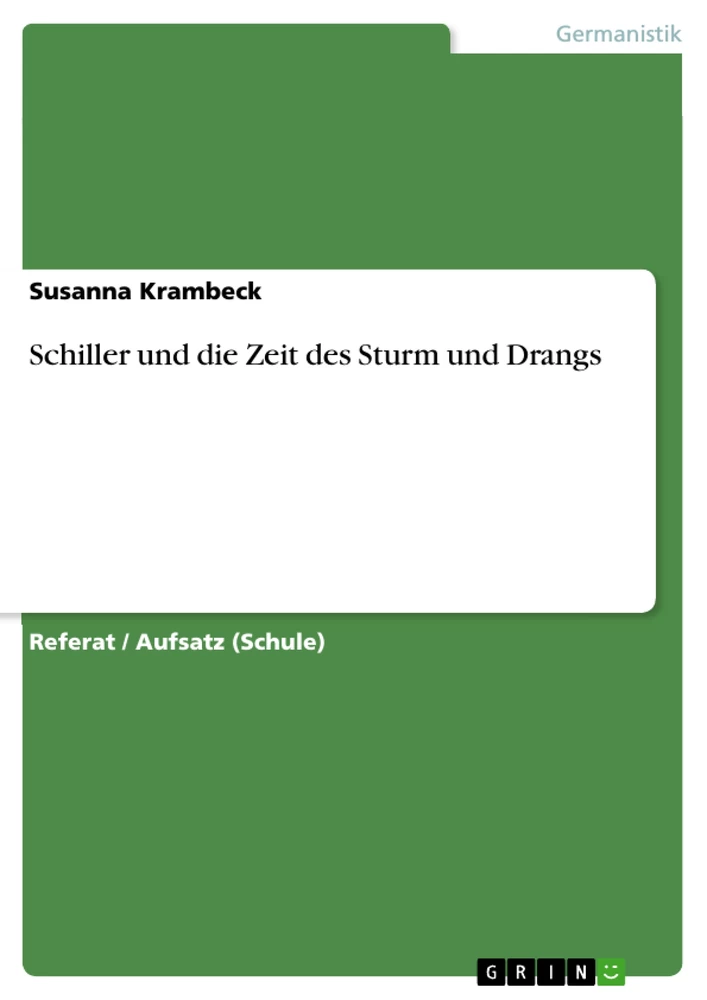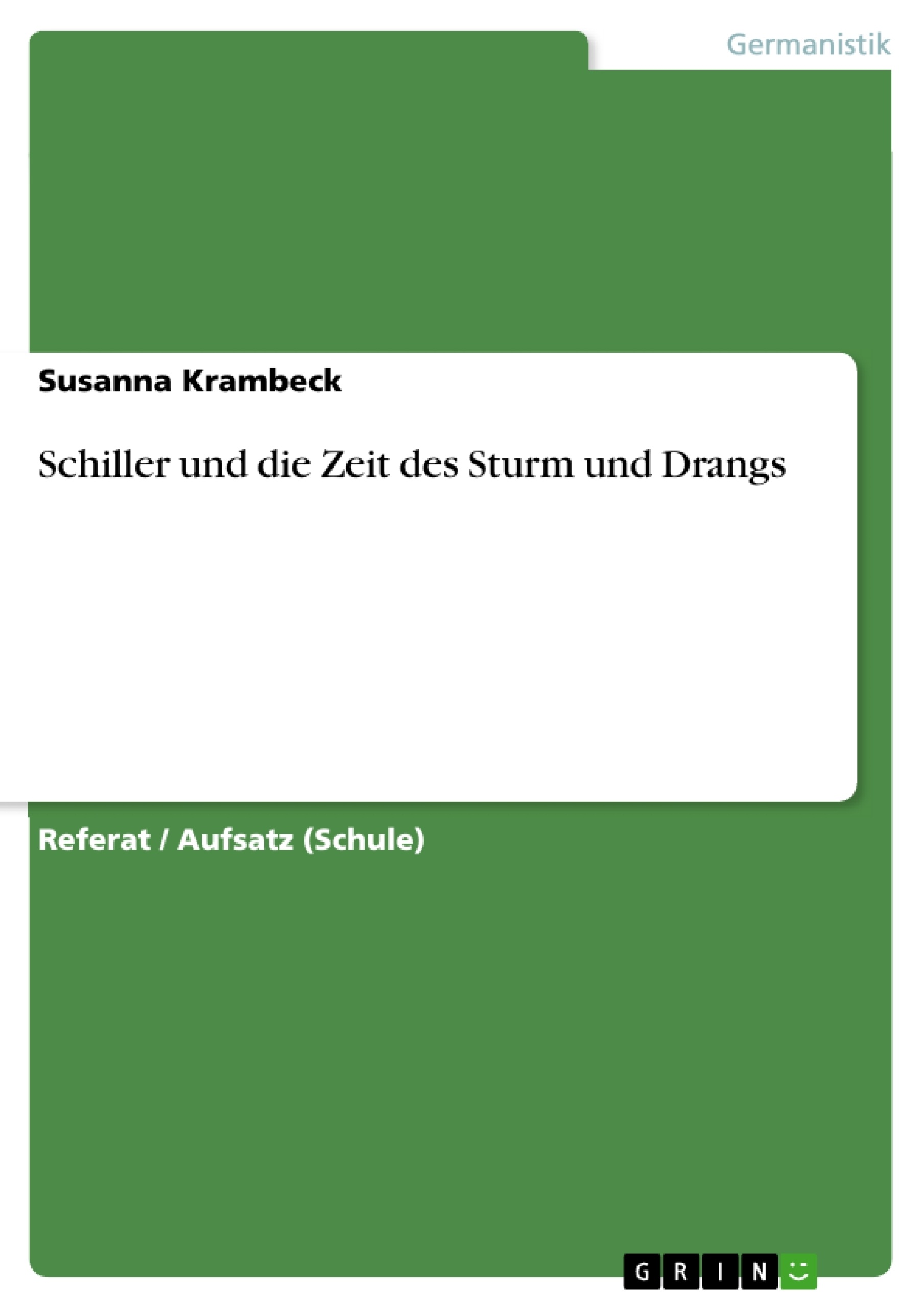Was treibt einen jungen Mann dazu, gegen die Konventionen seiner Zeit aufzubegehren und sich für die Freiheit des Geistes einzusetzen? Tauchen Sie ein in das Leben von Johann Christoph Friedrich Schiller, einem der bedeutendsten deutschen Dichter und Denker, dessen Werke die Epoche des Sturm und Drang maßgeblich prägten. Diese Biografie beleuchtet Schillers Werdegang von seiner Kindheit in Marbach am Neckar, über seine Zeit an der Militärakademie, die seinen Freiheitsdrang erst recht entfachte, bis hin zu seinem Aufstieg als gefeierter Dramatiker und Lyriker. Erfahren Sie, wie die Unterdrückung durch Herzog Karl Eugen ihn zu einem unermüdlichen Kämpfer für Humanität, Güte und Erhabenheit formte. Entdecken Sie die Hintergründe seiner berühmtesten Werke wie "Die Räuber", "Kabale und Liebe", "Don Carlos" und "Wilhelm Tell", die bis heute auf den Bühnen der Welt gespielt werden und seine Ideale der Freiheit und Selbstbestimmung verkörpern. Verfolgen Sie Schillers persönliche Entwicklung, seine Freundschaft mit Goethe, seine Auseinandersetzung mit Kant und seine lebensbedrohliche Krankheit, die ihn dennoch nicht davon abhielt, unsterbliche Werke zu schaffen. Diese fesselnde Darstellung Schillers Lebens und Schaffens bietet einen tiefen Einblick in die deutsche Literaturgeschichte und die leidenschaftliche Suche eines Mannes nach Wahrheit, Gerechtigkeit und der Verwirklichung seiner künstlerischen Vision. Ein Muss für alle Liebhaber der deutschen Klassik und solche, die es werden wollen, sowie für Leser, die sich für die Ideale des Sturm und Drang, die deutsche Literatur, die Weimarer Klassik und das Leben großer Denker und Dichter interessieren. Begeben Sie sich auf eine Reise in das 18. Jahrhundert und erleben Sie die Welt mit den Augen eines Revolutionärs des Geistes. Entdecken Sie die rebellische Kraft der Worte und die zeitlose Bedeutung von Schillers Botschaft für eine freie und humane Gesellschaft.
I. Johann Christoph Friedrich Schiller
Einführung
Der Versuch ehrlich und gerecht zu sein, macht mich zu dem der ich bin. Mein Streben nach Güte und Respekt, macht mich zu dem was ich bin. Der Kampf um meine Freiheit und Individualität macht mich zu dem wie ich bin. Meine Treue meinen Mitmenschen und mir gegenüber macht mich zu dem wer ich bin. Zielstrebigkeit und Humor sind die Gründe dafür warum ich so bin. Und trotzdem - wer bin ich eigentlich?
Schiller
„Durch die Unterdrückung von dem regierenden Herzog Karl Eugen, wurde Schiller zu dem, wofür er später berühmte werden sollte - ein Kämpfer für grenzenlose Freiheit für jedermann. Die Art und Weise, wie er diesen Kampf gewaltlos führte, vereinigte in ihm drei weitere Ideale - Humanität, Güte und Erhabenheit.
Das Bewusstsein um seine effektivste Waffe, die Kunst des Schreibens und deren Unantastbarkeit, machte ihn zu einem der bedeutendsten Dichter seiner Zeit.
Seiner Leidenschaft und dem Drang zu schreiben, war aber auch seine Besessenheit zu schreiben, die ihn manchmal an den Rand der Verzweiflung trieb. Das hohe Ideal der Bildung versuchte er durch das Theaterpublikum zu verwirklichen.“ (1)
Schiller war und ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Literatur. Er ist einer der Hauptvertreter der Sturm - und - Drang - Literaturepoche. Wie aber wurde er so berühmt?
Biografie
Johann Christoph Friedrich Schiller, Sohn eines Wundarztes und späteren Offiziers, wurde am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geboren. Zunächst lebte Schiller mit seiner Mutter Elisabeth Dorothea Schiller (geb. Kodweiß) und seiner, um zwei Jahre ältere, Schwester Christophine alleine, da sein Vater Johann Kaspar Schiller, zu dieser Zeit, als Offizier im herzoglichen Dienst, im siebenjährigen Krieg gegen Preußen mitwirkte. Nachdem der Vater Anfang 1762 in die Heimat zurückkehrte, erhielt dieser den Posten eines Werbeoffiziers in Schwäbisch - Gmünd, so dass seine Familie in die nahegelegene württembergische Grenzstadt Lorch zog.
Nachdem Schiller bereits mit fünf Jahren die Lorcher Dorfschule besuchen konnte, lernte er mit sechs Jahre bei dem Dorfpfarrer Moser Latein und wechselte abermals 1766 die Stadt; er siedelte nach Ludwigsburg über.
Mit seinem 13. Lebensjahr, kurz nach seiner Konfirmation, musste Friedrich Schiller, auf Befehl des Herzogs, in dessen Militär - Pflanzschule eintreten, um den Nachwuchs von Offizieren und Beamten, die die Meinung von Karl Eugen vertraten, zu sichern.
In den acht harten Jurastudienjahren in dieser Militäranstalt, wurde der als Jurist untragbar gewordene Schiller mit einem seiner Freunde, auf die Stuttgarter Akademie geschickt, wo er Medizin studierte. In diesem Jahr erwachte nun der Dichter in ihm. Es entwickelt sich die neue entscheidende Generation des Sturm und Drangs.
Mit dem Entlassen aus der Akademie 1780 wurde Schiller schließlich Regimentsmedikus in Stuttgart.
In dieser Zeit schrieb er einige Gedichte und beendete 1781 „Die Räuber“. Mit seiner Rückkehr von der unerlaubten Reise nach Mannheim, wo er „Die Räuber“ uraufführen ließ, erhielt er einen zweiwöchigen Arrest und das herzögliche Verbot jeder weiteren poetischen Betätigung. Damit war der innere Bruch vollzogen, nichts mehr konnte Schiller an der Flucht aus Stuttgart im Jahre 1782 zurückhalten. In Bauerbach fand er dann seine Ruhe und schöpfte nun sein ganzes künstlerisches Potenzial aus, indem er das Trauerspiel „Luise Millerin“ (wurde unter dem, nicht von ihm stammenden, Titel „Kabale und Liebe“ bekannt“) als Rache an dem Herzog Karl Eugen niederschrieb.
1783 verließ er das thüringische Gut und zog nach Mannheim, weil er dort eine Anstellung als Theaterdichter gefunden hatte. Doch bald kam Kritik gegen Schiller auf. Das ging so weit, dass er angezeigt wurde und sogar seine Schauspieler mit ihm unzufrieden waren. Schlussendlich lief sein Vertrag im September 1785 am Theater aus, so dass er der Einladung seiner Freunde nach Leipzig folgte; wenige Tage später reiste er nach Dresden, wo er das Gedicht „Hymnus an die Nacht“ und die letzten zwei Akte des „Don Carlos“ verfasste. Eineinhalb Jahre später übersiedelte er nach Weimar; es kam nie zu einer Rückkehr zu seinen Freunden.
1789 zog es ihn dann nach Jena, da eine interessante Beschäftigung als Professor für Geschichte an der dortigen Universität freigeworden war. Die Freude über diese Vorlesungen legte sich aber bald, da er Sehnsucht nach Charlotte von Lengenfeld, die er zuvor kennengelernt hatte, verspürte. Am 21. Februar 1790 heiratete er dieselbige. Durch eine dreijähriges Ehrengehalt vom dänischen Hof hatte er ab dieser Zeit die Möglichkeit, sich philosophischen Studien zu widmen; er beschäftigte sich dabei vor allem mit den Aussagen Immanuel Kants zur Ethik und Ästhetik. Zu Beginn des neuen Jahres, warf ihn dann der erste Anfall seiner lebensbedrohenden Erkrankung (Rippenfell - und Lungenentzündung) nieder. Schiller glaubte, seine Genesung größtenteils der aufopfernden Pflege seiner Frau, seiner Schwägerin, seiner Schwiegermutter und seinen Freunden zu verdanken. Trotzdem fühlte er, dass er nicht ganz geheilt war; von nun an stand Schiller unter dem Schatten des Todes. Wenige Wochen später erlitt er den dritten und bisher schwersten Anfall. Er überstand ihn, doch die Schmerzen verfolgten ihn für den Rest seines Lebens.
Zwischen den Jahren 1792/93 nahm er letztendlich seine Arbeit an der Jenenser Universität wieder auf, diesmal allerdings nur mit Vorlesungen über die ihm aus der Kritik der Urteilskraft entspringenden ästhetischen Fragen (Titel seiner Antrittsvorlesung: „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“).
Bald darauf machte sich, in leidlich guter Gesundheit, Schiller in seine Heimat zu seiner Frau, die ihm am 14. September 1793 seinen ersten Sohn Karl Friedrich Ludwig gebar, und zu seinem alten Vater.
Goethe, der jetzt erst Schiller näher trat, besuchte nun manchmal das Haus der Schillers. Im Juni 1794 führte schließlich eine kontrovers geführte Auseinandersetzung über die, von Goethe naturwissenschaftlich begründete, „Urpflanze“ zur Annäherung beider. Es soll eine lange Unterhaltung gegeben haben, wobei es einige Übereinstimmungen gab. Bald darauf entwickelte sich ein Briefwechsel, der mit einer sehr engen Freundschaft endete. Der intensive Gedankenaustausch wurde zu einer einzigartigen, für die Entwicklung der deutschen und europäischen Literatur, entscheidenden und produktiven Zusammenarbeit ( gemeinsame Herausgabe der literarischen Zeitschrift „Die Horen“) zweier doch gegensätzlicher Geistiger. Es entstanden außerdem Balladen (z.B. „Die Bürgerschaft“, „Der Handschuh“), die allesamt im jährlich herausgegebenen Musenalmanach erschienen.
1799 zog Schiller, nach der Geburt seines dritten Kindes und der überstandenen schweren Krankheit seiner Frau, zurück nach Weimar, wo er für den Rest seines Lebens blieb. In dieser Zeit vollendete er die Wallenstein - Trilogie und einige seiner wichtigsten Dramen (z.B. „Maria Stuart“, „Die Jungfrau von Orleans“, „Wilhelm Tell“...). Weiters übersetzte er ,für das von Goethe geleitet Weimarer Nationaltheater, Werke von Shakespeare („Macbeth“). Unvollendet blieb jedoch sein „Demetrius“.
Nach weiteren Erkrankungen und Kolikanfällen lebte Schiller nur noch mit der Kraft seines Geistes. Im Winter kamen die schweren Fieberanfälle zurück und setzten ihm sehr zu; manchmal führten sie zu Ohnmachten. Im März erholte er sich wieder, wurde dann aber wieder von Fieberanfällen geschüttelt. Am 09. Mai 1805 wachte er nicht mehr auf.
Seine Werke
1781 „Die Räuber“
1784 „Kabale und Liebe“ 1785 „An die Freude“ 1787 „Don Carlos“ 1800 „Wallenstein“
1801 „Die Jungfrau von Orleans“ 1801 „Maria Stuart“
1803 „Die Braut von Messina“ 1804 „Wilhelm Tell“
„Kabale und Liebe“ (1784)
Das Werk „Kabale und Liebe“ spielt im 18. Jahrhundert in und in der Umgebung einer fürstlichen Residenz. Das Werk wurde 1784 in Frankfurt uraufgeführt. Die Hauptpersonen sind der Präsident von Walter, sein Sohn Ferdinand, der Stadtmusikant Miller und dessen Tochter Luise.
Der ursprüngliche Name des fünf - aktigen Werkes lautete „Luise Millerin“, wurde aber später von Iffland umbenannt.
II. Die Literaturepoche des „Sturm und Drang“
Einzuordnen in die Zeitspanne von 1767 bis 1785 bekam diese Literaturepoche mit dem, 1775 entstandenen, Drama Friedrich Maximilian Klingers „Wirrwarr“, welches später auf Anregung von Christoph Kaufmann in „Sturm und Drang“ unbenannt wurde, ihren Namen. Diese, bereits umgangssprachliche Wortfügung „Sturm und Drang“, beschrieb damals eine Bewegung, die gegensätzlich zur Aufklärung stand, früher Ausdruck der Romantik war und welche mit dem Erscheinen von Herders „Journal meiner Reise“ im Jahre 1769 begann und mit der fluchtartigen Abreise Goethes 1786 endete.
In dieser sehr kurzen schöpferischen Periode versuchten verschieden Literaten, z.B. Johann Georg Hamann, Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Heinrich Voß und Johann Christoph Friedrich Schiller, sich gegen den Soldatenhandel und die absolutistische Herrschaft unter dem Herzog Karl Eugen aufzulehnen, ein mächtiges deutsches Reich zu errichten und dem Bürgertum die realen Vorgänge am Hof (z.B. Intrigen? Bsp.: „Kabale und Liebe“ - Schiller)durch ihre Werke zu offenbaren.
Ihr großes Ideal war außerdem der große Kerl: stets vital, erdverbunden, unmittelbar, edel, kompromisslos, aber nicht maßvoll und vorsichtig, denn alles Laue war von den Stürmern und Drängern nicht toleriert.
Ein weiteres Merkmal in dieser sogenannten „Genieperiode“ ist die Zertrümmerung der klassischen, literarischen Formen, wie die Einhaltung der Einheiten der Zeit, des Ortes und der Handlung. Dies äußerte sich in andauernden Schauplatzwechsel, Massenszenen und Nebenepisoden. Ebenso wurde auch die Sprachauswahl, durch zahlreiche Kraftwörter und gestammelte Satzfetzen im Vergleich zum klassischem Stil verändert, so dass nun nicht mehr, wie in der Aufklärung, Furcht und Mitleid, sondern Furcht und Schrecken erzielt werden sollten. Der Mensch sollte sich ab sofort nicht nur an seiner Vernunft orientieren, sich keinen außerweltlichen Gott erschaffen, Werke Gottes auch als Von - der - Natur - Stammend ansehen und Gott als konkrete Kraft innerhalb der Welt akzeptieren.
Eine andere Vorstellung war, dass sich das Individuum, durch seine eigene schöpferische Energie, zu sich selbst finden sollte und dass jeder in seinem Verhalten die persönliche Originalität beweisen kann.
Die folglich bleibende Leistung der Schriftstellen und Dichter des Sturm und Dranges lag und besteht darin, dass sie die widersprüchliche Situation des Bürgertums aufdeckten und in ihren Werken darstellten: zum Handeln drängen und nicht handeln können. Der zweite, von ihnen erreichte Fortschritt war, dass sie in ihren gelungenen Werken die Darstellung des Inneren Erlebens der Figuren mit einer realistischen Beobachtung ihrer Umwelt verbanden und sprachlich differenzierten. Diese Tendenzen wurden in der Romantik und im Realismus wieder aufgenommen und fortgeführt.
Geordnete Zusammenfassung
Allgemeines
- Zeitspanne: 1767 - 1785
- Namensgebung durch Klingers Drama „Sturm und Drang“ · Gegenprogramm zur Aufklärung
- Revolutionäre Bewegung unter den jungen Schriftstellern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
- Klopstock protestierte gegen die Unterdrückung des Bürgers durch die absolutistischen Fürsten
- Er griff die Machtpolitik Friedrich des Großen an · Verteidigte die Ideen der Französischen Revolution
Ziele der Stürmer und Dränger
- Wollten die Tyrannen stürzen und ein mächtiges deutsches Reich errichten
- Literaten wollten mit ihren Werken die Missstände in der Gesellschaft zeigen
- Man versuchte, die Probleme der Menschen und der Politik in Form von Schauspielen lösen, da der vorherrschende Despotismus (Zustand einer Gewaltherrschaft) keine andere Handlungsmöglichkeit zuließ
? Bsp.: „Kabale und Liebe“, „Götz von Berlichingen“ ? Verbot von Schillers Trauerspiel
- Dichter dieser Zeit deckten die widersprüchliche Situation des Bürgertums auf und beschrieben sie in ihren Stücken : zum Handeln drängen und nicht handeln können. · Die brennenden Fragen der Gesellschaft wurden aufgegriffen:
1. Die Schranken der Städteordnung, das Bürgermädchen zerbricht
2. Die drückende Last der Bauern, Eheverbot der Offiziere
3. Das Recht des Einzelnen, des „Kerls“, auf Selbstverwirklichung gegen die bestehende gesellschaftliche Ordnung
- Meist blieb es jedoch nur bei dem Versuch, diese Probleme zu lösen
Den adligen Stand haben die Stürmer und Dränger jedoch nie in Frage gestellt!
- Herder forderte Originalität im Verhalten von jedem Individuum
- Verherrlichung des Genies oder des „Übermenschen“, des „Kraftgenies“
? ,,Der Genius ist der einem Menschen eigentümlich bei der Geburt mitgegebene, schützende Geist, von dessen Eingebung jene originalen Ideen stammen“ (Kant)
Das neue Menschenbild
- Berufung auf Gefühle, Ahnungen, Bilder, Naturverbundenheit im Gegensatz zur leichter verständlicher Aufklärung
- Vitalität, Ursprünglichkeit und die zarte, ehrliche Gefühlsbetontheit waren wichtig · Vorbilder: Shakespeare, Ossian, Klopstock
- Originalität und Genialität als Kriterien für wahre Dichtung („Genieperiode“) · Tyrannenhass, Ablehnung des Absolutismus
- Treffen in kleinen Gruppen
- Lesen, diskutieren
- Gefühlvolle Briefe schreiben
- Eigene dynamische Sprache schaffen
Literarische Formen
- Drama als Hauptform · Volkslieder
- Neue Formen der Lyrik: Erlebnisdichtung, Gefühle, Ahnungen · Neuentdeckung der Ballade (z.B. Balladenjahr)
Historischer Hintergrund
- Vergleich der Situation Frankreichs mit Deutschland · Demokratie ? absolute Herrschaft
Wichtige Vertreter
- Johann Heinrich Voß
- Christian Friedrich Daniel Schubert · Johann Georg Hamann
- Johann Gottfried Herder
- Johann Wolfgang von Goethe · Heinrich Christian Boie
- Johann Christoph Friedrich Schiller
Abschluss
„ Nach der Eruption von 1776 schien die Bewegung zu verstummen, bis sich mit Friedrich
Schiller ein letzter, intensiver Höhepunkt ereignete. Zeitversetzt, geographisch getrennt und ohne Verbindung zu den anderen Stürmern und Drängern, die sich ganz entschieden als Gemeinschaft empfanden, gestaltete er mit den „Räubern“, dem „republikanischen“ Trauerspiel“, „Die Verschwörung des Fiesko zu Genua“ und „Kabale und Liebe“ drei Dramen, die alle Themen, von der politischen Revolte bis zur Freiheit der Leidenschaften, noch einmal bühnenwirksam umsetzten und die Epoche zum Abschluss brachten.“(2)
Der „Sturm und Drang“ war ein heftiges Gewitter. Diese Epoche ging schnell vorüber, doch ihr Nachhall ist bis in die heutige Zeit vernehmbar.
III. Quellenverzeichnis
Bücher:
- „Friedrich Schiller“ Ursula Wertheim
VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1978
1.Auflage
Best.-Nr.: 576 621 0
- „Reisen zu Schiller“ Ingrid und Lothar Burghoff
VEB Tourist Verlag Berlin 1983
1.Auflage
Best.-Nr.: 596 754 9
- „Sturm und Drang Erläuterungen zur deutschen Literatur“ Kollektiv für Literaturgeschichte
Volk und Wissen 1978
5.Auflage
Best.Nr.: 706 247 9
CD-ROM:
- „Die Deutschen Klassiker“
- X Libris München 1995
Zitate:
(1) Internet: www.zum.de/Faecher/D/Daar/gym/schilbio.htm
Häufig gestellte Fragen
Wer war Johann Christoph Friedrich Schiller?
Johann Christoph Friedrich Schiller war einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Literatur und einer der Hauptvertreter der Sturm- und Drang-Literaturepoche. Er wurde am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geboren und starb am 9. Mai 1805.
Was sind die Hauptthemen in Schillers Werk?
Schillers Werk beschäftigt sich oft mit Themen wie Freiheit, Humanität, Güte und Erhabenheit. Er thematisierte auch die Unterdrückung durch die herrschende Klasse und den Kampf für Individualität.
Was ist die Literaturepoche des "Sturm und Drang"?
Der "Sturm und Drang" war eine Literaturepoche von etwa 1767 bis 1785, die sich gegen die Aufklärung auflehnte. Autoren dieser Zeit wie Goethe, Herder und Schiller kritisierten den Absolutismus und forderten mehr Freiheit und Selbstverwirklichung für das Individuum.
Was waren die Ziele der Stürmer und Dränger?
Die Stürmer und Dränger wollten die Missstände in der Gesellschaft aufzeigen, Tyrannen stürzen und ein mächtiges deutsches Reich errichten. Sie setzten sich für die Rechte des Einzelnen und die Selbstverwirklichung ein.
Welche Werke hat Schiller geschrieben?
Zu Schillers bekanntesten Werken gehören "Die Räuber", "Kabale und Liebe", "Don Carlos", "Wallenstein", "Die Jungfrau von Orleans", "Maria Stuart" und "Wilhelm Tell".
Was ist "Kabale und Liebe"?
"Kabale und Liebe" ist ein Trauerspiel von Schiller aus dem Jahr 1784, das die tragische Liebesgeschichte zwischen Ferdinand, dem Sohn eines Präsidenten, und Luise, der Tochter eines Stadtmusikanten, thematisiert. Das Stück kritisiert die Standesunterschiede und die Intrigen am Hof.
Was waren die Merkmale des "Sturm und Drang"?
Merkmale des "Sturm und Drang" sind die Betonung von Gefühl und Individualität, die Ablehnung klassischer literarischer Formen, die Verwendung einer kraftvollen Sprache und die Kritik am Absolutismus.
Wer waren wichtige Vertreter des "Sturm und Drang"?
Wichtige Vertreter des "Sturm und Drang" waren Johann Georg Hamann, Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Heinrich Voß und Johann Christoph Friedrich Schiller.
Wie beeinflusste der "Sturm und Drang" die nachfolgenden Literaturepochen?
Der "Sturm und Drang" legte den Grundstein für die Romantik und den Realismus, indem er die Darstellung des Inneren Erlebens der Figuren mit einer realistischen Beobachtung ihrer Umwelt verband und sprachlich differenzierte.
- Quote paper
- Susanna Krambeck (Author), 2001, Schiller und die Zeit des Sturm und Drangs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101337