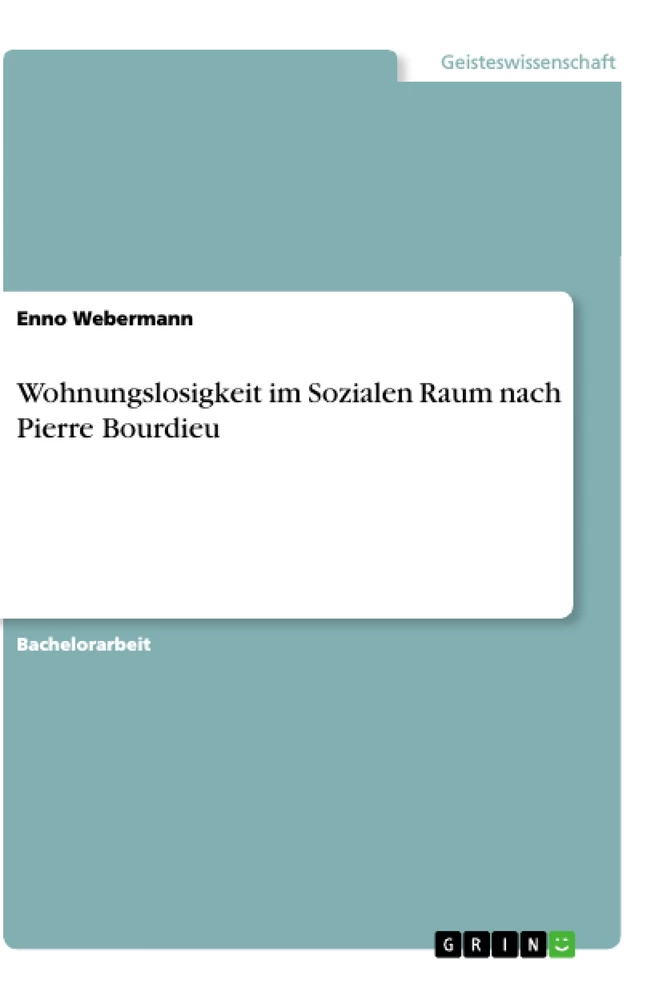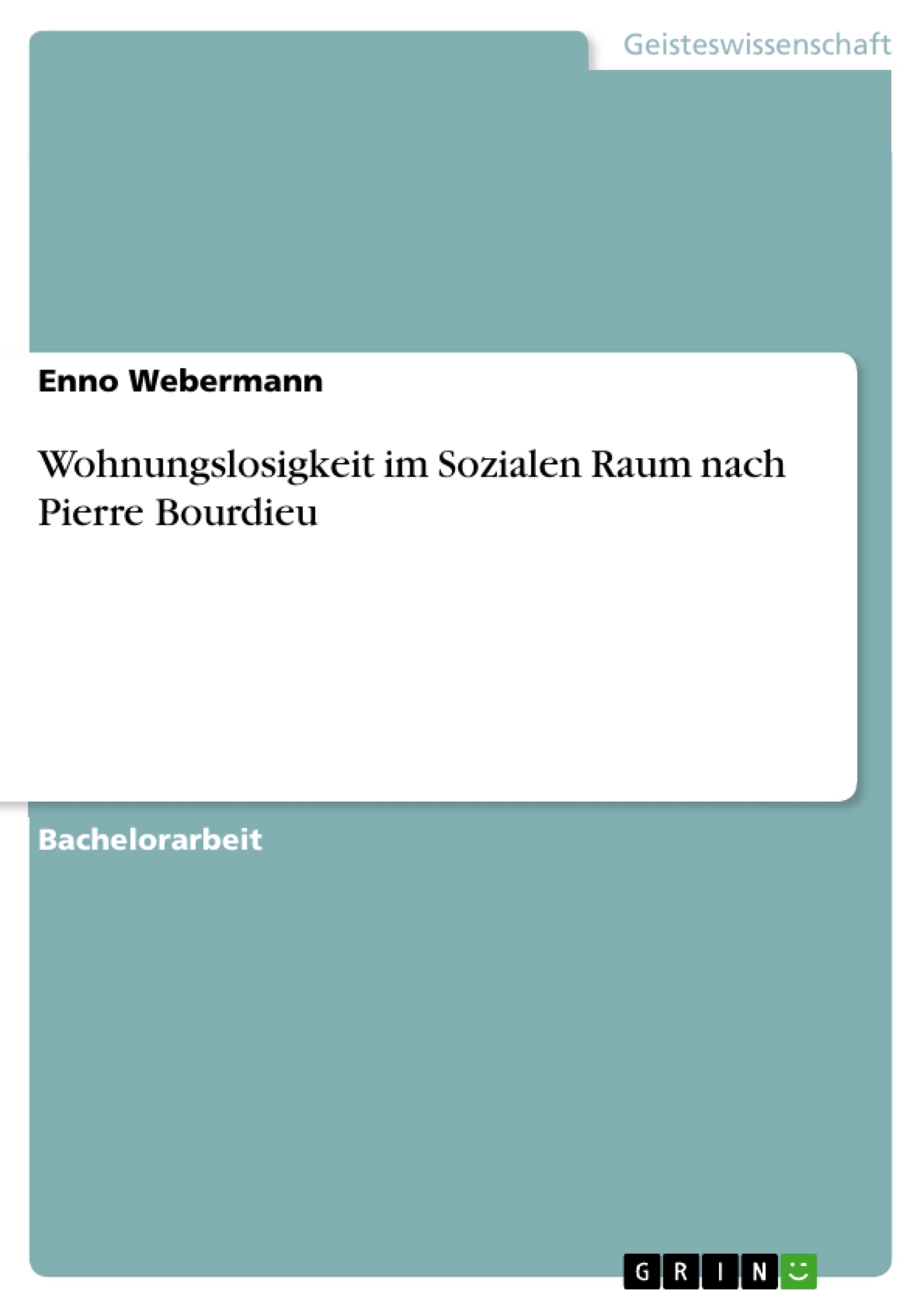Diese Arbeit stellt eine Analyse der Wohnungslosigkeit in Deutschland anhand der Theorie des Sozialen Raumes des Soziologen Pierre Bourdieu dar. Die Theorie des Sozialen Raumes ermöglicht es, Gesellschaftsgruppen anhand ihres Vermögen an Kapitalsorten innerhalb eines Koordinatenkreuzes zu positionieren. Ein großer Besitzanteil an den Kapitalsorten des ökonomischen und kulturellen Kapitals verschafft eine Positionierung im oberen Abschnitt. Ein geringer Besitzanteil positioniert die Gruppen hingegen im unteren Abschnitt. Für die Analyse wurden qualitative, sowie quantitative Studien herangezogen, welche die wissenschaftlichen Kriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen. Das Ziel der Untersuchung, die Analyse der Wohnungslosigkeit im Sozialen Raum, konnte aufgrund des wertvollen und repräsentativen Datenmaterials erreicht werden.
Welchen Maßnahmen bedarf es, um Risikogruppen vor der Wohnungslosigkeit zu wahren? Welche Arten von politischen Implikationen können der Gesellschaft dabei helfen, potenzielle Wohnungslose frühzeitig, noch vor dem Verlust des Wohnraumes, zu erkennen und zu schützen? Welche Ressourcen auf politischer, sozialer und ökonomischer Ebene müssen verlagert werden, damit Wohnungslosigkeit nicht länger ein gegenwärtiges Phänomen darstellt?
Um die Wohnungslosigkeit untersuchen zu können, wird die Theorie des sozialen Raumes des Soziologen Pierre Bourdieu in Kombination mit qualitativen und quantitativen Erhebungen herangezogen. Bourdieu hat einen Raum entwickelt, in welchem Personengruppen anhand ihrer durch Lebensbedingungen generierenden Kapitalsorten und daraus resultierenden Machtpotentiale zu analysieren und einzuordnen sind. Einzelne Studien zum Phänomen der Wohnungslosigkeit, unter anderem des BAG W, sollen eine Einordnung der wohnungslosen Personen anhand ihrer Kapitalsorten im Sozialen Raum ermöglichen. Hierbei soll untersucht werden, welche Kapitalsorte für den Verlust des Wohnraumes entscheidend gewesen ist.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
1. Einleitung und Fragestellung
2. Wohnungslosigkeit
2.1 Definition der Wohnungslosigkeit
2.2 Geschichte der Wohnungslosigkeit
2.3 Wohnungslosigkeit und die Soziologie
2.4 Dynamik der Wohnungslosigkeit
3. Theorie des sozialen Raumes
3.1 Verfügbarkeit von Kapitalsorten
3.2 Habitus
3.3 Macht-und Positionskämpfe im Feld
4. Methodik
4.1 Grundgesamtheit und Stichprobe
4.2 Auswahlkriterien für die Studien
4.3 Auswertungsmethode
4.4 Qualitative Studien
4.5 Quantitative Studien
5. Analyse der Wohnungslosigkeit im Sozialen Raum
5.1 Qualitative Studien
5.2 Quantitative Studien
6. Ergebnisse und Diskussion
7. Fazit
7.1 Theoretisches Fazit
7.2 Methodisches Fazit
7.3 Implikationen für die Praxis
8. Literaturverzeichnis
Abstract
Der vorliegende Bericht bildet die Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften an der Leibniz Universität Hannover. Diese stellt eine Analyse der Wohnungslosigkeit in Deutschland anhand der Theorie des Sozialen Raumes des Soziologen Pierre Bourdieu dar. Die Theorie des Sozialen Raumes ermöglicht es, Gesellschaftsgruppen anhand ihres Vermögen an Kapitalsorten innerhalb eines Koordinatenkreuzes zu positionieren. Ein großer Besitzanteil an den Kapitalsorten des ökonomischen und kulturellen Kapitals verschafft eine Positionierung im oberen Abschnitt. Ein geringer Besitzanteil positioniert die Gruppen hingegen im unteren Abschnitt. Für die Analyse wurden qualitative, sowie quantitative Studien herangezogen, welche die wissenschaftlichen Kriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen. Das Ziel der Untersuchung, die Analyse der Wohnungslosigkeit im Sozialen Raum, konnte aufgrund des wertvollen und repräsentativen Datenmaterials erreicht werden.
Abstract
This report forms the final thesis in the Bachelor's degree in Social Sciences at Leibniz Universität Hannover. It presents an analysis of homelessness in Germany based on the theory of Social Space by the sociologist Pierre Bourdieu. The theory of Social Space enables social groups to be positioned on the basis of their wealth at capital types within a coordinate system. A large share of ownership in the types of capital of economic and cultural capital provides positioning in the upper section. A Small share of ownership, however, positions the groups in the lower section. Qualitative and quantitative studies were used for the analysis, which fulfill the scientific criteria of objectivity, reliability and validity. The aim of the investigation, the analysis of homelessness in Social Space, could be achieved based on the valuable and representative data.
1. Einleitung und Fragestellung
Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. sind seit dem Fall der Mauer im Jahre 1989 mindestens 547 wohnungslose Personen Opfer von Körperverletzungen geworden, davon 409 Menschen mit Todesfolge und mindestens 278 erlitten ihren Erfrierungen. Trotzdem werden sie in pseudowissenschaftlichen Artikeln von Boulevard-Zeitungen oder privatisierten Mediensendern als Gauner des Sozialstaats, als Menschen, die keiner vermisst, die keine Verantwortung für ihre Kinder übernehmen, arbeitsfaul sind und die alleinige Schuld an ihrer Lebenslage zu tragen haben, bezeichnet (vgl. Kipp 2013: 14f.).
Trotz des im Art. 25, Abs. 1, Satz 1 von der UNO am 10.12.1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte deklarierte Menschenrecht auf eine Wohnung, lebt dieser Personenkreis in einer solch extremen Armut, dass selbst der Wohnraum verloren geht und sie damit verbunden fortlaufend keinen wirklichen Rückzugsort besitzen (vgl. Anhorn/ Balzereit 2016: 805).
Wenn ein minimaler Lebensstandard deutlich unterschritten wird und die Betroffenen nicht bereit oder nicht in der Lage sind, durch eigene Kraft aus dieser Lebenslage heraus zu gelangen bzw. das bereitstehende soziale Hilfesystem in Anspruch zu nehmen, dann spricht man von extremer Armut (vgl. ebd.: 17).
Gesellschafts-theoretisch betrachtet, bildet die Wohnungslosigkeit ein systematisch und lebensweltlich bedingtes Phänomen mit ökonomisch, politisch-administrativ und sozio-kulturellen Ursachen (vgl. Häußermann 1998: 281).
Nach außen hin werden zumeist nur die Mietschulden als Grund für die Wohnungslosigkeit sichtbar, dabei sind es zum einen die Auswirkungen von Armut und Arbeitslosigkeit in Zusammenhang mit den stetig steigenden Preisen am Wohnungsmarkt. Zum anderen sind es unverschuldete Notlagen, hierzu können Krankheiten sowie familiäre Ereignisse wie eine Scheidung oder Trennung zählen. Diese können einen entscheidenden Anteil an dem Verlieren des Wohnraumes tragen (vgl. Geißler 2006: 211).
Von dieser Not des fehlenden Wohnraumes sind zum Teil dieselben Gruppen betroffenen Personen, die als Risikogruppen für die Einkommensarmut zählen. Dies sind insbesondere kinderreiche Familien, alleinerziehende Mütter sowie alleinlebende Männer, welche beinahe 90% der alleinstehenden Wohnungslosen ausmachen (vgl. ebd.).
Hinzu kommt, dass das Auftreten von längeren Perioden der Armut bei Personen ohne Ausbildungsabschluss im Vergleich mit Abiturienten und vor allem Akademikern sich so extrem unterscheidet, dass beinahe kein Vergleich stattfinden kann (vgl. ebd.: 216).
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. ist eine bundesweite Gemeinschaft der sozialen Dienste und Einrichtungen für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Sie leisten Koordinations-und Integrationsaufgaben für die Wohnungslosenhilfe und vertritt die Interessen der sozial ausgrenzten und wohnungslosen Personen der Gesellschaft (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2001: 5). Sie hat für das Jahr 2017 eine erschreckende Schätzung der Jahresgesamtzahl über 650.000 wohnungslose Personen in Deutschland veröffentlicht. Zwar ist die Schätzzahl um 24,5% niedriger, als die für das Jahr 2016, dennoch ist die Zahl so alarmierend, dass untersucht werden soll, weshalb in einem führenden Industrieland wie Deutschland, welches ein hohes Bruttoinlandsprodukt innehält, Personen keinen ernsthaften Wohnraum vorweisen können (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2019: 1).
Das Unverständnis wird größer, wenn bedacht wird, dass Notleidende, wie erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige wohnungslose Personen, Anspruch auf eine Hilfegewährung und Betreuung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß dem Sozialgesetzbuch II bzw. nicht erwerbsfähige gemäß dem Sozialgesetzbuch XII besitzen. Im Vordergrund stehen hierbei Hilfen zur Anmietung einer Wohnung, also das Fundament für ein sozial anerkanntes Leben (vgl. Kipp 2013: 17).
Weshalb befindet sich die Schätzung des BAG W also im hohen sechsstelligen Bereich, obwohl diesen Personengruppen die Hilfeleistungen theoretisch zustehen und sie dem gesellschaftlichen Verständnis nach, nicht auf der Straße leben müssten. Welchen Maßnahmen bedarf es, um Risikogruppen vor der Wohnungslosigkeit zu wahren? Welche Arten von politischen Implikationen können der Gesellschaft dabei helfen, potenzielle Wohnungslose frühzeitig, noch vor dem Verlust des Wohnraumes, zu erkennen und zu schützen? Welche Ressourcen auf politischer, sozialer und ökonomischer Ebene müssen verlagert werden, damit Wohnungslosigkeit nicht länger ein gegenwärtiges Phänomen darstellt?
Um die Wohnungslosigkeit untersuchen zu können, wird die Theorie des sozialen Raumes des Soziologen Pierre Bourdieu in Kombination mit qualitativen und quantitativen Erhebungen herangezogen. Bourdieu hat einen Raum entwickelt, in welchem Personengruppen anhand ihrer durch Lebensbedingungen generierenden Kapitalsorten und daraus resultierenden Machtpotentiale zu analysieren und einzuordnen sind.
Einzelne Studien zum Phänomen der Wohnungslosigkeit, unter anderem des BAG W, sollen eine Einordnung der wohnungslosen Personen anhand ihrer Kapitalsorten im Sozialen Raum ermöglichen. Hierbei soll untersucht werden, welche Kapitalsorte für den Verlust des Wohnraumes entscheidend gewesen ist.
Welches Kapital besaß zu diesem Zeitpunkt eine solch große Dominanz im Leben des Individuums, dass ihre Identität, die einer wohnungslosen Person wurde. Gleichzeitig soll analysiert werden, wie stark die Dynamik im Sozialen Raum ist. Welche Kapitalsorten begünstigen diese Dynamik und befördern ein Individuum am ehesten aus der Wohnungslosigkeit heraus? Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen wertvolle Hinweise liefern, weshalb so eine große Differenz zwischen den Worten der Sozialgesetzbücher und der Realität, der Schätzung des BAG W, besteht.
2. Wohnungslosigkeit
Hartnäckige Vorurteile werden immer wieder ausgesprochen, wenn die Wohnungslosigkeit in Deutschland thematisiert wird. Die betroffenen Personen tragen selbst die Schuld an der derzeitigen Situation. Charaktereigenschaften wie Faulheit und Wohnunfähig werden auf die Gesamtheit übertragen und das obwohl wissenschaftliche Studien belegen, dass die Wohnungslosigkeit ihre Ursachen in den wenigsten Fällen in individuellem Fehlverhalten findet (vgl. Werner 1999.: 710). Der Verlust des Wohnraumes ist nicht die Ursache, sondern das Ende eines langwierigen Prozesses.
2.1 Definition der Wohnungslosigkeit
Der Typus einer wohnungslosen Person entspricht unter anderem einem/einer Heim- oder Haftentlassen*in sowie Personen oder Familien, die keiner Kommune auf Regional-oder Bundesebene zuzuordnen sind, ihren Aufenthalt regelmäßig wechseln und keine offizielle Meldeadresse besitzen (vgl. Kipp 2013: 21).
Diese Personenkreise sind nicht in der Lage, selbstständig und unabhängig eine Wohnung zu finanzieren. Es ist jedoch nicht gesagt, dass Personen ohne festen Wohnsitz auf der Straße nächtigen. Dazu bedarf einer strikten Kategorisierung von Wohnungslosen. Erstere Kategorie haust episodisch bei Verwandten, Freunden oder Bekannten. Das heißt, es ist diesem Personenkreis nicht direkt anzusehen, dass sie als Wohnungslose zu bezeichnen sind. Sie leben als „verdeckte“ Personen ohne Wohnraum, die selten von amtlichen Statistiken über Wohnungslosigkeit erfasst werden.
Deshalb würde die von der BAG W geschätzte Zahl durch Einbezug der Dunkelziffer deutlich höher sein. Zweite Kategorie bilden die Personen ohne Wohnraum, die dauerhaft im Freien nächtigen.
Sie leben zumeist in Parks oder auf der Straße, in nicht behausten Wohnungen oder an weiteren öffentlichen Zugängen (vgl. Geißler 2006: 210).
Beide Kategorien erfüllen in der Regel die für Hilfen im Sinne der §§ 67 ff SGB XII geforderten „besonderen sozialen Schwierigkeiten“ (vgl. Kipp 2013: 22).
2.2 Geschichte der Wohnungslosigkeit
In Zeiten des Mittelalters wurden Notleidende und hilfsbedürftige Personen in überwiegenden Fällen von Kirchen, Klöstern und Spitälern versorgt. Ihre Definition fanden diese Personen im
Begriff des „Bettelmönchs“ (vgl. Werner 1999: 705).
Diese Versorgung war jedoch von einer besonderen Zusicherung abhängig. Es musste ein Wille zur Arbeit bestehen, wenn sie nicht alt, gebrechlich oder verwaist waren. In diesen Fällen erhielten sie Almosen und bei Bedarf Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung. Wenn sich jedoch herauskristallisierte, dass die Personen Scheu der Arbeit waren, dann führte dies zum Entzug von Almosen (vgl. ebd.). Die Stadt Hamburg mit ihren unverhältnismäßig steigenden Preisen für den Quadratmeter Wohnraum wird nicht nur im heutigen Kontext bei Diskussionen über Wohnungslosigkeit häufig genannt, auch historisch ist sie eine wichtige Institution.
Am Ende des 18. Jahrhunderts sind Reformen der städtischen Armenpflege in Kraft getreten, welche die Arbeitsverpflichtung sowie weitere Aufgaben des städtischen Bürgertums beinhaltete. Zu diesen Städten zählten unter anderem Hamburg, die ihre Reform im Jahre 1788 umsetzte (vgl. ebd.). Im Jahre 1875 wurde das Heimatrecht, wonach die Armen Unterstützung nur an ihrem Geburtsort erhielten, durch das „Unterstützungswohnsitzgesetz“ abgelöst, ausgelöst durch die einsetzende Wanderungsbewegung. Die Industrialisierung führte dazu, dass große Teile der Landbevölkerung in die Städte zogen (vgl. ebd.).
Enormen Anteil am Wandel der Armut in den Kommunen hält der erste Weltkrieg.
Neue Schichten der Bevölkerungen sowie Kriegsbeschädigte und die Hinterbliebenen
waren plötzlich von der Armut betroffen. Hinzu kam die Weltwirtschaftskrise, welche für eine Massenarbeitslosigkeit sorgte (vgl. ebd.).
Das unzureichende Einkommen und der progressive Anstieg der Mietpreise, gerade in den Stadtgebieten, führte zu einem Anstieg der Wohnungslosen. Um die Gesellschaft vor öffentlichen Ärgernissen zu bewahren, sperrten Institutionen wie die Kirche und die Polizei, später auch Wohlfahrtsträger, die Stadtstreicher und Bettler in Zucht-und Arbeitshäuser, in welchen diesen bürgerliche Normen und Werte eingetrichtert wurden (vgl. Häußermann 1998: 283).
Der zweite Weltkrieg kennzeichnete sich durch eine bis dato unvorstellbare Grausamkeit.
Ab dem Jahre 1933 wurden Personen, die der Definition eines Obdach-oder Wohnungslosen entsprachen, in Konzentrationslager verfrachtet. Diese Behauptung lässt sich durch das Buch des SS-Führers Seidler "Der nichtseßhafte Mensch“ belegen. Dieser deklarierte die Personen ohne Wohnraum als vernichtungswürdige Spezies (vgl. ebd.: 284).
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges bis in die 1950er Jahre bestimmte die Wohnungsnot das gesellschaftliche Bild. Viele Menschen befanden sich auf der Flucht oder standen vor ihren durch Bomben zerstörten Häusern (ebd.).
In den Stadtgebieten des Ruhrgebiets wurden in Zeiten nach dem Krieg moderne Produktionstechniken angewandt, welche innerhalb kurzer Zeit zu einem wirtschaftlichen Wachstum führten und der damaligen Arbeitslosigkeit entgegenwirkten. Nach gezielten Anwerbungen konnte die entsprechende Anzahl an gewünschten Arbeitskräften generiert werden. Der damalige Arbeitgeber fühlte sich jedoch nicht dazu verpflichtet, notwendigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Auswirkungen waren verheerend. Die große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum führte zu einem enormen Anstieg der Mietpreise. Dies brachte hervor, dass die neugewonnen Arbeitnehmer in unbewohnbaren Bausubstanzen oder überbelegten Wohnungen mit anderen Notleidenden hausen mussten (vgl. ebd.: 283).
Die Wohnungslosigkeit wurde in den 60er und 70er Jahren durch staatliche Programme zur Wohnraumversorgung bestimmt, wodurch die Betroffnen weitgehend in wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen verschwanden (ebd.). Der Fall der Mauer und die daraus resultierende Ost-West-Wanderung sorgte für eine Zuspitzung auf dem Wohnungsmarkt. Die offenen Grenzen sorgten dafür, dass besonders im Osten viele Betriebe schließen und Arbeitnehmer entlassen mussten. Dies führte zu einem erheblichen Anstieg der Wohnungslosen, welches im Jahre 1996 ihren Zenit fand (vgl. Geißler 2006: 210f.).
In der Sozialstruktur der DDR spielte die Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit keine nennenswerte Rolle. Das in der Verfassung festgehaltene Recht auf Arbeit bzw. Pflicht zur Arbeit verhinderte in den 40 Jahren der Existenz eine wirkliche Arbeitslosigkeit und folglich Wohnungslosigkeit. Das Recht auf Arbeit führte jedoch zu einer Überbesetzung von Arbeitskräften in Produktionsprozessen, wodurch ökonomisches Kapital erheblich verschwendet wurde (vgl. ebd.: 221). Darüber hinaus waren es die sehr geringen Mietpreise, bedingt durch die hohen Subventionen, die der Bevölkerung den Wohnraum sicherte.
Im Gegensatz zu Westdeutschland führte Armut in der DDR somit nicht zur Wohnungslosigkeit. Diese Wohnungspolitik hatte eine negative Folge. Die geringen Mieten verhinderten Modernisierungen und eine Erhaltung der Bausubstanzen durch die Privateigentümer (ebd.). Bis in die 90er Jahre gingen die meisten Einrichtungen für sogenannte „Nichtsesshafte“ unreflektiert davon aus, dass die Wohnungslosen eine homogene Gruppe darstellten, mit ganz bestimmten, ihnen innewohnenden Merkmalen, nämlich dem nichtsesshaft sein.
Die Einsicht erfolgte Jahre später. Die reine Nichtsesshaftenhilfe entwickelte sich zu einer Wohnungslosenhilfe, die ihren Fokus nicht mehr auf bis dato vorgebliche Eigenschaften der betroffenen Personen, sondern auf den Kampf gegen spezifische gesellschaftliche Unterversorgungstatbestände richtete (vgl. Anhorn/ Balzereit 2016: 826).
Heinrich Holtmannspötter, langjähriger Geschäftsführender der heutigen BAG W sorgte für den Strukturwandel der Bundesarbeitsgemeinschaft Nichtsessenhaftenhilfe zur Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., welches er selbst als einen essenziellen Paradigmenwechsel bezeichnete (ebd.).
Der Wandel von einer gelenkten Planwirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft, welche einen Abbau der Mietsubventionen und einen Anstieg der Privatisierung von Wohnraum innehält, führte dazu, dass jegliche Sicherheit für betroffene Personen verloren gingen.
Eine Gesellschaft, die über vier Jahrzehnte in einem vormundschaftlichen System kreiste, wird innerhalb eines kurzen Zeitraums unvorbereitet dem Kapitalismus überlassen. Die Folgen sind anhand erschreckender Zahlen bis heute ersichtlich.
2.3 Wohnungslosigkeit und die Soziologie
Der Besitz eines Wohnraumes definiert sich nicht nur über eine materielle Basis aus Wärme, Schutz und Geborgenheit, sondern schafft auch die essenzielle Voraussetzung für das Privat-und Berufsleben. Hinzu kommt die Ermöglichung der regelmäßigen Körperpflege, Zugang zu bestimmten Formen der Kommunikation (unter anderem der Postzustellung) sowie den Mindestanforderungen für soziale Anerkennung (vgl. Geißler 2006: 212). Eine länger-oder mittelfristige Lebensplanung ist ohne nennenswerten Wohnraum unmöglich. Alle Besitzeigentümer müssen dauerhaft mit sich getragen werden, eine Vorratshaltung ist zumeist undenkbar.
Die permanent erzwungene Öffentlichkeit ihres Lebens mit der ständigen Kontrolle durch Passanten und Institutionen wie dem Ordnungsamt und der Polizei sorgen für kaum realisierbare Zugriffs-und Kontrollmöglichkeiten auf das eigene Leben (vgl. Anhorn/ Balzereit 2016: 804). Hinzu kommt, dass die erkennbare Wohnungslosigkeit und das daraus resultierende Leben eine Ordnungswidrigkeit darstellt.
Sozial-Kulturell lässt sich die Wohnungslosigkeit folgend begründen. Faktoren wie Migration, demographische Entwicklungen (unter anderem die Zunahme von Scheidungen und steigender Lebenserwartung), sowie die Mietzahlungsunfähigkeit durch Krankheit und mangelnder sozialer Sicherung führen zum Phänomen der Wohnungslosigkeit (vgl. Häußermann 1998: 281).
Zumeist entsteht somit eine Verbindung von sozial strukturellen Ursachen wie Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit mit individuellen Lebensumständen. Unzureichende Mittel in vielen Lebensbereichen, vor allem von sozialer Benachteiligung und Isolation betroffen, besitzen die Personen ohne Wohnraum darüber hinaus nur eingeschränkte Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen wie Bildung und Kultur und sind weit entfernt von politischem Input und daraus resultierendem Interessenaustausch (vgl. Kipp 2013: 22f.).
Gerade in Ballungszentren nimmt die soziale Integration und gesellschaftliche Solidarität enorm ab. Reiche Stadtteile grenzen sich bewusst von den deutlich ärmeren ab, die Finanzierung der schwachen Regionen und ihrer Bevölkerung wird zunehmend schwieriger (vgl. Werner 1999: 707).
Die Erschöpfungen der Rentenkassen führen dazu, dass gerade Personen im Renteneintrittsalter entweder weiter auf die Erwerbsarbeit angewiesen sind oder nach Jahrzehnten der Investition in die entsprechenden Kassen in den Existenzminimum rutschen. Somit verschafft die Einzahlung keine Absicherung vor der drohenden Wohnungslosigkeit in den Jahren nach der Erwerbsfähigkeit.
2.4 Dynamik der Wohnungslosigkeit
Die Dynamik bildet einen Prozess der Verschiebung im sozialen Raum. Die Personen ohne Wohnraum waren in der Regel nicht immer wohnungslos und die wenigsten besitzen die Absicht fortwährend ohne zu bleiben.
In Nordrhein-Westfalen gelang es mehr als ein Drittel der Menschen, die zwischen 1997 und 1999 in kommunalen Notunterkünften aufgenommen wurden, diese Unterkünfte innerhalb eines halben Jahres wieder zu verlassen und in eine eigene Mietwohnung zu ziehen.
Eine weitere Fallstudie zeigt auf, dass die Metapher von der Achterbahn des Lebenslaufs besonders für Personen ohne Wohnraum gilt: Von 143 obdach- oder wohnungslosen Frauen, die in Einrichtungen für Wohnungslose in Bielefeld Hilfe suchten, hatten bereits mehr als die Hälfte wiederholt ihre Wohnung verloren. Eine neuere Studie, die auf Stichproben aus den Jahren 1998 und 2002 baut, liefert Erkenntnisse darüber, dass sich im Laufe der 1990er Jahre die Dauer der Notlage reduziert hat. Demnach verfügten mehr als die Hälfte (52 %) der wohnungslosen Personen bereits nach einem halben Jahr wieder über eine eigene Wohnung, ein weiterer Zehntel nach einem Jahr. Ein Fünftel war mindestens drei Jahre wohnungslos und ein harter Kern von
17 % mehr als fünf Jahre (vgl. Geißler 2006: 215).
Die Wohnungslosigkeit mit ihren Facetten, ihrer Definition, ihrem historischer Kontext, ihrer Verbindung zur Soziologie und ihrer Dynamik wurde umfassend erläutert und dabei wurde bereits aufgezeigt, welche Dringlichkeit die Erforschung des gesellschaftlichen Phänomens besitzt. Im weiteren Verlauf wird die Theorie des sozialen Raumes von Pierre Bourdieu vorgestellt.
3. Theorie des sozialen Raumes
Pierre Bourdieu’s Ansätze und Perspektiven über die Reproduktion bestimmter sozialer Räume und Ordnungen, wirft die Frage auf, inwiefern individuelle sowie kollektive Raumdeutungen als Prozess der Erschließung von unterschiedlichen Bedeutungen für Wohnungslose von Wichtigkeit sein können, da deren soziale Praktiken entscheidend durch das Fehlen eines privaten Wohnraumes und durch das Leben in öffentlichen und halböffentlichen Raum sowie der Straße bestimmt werden (vgl. Kipp 2013: 76).
Die Erzeugungsbedingungen des Habitus, das heißt die grundlegenden Lebensbedingungen und die damit verbundenen Anpassungsprozesse konformer Einheiten sind zusammenzufassen durch die Schaffung eines Raums mit folgenden drei Grunddimensionen: Kapitalvolumen, Kapitalstruktur und zeitliche Entwicklung dieser beiden Größen (vgl. Bourdieu 1987: 195f.). Ersteres bildet das Gesamtvolumen des Kapitals, welches sich in das ökonomische, kulturelle und soziale Kapital unterteilt.
Die Abgrenzung der einzelnen Klassen und Schichten ergibt sich aus der unterschiedlichen Verteilung der einzelnen Kapitalsorten.
Veranschaulicht wird diese Abgrenzung und Verteilung anhand eines Koordinatensystems, dem Raum der Positionen (X-Achse: Kapitalart, Y-Achse: Kapitalvolumen). Die vertikale Achse differenziert nach dem Kapitalvolumen, die horizontale Achse unterscheidet in der Kapitalart. Die Personengruppen, die in diesem Koordinatensystem weit unten positioniert sind, besitzen ein geringes ökonomisches und kulturelles Kapital. Umgekehrt besitzen die höher positionierten Gruppierungen ein hohes Volumen des jeweiligen Kapitals. Den Kern des sozialen Raumes bilden nach Bourdieu die Mittelschicht. Der obere Abschnitt wird unter anderem durch Unternehmer und Lehrende bestimmt. Die Ansiedlung im unteren Bereich wird bspw. durch HilfsarbeiterInnen bestimmt.
Hinzu kommt der Raum der Lebensstile, welcher die Verteilung der Praktiken und Merkmale, welche für den jeweiligen Lebensstil, in dem sich eine jeweilige soziale Lage niederschlägt, fundamental sind (vgl. ebd.: 215). Anhand dem Raum der Positionen lässt sich der Raum der Lebensstile ableiten, da die soziale Position im Raum zumeist den individuellen Lebensstil bestimmt.
Da der soziale Raum in seinen Dimensionen hierarchisch strukturiert ist, das heißt vom maximalen bis zum minimalsten Kapitalvolumen, von der dominanten zur dominierten Sorte des Kapitals sind mehrere Verschiebungen in ihm möglich (vgl. ebd.: 220).
Zum einen sind es Vertikalverlagerungen (bspw. vom Klein- zum Großunternehmer), zum anderen sind es Transversalverlagerungen, die den Übergang von einem Feld zum nächsten implizieren und sowohl auf übereinstimmender horizontaler Ebene, als auch auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen können. Das bedeutet somit, dass sowohl symmetrische als auch asymmetrische Verschiebungen möglich sind (vgl. ebd.).
Der Habitus, eine weitere Theorie von Bourdieu, bildet ein konzeptionelles Bindeglied zwischen dem Raum der Positionen und dem Raum der Lebensstile (vgl. Rudolph 2019: 92).
3.1 Verfügbarkeit von Kapitalsorten
Wie bereits angeführt definieren sich die Individuen unter anderem durch den Besitz von Kapitalsorten. Diese Kapitalsorten können nach Bourdieu alle handlungsrelevanten Ressourcen auf einem Feld sein, welche sich in ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital unterteilen (vgl. Lenger et al. 2013: 21).
3.1.1 ökonomisches Kapital
Das ökonomische Kapital beinhaltet die Verfügung über alle Bereiche materiellen Reichtums, welche wiederum in Finanzen umgewandelt werden können. Dies können Einkommen, Erbschaften oder Immobilien sein. Diese Kapitalsorte dominiert im sozialen Raum, da sich andere Kapitalsorten durch das ökonomische aneignen lassen.
3.1.2 kulturelles Kapital
Bourdieu unterteilt das kulturelle Kapital in drei Kategorien: Diese Kategorien bilden das ‚inkorporierte kulturelle Kapital‘, das ‚objektivierte kulturelle Kapital‘ sowie das ‚institutionalisierte kulturelle Kapital‘.
Das inkorporierte beinhaltet Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen in Form von beständigen Anordnungen, die vor allem durch Sozialisationsinstanzen maßgeblich beeinflusst werden und direkt an die jeweiligen Individuen geknüpft sind. Es kann als einen Zustand der Einstellungs- und Fähigkeitsmuster in Bezug auf die anerkannte legitime Kultur definiert werden (vgl. Bauer 2012: 118). Eine einfache Übertragung dieses kulturellen Kapitals ist nicht möglich, da es an den Habitus des Individuums gebunden ist. Das objektivierte kulturelle Kapital ist die vergegenständlichte Form des Kultur-und Kunstkonsums (unter anderem Güter wie Gemälde und antike Möbel) (vgl. ebd.).
Maßgeblich entscheidend ist die Unabhängigkeit gegenüber dem Individuum und dessen inkorporierten kulturellen Kapitals, somit kann dieses auf andere Individuen übertragen werden. Letzteres kulturelle Kapital bildet das institutionalisierte. Nach Bourdieu wird das Kapital vor allem durch Bildungstitel wie Zeugnisse und Diplome gebildet. Dieses Kapital ist eine Art Beweisführung für den Einsatz von ökonomischen Kapital, zeitlichen Ressourcen und Fähigkeiten.
3.1.3 Soziales Kapital
Das soziale Kapital bezeichnet das Vermögen an instrumentalisierbaren Beziehungen und Kontakte (vgl. Bourdieu 1997: 195). Hierunter fallen unter anderem Kontakte aus Familie, Freunde und Bekanntschaften. Die Wahrung des sozialen Kapitals verlangt eine stetige Investition über Tauschakte der Akteure.
3.2 Habitus
Die Theorie des Habitus von Bourdieu bildet die Verbindung zwischen den spezifischen Regelmäßigkeiten der Praxis von Akteuren über dessen soziale Position und der Sozialisation. Trotz der unzähligen Handlungsoptionen besteht eine gewisse Einheit im Denken, Wahrnehmen und Handeln von Akteuren in vergleichbaren sozialen Positionen. Der Habitus bewirkt, dass die Gesamtheit der Handlungsformen des jeweiligen Akteurs als Produkt der Anwendung identischer Schemata gleichermaßen Charakter tragen und sich von den fundamentalen Handlungsformen eines anderen Lebensstils unterscheiden (vgl. Bourdieu 1987: 278). Dieses Prinzip dient als fundamentale Erklärungshilfe für die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Strukturen und der damit immer wieder auftretenden Reproduktion sozialer Ungleichheiten (vgl. Rudolph 2019: 74).
Er bildet ein Bindeglied zwischen den durch Kapitalsorten strukturierten Raum der Existenzbedingungen und den durch den Habitus bedingten Praxisformen (vgl. ebd.: 92). Zudem ist er eine sich strukturierende Struktur. Es handelt sich dabei nicht um eine bloßes Transferieren der Praxis. Vielmehr besteht eine permanente Wechselwirkung zwischen den Erzeugungs-, Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata (vgl. Barlösius 2004: 131).
Das Konzept des Habitus basiert demnach auf der Hypothese, dass Schemata von Praxis auf Praxis übertragen werden können, ohne den Weg über Bewusstsein und Diskurs zu nehmen (vgl. Bourdieu 1993: 136).
3.3 Macht-und Positionskämpfe im Feld
Eine Vielzahl von autonomen Felder existiert innerhalb der Gesellschaft, welche von den Individuen durch ihre Kapitalsorten und Kapazitäten bestimmt werden. Die jeweilige Dominanz einzelner Kapitalsorten innerhalb eines Feldes sorgt für die Abgrenzung und Unterscheidung des einen Feldes zum Nächsten. Jedes einzelne Feld, das heißt jeder gesellschaftliche Bereich, sei es wirtschaftlich, politisch oder wissenschaftlich sowie religiös oder kulturell, besitzt eine spezifische Logik. Diese Logik beinhaltet bestimmte Interessen und Regeln, die von den jeweiligen Akteuren akzeptiert werden müssen. Der gemeinschaftliche Glaube an diese Logik des Feldes wird als illusio bezeichnet (vgl. Bourdieu 1998: 152f.).
Bis dato finden sich nahezu keine wissenschaftlichen Ausarbeitungen und Analysen zur Wohnungslosigkeit im sozialen Raum. Zumeist sind es, wenn vorhanden, Analysen der gesamten Obdachlosigkeit. Die hierbei einzig nennenswerte wissenschaftliche Arbeit entstammt Martina Adler, veröffentlicht im wissenschaftlichen Journal österreichischer Fachhochschul-Studiengänge Soziale Arbeit. Hierbei untersucht sie, wie die Position von wohnungslosen Frauen im sozialen Raum auf ihre Position im physischen Raum wirkt und wie diese wieder auf ihre Verortung im sozialen Raum wirkt (vgl. https://soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/view/243/367, aufgerufen am 01.01.2019, um 21:24 Uhr).
4. Methodik
In diesem Kapital wird das methodische Vorgehen erläutert. Zunächst wird die Grundgesamtheit und die Stichprobe dargelegt, um den Personenkreis der Beobachtung einzugrenzen. Anschließend werden die Kriterien zur Auswahl der relevanten Studien beschrieben. Hierbei wird auf die wissenschaftlichen Merkmale der Studien hingewiesen, die es zu erfüllen gilt, um unter anderem eine Repräsentativität zu gewährleisten. Des weiteren findet eine Nennung und Erläuterung der Auswertungsmethode statt. Abschließend werden die einzelnen Studien, qualitativ und quantitativ, vorgestellt und zudem anhand erster Erkenntnisse begründet, weshalb diese Verwendung in der Analyse finden werden.
4.1 Grundgesamtheit und Stichprobe
Vor der Analyse der Fragestellung ist es von enormer Bedeutung, zu entscheiden, aus welchem Personenkreis die Grundgesamtheit besteht und welche Ausschlusskriterien diese beinhaltet. Die Grundgesamtheit ist die Gruppe von Personen, über die konkrete Angaben getroffen werden sollen. Diese bilden in der vorliegenden Arbeit, die in Deutschland lebenden und nach Kapitel 2.1 definierten Wohnungslosen. Es wird zudem nicht nach Alter, Nation oder Geschlecht selektiert, da die Anzahl an wertvollen Daten zum allgemeinen Kapitalbegriff überschaubar ist. In der späteren Analyse werden Vergleiche zwischen den demographischen Daten stattfinden, da hierbei unter anderem zu vermuten ist, dass die traditionelle Unterwerfung der Frau gegenüber dem Mann eine voraussichtliche Auswirkung auf den Verlust des Wohnraumes besitzt. Selbstverständlich können nicht alle in Deutschland lebenden Wohnungslosen, sprich die Grundgesamtheit, befragt werden. Für diese steht die Stichprobe oder auch Auswahlgesamtheit repräsentativ. Der Zweck der Repräsentativität kann erfüllt werden, wenn die Ergebnisse dieser Untersuchung von einer kleinen Stichprobe oder Gruppierung auf die Gesamtheit, d.h. dem Personenkreis nach Kapitel 2.1, übertragbar werden kann.
4.2 Auswahlkriterien für die Studien
In diesem Kapitel werden die Kriterien für die Auswahl relevanter Studien vorgestellt. Wird sich auf Daten aus nationalem Bereich, in diesem Fall Deutschland, beschränkt oder findet ein Ländervergleich statt? Wie erfolgt die Selektion einzelner, für die Fragestellung relevanter Studien? Welche wissenschaftlichen Kriterien müssen diese erfüllen, um im Phänomen der Wohnungslosigkeit repräsentativ zu sein?
Im weiteren Verlauf werden hierzu die relevanten Studien, qualitativ und quantitativ, mit ersten sichtbaren Erkenntnissen über die jeweilige Dominanz der Kapitalsorte vorgestellt.
Da die Grundgesamtheit aller in Deutschland Wohnungslosen entspricht, sind nur Studien interessant, dessen Erhebungen innerhalb Deutschlands erfolgten. Bis dato ist ein Ländervergleich der Wohnungslosigkeit nicht Bestandteil dieser Facharbeit. Es ist es unabdingbar, dass die quantitativen Studien repräsentativ sind. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, wenn sie von offiziellen Institutionen, wie dem BAG W, betreut bzw. durchgeführt wurden. Spezifische Facharbeiten sind auch relevant, wenn sie die erforderlichen wissenschaftlichen Aspekte wie Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen.
4.3 Auswertungsmethode
Für die Auswertung werden unterschiedliche Kategorien gebildet. Zunächst wird in die unterschiedlichen Kapitalsorten, d.h. ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital, unterteilt. Die Kategorisierung erfolgt deduktiv anhand den herangezogenen qualitativen und quantitativen Studien. Die Kategorien dieser Arbeit werden somit durch die jeweiligen Studien deduziert. Nach dieser Kategorisierung werden die unterschiedlichen Studien betrachtet und analysiert welche Kapitalsorte im Einzelfall für den Verlust des Wohnraumes entscheidend war. Nach der Analyse der Kapitalsorte wird, wenn das Datenmaterial der einzelnen Studien es ermöglicht, untersucht, welche Auswirkung der Habitus auf die Wohnungslosen nimmt und wie die Macht-und Positionskämpfe im Feld sind bzw. waren.
4.4 Qualitative Studien
Mehrere Feldaufenthalte in Bereichen der Wohnungslosigkeit konnten wertvolle Interviewpassagen generieren, die Aufschluss über die Lebensverläufe und dem Vermögen an Kapitalsorten der betroffenen Personen geben.
Ein entsprechendes Datenmaterial liefert die Ausarbeitung von Larissa Von Paulgerg-Muschiol.
In ihrer Dissertation untersucht sie unter anderem den Lebenslauf der wohnungslosen Personen.
Hierfür interviewte sie etwa 30 wohnungslose Männer aus München, bei welchem sie sich methodisch an den Stilvorgaben der Grounded Theorie von Anselm Strauss orientierte (vgl. von Paulgerg-Muschiol 2009: 4).
Interessant und für die Fragestellung signifikant ist hierbei, dass die Interviewten zumeist einen „normalen“ Lebensverlauf bestritten haben.
Ihre Karrieren sind durch sogenannte „normale“ Lebensphasen mit erlernten Berufen und dem Aufbau einer statthaften Existenz mit Heirat und der Gründung einer Familie gekennzeichnet.
Sie haben sich in der Vergangenheit an einem großen Willen zur Arbeit orientiert und in mehreren Fällen berufliche Aufstiege erlebt. Der spätere Verlust der Behausung war nicht zu erwarten und zumeist durch einen einschneidenden Schicksalsschlag ausgelöst (vgl. ebd.: 102).
Bei der Analyse der Wohnungslosigkeit im Sozialen Raum anhand der Dissertation von Paulgerg-Muschiol ist zu bedenken, dass das Datenmaterial nicht repräsentativ für die Wohnungslosen in Deutschland stehen kann. Die geringe Anzahl an interviewten Personen, die homogene Altersstruktur sowie die Begrenzung auf den Großraum München stehen einer Übertragung auf die Grundgesamtheit entgegen. Für die Abschlussarbeit verwendbare Ergebnisse, die anhand der Dissertation herbeigeführt werden, sind daher nur unter Vorbehalt zu betrachten.
4.5 Quantitative Studien
Die Analyse erfolgt nicht ausschließlich anhand eines qualitativen Datenmaterials. Um eine zusätzliche Betrachtungsweise auf die Dominanz der Kapitalsorten und eine Repräsentativität zu ermöglichen, werden quantitativen Studien herangezogen. Hierunter fällt eine Studie der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin) in Kooperation mit dem Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe (EBET e.V.), welche die 1. systematische Untersuchung der Lebenslagen wohnungsloser Menschen bildet. Sie ist repräsentativ für alle akut wohnungslosen Erwachsenen, die die diakonischen Hilfen in Anspruch nehmen.
Darüber hinaus entstammt ein großer Teil des quantitativen Datenmaterials dem BAG W. Diese veröffentlichte seit 2003 nahezu jährlich einen ausführlichen Statistikbericht zur Wohnungslosigkeit in Deutschland. Die BAG W besitzt nicht nur das größte Repertoire an quantitativen Erhebungen, sondern wird zudem in verschiedensten Werken eingebunden. In diesen Werken finden fast ausschließlich die Daten des BAGW Verwendung, selbst in weiteren quantitativen Studien werden die Erhebungen des BAGW als Maßstab definiert. Ein Beispiel dafür ist das Werk „>>Alltagswelten<< obdachloser Frauen“ von Almut Kipp, in welcher die Studien des BAG W als Datengrundlage herangezogen werden.
5. Analyse der Wohnungslosigkeit im Sozialen Raum
In diesem Kapital findet eine intensive Analyse der Fragestellung anhand einer Auswahl an qualitativen und quantitativen Studien zur Wohnungslosigkeit statt. Hierfür wird zunächst die qualitative Studie, die Dissertation von Paulgerg-Muschiol, herangezogen. Im direkten Anschluss werden die quantitativen Studien, die Studie ASH Berlin in Kooperation mit EBET e.V. sowie mehrere Statistikberichte des BAG W, betrachtet und analysiert.
5.1 Qualitative Studien
5.1.2 Eine qualitative Untersuchung von Larissa von Paulgerg-Muschiol
Larissa von Paulgerg-Muschiol führte als Grund für ihre Untersuchung innerhalb ihrer Dissertation an, dass Wohnungslosigkeit nicht statistisch und losgelöst von Lebensverläufen, welche durch Individuen und gesellschaftlichen Institutionen bedingt werden, untersucht werden konnte. Viel mehr müssten die Lebensverläufe von späteren wohnungslosen Personen unter dem Aspekt der subjektiven Auslöser für die Wohnungslosigkeit betrachtet werden. Zumeist waren die Karrieren durch bürgerliche Lebensphasen mit schulischen und beruflichen Abschlüssen sowie der Gründung einer Familie gekennzeichnet. Es war bis dato nicht ersichtlich, dass die betroffenen Personen irgendwann wohnungslos werden würden, da sie stets bemüht waren, ihre Erwerbstätigkeit und die Versorgung ihrer Familie aufrecht zu erhalten (vgl. Von Paulgerg-Muschiol 2009: 101f.).
Die Ergebnisse dieser Untersuchung bezogen sich auf die Auswertung von, teilweise wiederholten, Interviews mit über 30 wohnungslosen Männern aus München. Die Dissertation verwendete als Datengrundlage ein qualitatives Forschungsprojekt zur Bedeutung von Kriminalisierung für die Karrieren von wohnungslosen Männern (vgl. ebd.: 4). Methodisch basierte sie auf der Grounded Theory von Anselm Strauss. Diese ermöglicht ein Verständnis von Problemlagen, prekären und wenig vertrauten Untersuchungsobjekten.
Sie bietet in diesem Fall ein geeignetes Analysenstilmittel, um eine Vielzahl von Konzepten einschließlich ihrer Bezüge untereinander erarbeiten zu können (vgl. ebd.: 82).
Mit den betroffenen Personen wurden nach einem narrativen Einstieg Leitfaden-Interviews geführt, in welchen sie selbst ihre Karrieren in der Retrospektive einschätzten und ihre persönlichen Schlüsselstellen hervorbrachten (vgl. ebd.: 94).
Exemplarisch für die Lebensverläufe der Betroffenen werden in dieser Arbeit 3 Interviews der Untersuchung von Paulgerg-Muschiol herangezogen.
Hierbei werden die einzelnen Personen kurz vorgestellt, ihre Herkunft, Bildung, Familiengründung und ehemalige Erwerbstätigkeit analysiert und versucht zu ergründen, welche Kapitalsorte für die Wohnungslosigkeit entscheidend war.
5.1.2.1 Interview Erich B.
Das erste Datenmaterial entstammt dem Interview mit Erich B. Zum Zeitpunkt des Interviews ist er ca. 60 Jahre alt, wurde in Rheinland- Pfalz geboren und ist auf einem Bauernhof aufgewachsen (vgl. ebd.: 103).
Kulturell betrachtet war er schon in jungen Jahren sehr bewandert. Klassenbester in der Volksschule, wodurch er eine Empfehlung für das Gymnasium erhielt.
Da seine Familie wenig Geld für die Bildungsmaterialien aufbringen konnte und er neben der Schule viel arbeiten musste, sah er sich gezwungen, das Gymnasium zu verlassen. Er wechselte auf eine Handelsschule, welche er mit der mittleren Reife abschließen konnte. Im Anschluss absolvierte eine Lehre als Bankkaufmann und erhielt in wenigen Jahren nach seiner Ausbildung eine Führungsposition in einer großen Baufirma (vgl. ebd.). Das kulturelle Kapital, speziell das institutionalisierte, von Erich B. ist bei Betrachtung des damaligen Kontext überdurchschnittlich hoch. Der überwiegende Teil der damaligen Jugendlichen beendete ihre Schullaufbahn mit der Volksschule und absolvierte eine Ausbildung. Der Abschluss an der Handelsschule und die Erlangung der Führungsposition in der Baufirma zeigen, dass Erich B. ausgesprochen gebildet gewesen war.
Zu dem Zeitpunkt der Beförderung heiratete der Interviewte seine damalige Freundin. Stets betont er, dass eine gute Ehe geführt habe. Völlig unerwartet wurde ihm von seiner Frau, während ihres Urlaubes, die Scheidungsklage zugestellt. Sie hob das gesamte Kapital vom gemeinsamen Bankkonto ab und nahm die Kinder mit sich (vgl. ebd.: 105f.).
In Folge dessen beendete Erich B. sein altes Leben und fuhr ohne Ziel nach München. Von da an war er wohnungslos und nächtigte auf der Straße. Bis zur Scheidung von seiner Frau entsprach seinem Leben einer bürgerlichen Vorstellung (vgl. ebd.: 106).
Er verfügte über ausreichend ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital. Der Einbruch des sozialen Kapitals, durch die Scheidung seiner Frau und dem Verlust der Kinder sorgte für die Kurzschlusshandlung, die letztlich zur Wohnungslosigkeit führte. Zwar könnte das „Leerräumen„ des gemeinsamen Bankkontos eine Auswirkung auf Erich B. gehabt haben, viel mehr vermitteln die einzelnen Interviewpassagen jedoch, dass der Verlust seiner Familie für ihn der entscheidende Faktor gewesen gewesen war.
5.1.2.2 Interview Egon S.
Der nächste Interviewte ist Egon S., welcher im April 1941 zwischen Grafenwöhr und Zollgast in einem Bunker geboren wurde. Zum Erhebungszeitpunkt ist er 56 Jahre alt. Zu seinen schulischen Qualifikationen wird nichts angeführt. Nach seiner Schullaufbahn absolvierte er eine Lehre als Bäcker und Konditor (vgl. ebd.: 107).
Hierbei ist zu vermuten, dass Egon S. über eine niedrigeren Schulabschluss verfügte und das institutionalisierte kulturelle Kapital bis dato nicht sonderlich hoch ausfällt. Im Zuge seiner beruflichen Laufbahn bot sich für ihn die Möglichkeit einen vernachlässigten Betrieb mit zwei Angestellten zu übernehmen. Für die Übernahme absolvierte der Interviewte die Meisterschule, durch welche er seinen Meistertitel erhielt (vgl. ebd.).
Dieser Abschluss bereicherte das institutionalisierte kulturelle Kapital wiederum enorm. In vielen Fällen wird ein Meistertitel mit dem Abitur gleichgesetzt und ermöglicht den Zugang zu Hochschulen und Universitäten.
Der Betrieb von Egon S. beschäftigte schließlich 22 Angestellte und unterlag einer wirtschaftlichen Progression (vgl. ebd.: 108). Somit war nicht nur das kulturelle, sondern auch das ökonomische Kapital des Interviewten entsprechend gestärkt.
Während sein Betrieb große Beträge erwirtschaftete, vernachlässigte er seine Ehe und führte eine Ehekrise herbei. Hinzu kam, dass Egon S. seiner Frau die Liegenschaften überschrieb, aus Sicherheitsgründen, da die Motorradfirma Kreidler Konkurs machte, die wohl zu seinen Kunden zählte (vgl. ebd.: 109). Kurze Zeit später reichte seine Frau die Scheidung ein und die Ehe zerbrach. Der Interviewte war so stark betroffenen Personen, dass er anfing umherzuziehen und ab dann keiner Kommune mehr zugewiesen werden konnte. Nachdem er krank wurde und auch seinen letzten Job bei einer Verleihfirma verlor, befand er sich am Tiefpunkt seiner Lebenskarriere (vgl. ebd.: 110).
Das Interview mit Egon S. ist ein hervorragendes Beispiel, wie entscheidend das soziale Kapital für den Einstieg in die Wohnungslosigkeit sein kann. Der Betroffene verfügte über mehr als ausreichendes ökonomisches und kulturelles Kapital, dennoch führte die Scheidung von seiner Frau dazu, dass die Planlosigkeit sein Leben bestimmte. Zwar schwächte die Übertragung der Liegenschaft sein ökonomisches Kapital, dennoch begann die Wohnungslosigkeit unmittelbar nach dem Einbruch seines sozialen Kapitals, sprich der Scheidungsklage.
5.1.2.3 Interview Horst S.
Der letze Interviewpartner ist Horst S. Als uneheliches Kinder italienischer Gastarbeiter ist der Interviewte im Jahre 1953 in München geboren. Nach der Geburt wurde er zu Pflegeeltern gegeben. Horst S. strebte nach der Absolvierung der Hauptschule das Abitur an, entschied sich dann jedoch für die Lehre als Autolackierer, welche er nach einer Operation aufgeben musste. Nach dem Abbruch einer weiteren Lehre, schlug er sich mit Gelegenheitsarbeiten durch (vgl. ebd.: 115).
Das kulturelle Kapital des Interviewten war unterdurchschnittlich bis mittelmäßig. Die Absolvierung der Hauptschule war für die damalige Zeit üblich und entsprach dem Durchschnittsabschluss. Kritisch ist hierbei zu betrachten, dass Horst B. keine Berufsausbildung vorweisen konnte. In allen Berufsfeldern wird er dadurch als ungelernt betrachtet und wird dementsprechend schlechter entlohnt.
Wiederholte Handgreiflichkeiten zwischen ihm und seinen Stiefvater führten zum Auszug au der elterlichen Wohnung. Er zog mit seiner alten neuen Freundin zusammen, die bereits wieder geschieden war (vgl. ebd.: 118).
Zu dieser Zeit erhielt er vom Arbeitsamt eine finanzielle Unterstützung zur Erlangung seines Abiturs, mit der Auflage, danach eine bestimmte Zeit versicherungsbeitragspflichtig zu arbeiten. Nach der Erlangung des Abiturs arbeitete er über einen Zeitraum von fünf Jahren im Maschinenbau (vgl. ebd.: 118).
Das Abitur und die Erwerbstätigkeit im Maschinenbau führten zu einem enormen Anstieg im ökonomischen und kulturellen Kapital. Besonders der bildungstechnische Aufstieg kann einer Wohnungslosigkeit entgegenwirken, da es grundsätzlich zum Studieren berechtigt, was wiederum nach dem Studium zur Vermehrung des ökonomischen Kapitals, in Form einer besseren Anstellung, führen kann.
Nach über 14 Jahren Beziehung und zwei Fehlgeburten bekamen Horst S. und seine Freundin einen Sohn. Drei Jahre später trennte sich die Mutter seines Kindes von ihm. Nach der Trennung zog er zu seiner Stiefmutter, die zu diesem Zeitpunkt alleinstehend war. Nach dem Tod der Mutter und der Insolvenz seiner Speditionsfirma erhielt Horst S. eine Räumungsklage (vgl. ebd.:120). Die erste Zeit nach dem Verlassen der mütterlichen Wohnung hauste er bei Bekannten. Im Anschluss war er für ein paar Monate in einer Pension untergebracht, in welcher Unstimmigkeiten mit seinen Zimmergenossen zum Verzicht auf das Zimmer in der Pension führten. Von da an verbrachte Horst S. die Nächte im Freien.
Im Lebensverlauf von Horst S. ist nicht direkt ersichtlich, welcher Kapitalmangel zur Wohnungslosigkeit führte. Es kann hierbei jedoch die Behauptung aufgestellt werden, dass das kulturelle Kapital keinen nennenswerten Anteil an der Wohnungslosigkeit des Betroffenen hielt. Es ist eine Kombination aus der Insolvenz seiner Speditionsfirma und der Trennung von seiner Freundin und dem Verlust der Mutter. Hierbei ist nicht zu unterschätzen, dass durch den Tod der Mutter nicht nur der emotionale Rückhalt entfiel, sondern die finanzielle Lebensader durch z. B. die Rente der Mutter abgeschnitten wurde (vgl. ebd.: 160).
Aus seiner Sicht waren die Vermittlungsbehörden des Arbeitsamts an seiner aktuellen Situation schuld. Er war davon überzeugt, dass diese ihm aufgrund seines Alters bewusst keine Stelle vermitteln (vgl. ebd.: 120).
5.2 Quantitative Studien
5.2.1 Studie der ASH Berlin in Kooperation mit EBET e.V.
Nach Angaben der ASH Berlin und EBET e.V. war der Anlass für das Forschungsprojekt, dass vorhandene Daten zur Wohnungslosigkeit in Deutschland nicht repräsentativ waren und besonders die Lebenslagenbereiche der materiellen Situation, Erwerbsarbeit, des Wohnens, der Gesundheit, der Sicherheit, sowie der sozialen Netzwerke miteinander verknüpfte. Die Daten konnten bis dato keine ganzheitliche Betrachtung der Lebenslagen wohnungsloser Menschen, im Sinne von Defizite der Ressourcen ermöglichen (vgl. Gerull 2018: 5).
Für die Untersuchung wurde ein Lebenslagenindex entwickelt, welcher unterschiedliche Indikatoren für die Lebenssituation der wohnungslosen Personen verknüpfte (vgl. ebd.: 6). Einzelnen Merkmalsausprägungen der Indikatoren für die Lebenssituation wurden eine unterschiedliche Anzahl von Punkten zugeordnet. Beispielsweise wurden einem Hochschulabschluss sowie einer Vollerwerbstätigkeit jeweils 6 Punkte zugeordnet, umgekehrt wurden einer Arbeitslosigkeit von mehr als 12 Monaten 0 Punkte zugeordnet. Im Anschluss wurden die addierten Punkte einem Schichtsystem unterschiedlicher Lebenslagen zugewiesen (vgl. ebd.: 8). Für die vorliegende Arbeit sind nur ein paar Lebenslagenbereiche interessant. Unter anderem die materielle Situation, Erwerbsarbeit und die sozialen Netzwerke können wohlmöglich eine Tendenz zur Dominanz der jeweiligen Kapitalsorte der wohnungslosen Personen hervorbringen.
Insgesamt wurden 1135 Fragebögen des Forschungsprojekts ausgewertet (vgl. ebd.: 3). Die teilnehmenden Einrichtungen wurden methodisch nach einem Matching-Verfahren ausgewählt, um eine größtmögliche Repräsentativität zu erreichen. Die Grundgesamtheit bildeten alle wohnungslosen Menschen, die bundesweit in den Einrichtungen der Diakonie betreut wurden (vgl. ebd.: 10). Die Definition einer wohnungslosen Person entstammte der Begriffsbestimmung des BAG W.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Tabelle zeigt, dass sich 28% der befragten Personen in einer schlechten, einige sogar sehr schlechten Lebenslage befanden. 19,7% befanden sich in einer guten bis sehr guten Lebenslagen. Dies mag zunächst überraschen. Wenn jedoch bedacht wird, dass ausschließlich Personen in die Untersuchung einbezogen wurden, die Hilfen der Diakonie in Anspruch nahmen und somit wohnungslose Personen ohne Anbindungen an das Hilfesystem nicht Teil der Grundgesamtheit waren, dann wirken die Ergebnisse nicht mehr derart überraschend.
Die Definition der BAG W schloß zudem Personen ein, die einer Trägerwohnung im Rahmen des betreuten Einzelwohnens nach §§ 67 ff. SGB XII untergebracht waren. In einer solchen Wohnsituation wurden die einzelnen Lebenslagenbereiche ausschlaggebend gefördert und waren nicht mit Wohnungslosen, die im Freien nächtigen, zu vergleichen (vgl. ebd.: 14). Hier überraschte es wenig, dass Menschen, die prekäre Übernachtungsmöglichkeiten nutzten, den schlechten bis sehr schlechten Lebenslagenbereichen zuzuordnen waren. Sie bewerteten ihre privaten Beziehungen am schlechtesten, waren am häufigsten arbeitslos und konnten ihre materiellen Bedürfnisse am seltensten stillen (vgl. ebd.: 18).
5.2.1.1 Kapitalsorten
Das ökonomische und soziale Kapital der Wohnungslosen kann anhand dieser Studie untersucht werden. Da die sechs Lebenslagenbereiche jedoch keine Bildungsqualifikationen beinhalten, muss das kulturelle Kapital außenvorgelassen werden.
5.2.1.1.1 Ökonomisches Kapital
Fast 2/3 der Befragten ohne Wohnraum hatten entweder keine Schulden (34,0%) oder diese begrenzten sich auf maximal 5000 Euro (30,4%). Weit mehr als die Hälfte (54,2%) konnten ihre Bedürfnisse durch ihr Einkommen nicht befriedigen (vgl. S.21).
Dies lag vor allem an der Erwerbslosigkeit (65%) der befragten Personen. 52,2% der Erwerbslosen waren bereits seit über 12 Monaten ohne Erwerbstätigkeit, wohingegen 8,0% der befragten Personen eine Arbeitsstelle mit einem 30 Std./Woche Umfang vorweisen konnten (vgl. ebd.: 21).
Im Vergleich der Geschlechter waren Frauen seltener mit 5000 Euro und mehr verschuldet als die Männer. Laut der Auskunft der Frauen, konnten sie ihre Bedürfnisse seltener vom eigenen Einkommen befriedigen (vgl. ebd.: 23). Die befragten Frauen waren vereinzelter von einer Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personen. Die anhaltende Wohnungslosigkeit sorgte für eine Anhäufung von Schulden.
Kurzfristig wohnungslose Personen hatten signifikant keine oder geringe Schulden, Langzeitwohnungslose hingegen besaßen höhere und hohe Schulden (ab 5000 Euro) (vgl. ebd.: 29). Bei der Frage, welche Kapitalsorte den Ausstieg aus der Wohnungslosigkeit beförderte, waren die Schulden wohlmöglich ein wichtiger Faktor. Wenn das ökonomische Kapital in der Theorie der einzige Weg aus der Wohnungslosigkeit sein sollte, dann erschweren die Schulden diesen Prozess, da bei Wohnungsvergaben häufig Schufa-Auskünfte angefordert werden.
5.2.1.1.2 Soziales Kapital
Die Studie liefert wertvolle Daten zum sozialen Kapital. Mehr als 30% der befragten Wohnungslosen hatten niemanden, der sie bei Probleme unterstützte oder ihnen Unterstützung im Alltag anbot. Erschütternd ist hierbei, dass es 38,4% schlecht oder sehr schlecht mit ihren privaten Beziehungen ging (vgl. ebd.: 22).
Die Dauer der Wohnungslosigkeit zeigt keine Auswirkung auf die Anzahl der unterstützenden Personen. Einzig die Frage nach der Zufriedenheit der privaten Beziehungen zeigt, dass die kurzfristig wohnungslosen Personen am positivsten abschnitten. Somit besteht ein geringer statistischer Zusammenhang: Je kürzer die Wohnungslosigkeit bestand, desto größer ist die Zufriedenheit über die privaten Beziehungen (vgl. ebd.: 30).
Die Betrachtung des sozialen Kapitals der Wohnungslosen zeigt, dass hierbei kein ausgesprochenes Vermögen besteht. Viele von ihnen besaßen nur wenige Kontakte und durch die Unzufriedenheit, vor allem der Langzeitwohnungslosen, konnte davon ausgegangen werden, dass für die meisten der Wunsch nach mehr privaten Beziehungen besteht.
5.2.1.1.2 Demographische Daten
Die demographischen Daten unterteilen sich in Geschlecht, Nationalität und Alter. Die Studie liefert vor allem interessante Daten zur Altersstruktur der Wohnungslosen.
Zunächst muss jedoch gesagt werden, dass Frauen, die sich in Zwangspartnerschaften befanden, in der Stichprobe dieser Studie vermutlich unterrepräsentiert waren.
Begründet kann dies vor allem mit der verdeckten Wohnungslosigkeit der Frauen werden, die das Hilfesystem bspw. der Diakonie nicht in Anspruch nahmen (vgl. ebd.: 24). Geschlechtsspezifisch bestand die Stichprobe aus 25,2% Frauen, 74,5% Männer und 0,4% Personen, die sich einem diversen Geschlecht zuordneten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Tabelle des Lebenslagenindex nach Geschlecht zeigt, dass die Frauen sich tendenziell entweder eher in einer schlechten bis sehr schlechten oder in einer guten bis sehr guten Lebenslage befanden. Die Personenkreise, die sich dem inter/diversen Geschlecht zuordneten, waren im Gegensatz zu den anderen Geschlechtern eher unterdurchschnittlich angesiedelt. Die geringe Anzahl an Befragten des inter/diversen sorgte für die extreme Verteilung in der Tabelle.
13% der befragten Wohnungslosen waren unter 27, 15% waren mindestens 60 Jahre alt. Somit waren 66% der Stichprobe zwischen 27 und 59 Jahre alt. Frauen waren in den Altersgruppen bis 26 überdurchschnittlich vertreten. Sieben von zehn Befragten besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit, 15,6% waren EU-Bürger und 11,9% stammten aus anderen Staaten (vgl. ebd.: 13).
Je jünger die befragten Personen, desto kürzer waren diese wohnungslos. Am kürzesten von der Wohnungslosigkeit betroffene waren Junge Erwachsene, von Langzeitwohnungslosigkeit (mindestens 1 Jahr) waren vor allem 50-69 Jährige betroffen.
Eine einkommensgenierende Tätigkeit konnten vor allem 21-26 Jährige, sowie 30-39 Jährige Wohnungslose vorweisen.
Wohnungslose bis 26 Jahre hatten zumeist ein größeres soziales Kapital. Entsprechend ging es den jungen Erwachsenen überdurchschnittlich gut mit ihren privaten Beziehungen (vgl. ebd.: 26).
Bei der Betrachtung der Nationalität zeigt sich, dass bei den EU-BürgerInnen und anderen Staatsangehörigen Frauen überdurchschnittlich häufig vertreten waren. Ein prozentualer Unterschied von 5% findet sich unter den wohnungslosen Frauen aus unterschiedlichen Nationen im Vergleich zu deutschen wohnungslosen Frauen.
Ein weiterer signifikanter Unterschied besteht in der Altersstruktur der Nationen. Die Angehörigen anderer Staaten waren mit 30,5% in den Altersgruppen 18 bis 26 Jahre deutlich jünger, als die deutschen Befragten (13,5%), sowie sonstige EU-Bürgerinnen (13,8%) (vgl. ebd.: 27).
Die Befragten mit deutscher Staatsangehörigkeit waren zudem häufiger verschuldet, vor allem ab Verschuldungssummen oberhalb der 5000 Euro Grenze waren sie überproportional belastet. Darüber hinaus waren sie häufiger langzeitarbeitslos im Gegensatz zu nicht EU-Bürgern der Wohnungslosen.
Nicht-Deutsche im Gesamten konnten häufiger eine Erwerbstätigkeit ab 30 Std./Woche vorweisen (vgl. ebd.: 27).
5.2.1.1.3 Dynamik der Wohnungslosigkeit
Die Studie der ASH Berlin liefert erstaunliche Daten zum Verlauf der Wohnungslosigkeit und der Lebensqualität der betroffenen Personen. Die Befragten der Langzeitwohnungslosigkeit (1 Jahr und mehr) betrachteten ihre Lebenssituation weniger schlecht, als die Wohnungslosen, die deutlich kürzer diesem Typus zugeschrieben waren (vgl. ebd.: 4).
Tabelle 3: Lebenslagen nach Dauer der Wohnungslosigkeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Gerull 2018: 20)
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Bewertung der Lebenslagenbereiche entscheidend von den demographischen Daten und der Dauer der Wohnungslosigkeit abhing. Die Gründe für diese Abweichungen sind unterschiedlich. Langzeitwohnungslose befinden sich durch ihre Anpassungsleistungen an die aktuelle Situation zumeist in einer guten Lebenslage.
Die Umstände werden von ihnen eher akzeptiert, als von Wohnungslosen mit einer mittleren Verweildauer.
Zudem ist hierbei anzuführen, dass besonders Bürger aus EU-Staaten oder anderen Nationen die Wohnungslosigkeit in Deutschland im Vergleich mit ihrem Herkunftsland bevorzugen könnten. Möglicherweise empfinden sie es nicht als einen sozialen Abstieg, wie es zumeist bei deutschen Wohnungslosen der Fall ist (vgl. ebd.: 32f.).
Die Studie hat ein Verständnis über die Situation und Bewertung der Wohnungslosen in Alter, Geschlecht, Nationalität und Dauer der Wohnungslosigkeit vermittelt. Die Gründe für die Wohnungslosigkeit und dem Verbleib in dieser waren nicht Bestandteil dieser Untersuchung.
5.2.2 BAGW Statistikberichte
Aus den fast jährlich veröffentlichen Statistikberichten werden vier ausgewählt, die eine nähere Betrachtung auf die Kapitalsorten und die Dynamik der Wohnungslosen ermöglichen. Diese Berichte stammen aus dem Jahr 2003, 2008, 2009 sowie 2017. Der Bericht aus dem Jahre 2017, Stand Ende 2019, liefert das aktuellste Datenmaterial der BAG W zur Wohnungslosigkeit in Deutschland. Zu erwähnen ist hierbei, dass im November 2019 eine Pressemitteilung veröffentlicht wurde, welche die aktuellen Zahlen zur Wohnungslosigkeit beinhaltet. Diese Pressemitteilung führt allerdings keine Informationen zu den Kapitalsorten an.
5.2.2.1 BAGW Statistikbericht 2003
Der Statistikbericht des Jahres 2003 bildet nach einem Ausbleiben von 5 Jahren die erste Untersuchung des BAG W zur Lebenssituation alleinstehender wohnungsloser Frauen und Männer. Die Daten entstammten 42 Hauptstellen mit ca. 70 bis 80 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, in welchen die betroffenen Personen Unterstützungen suchten. Insgesamt erfasste die Erhebung 16817 Personen, die Hilfe in den entsprechenden Einrichtungen suchten (vgl. BAG W Statistikbericht 2003: 6). Die Auswahlgesamtheit bestand zu 77% aus aktuell Wohnungslosen, 11% unmittelbar von einer Wohnungslosigkeit bedrohten, weitere 5% lebten in einer nicht lebenswürdigen Unterkunft und 7%, die nicht zu den Wohnungsnotfällen zählten, allerdings in einer extremen Armut lebten (vgl. Schröder 2005: 9).
Der Verlust der Wohnung, das Ende eines langen Prozess, beruhte bei den meisten später Wohnungslosen auf einer Räumung aufgrund von Mietschulden. Weitere Verluste oblagen zumeist einer Kündigung durch den Vermieter aufgrund von Eigenbedarf. Auch wenn es suspekt klingen mag, war ein freiwilliger Auszug ohne Kündigung mit etwa 18% keine Seltenheit
(vgl. ebd.:10).
5.2.2.1.1 Kapitalsorten
Die Untersuchung der Kapitalsorten unterliegt, wie bereits bei der Analyse der qualitativen Daten, einer systematischen Unterteilung in Kategorien. Des Weiteren werden Unterschiede anhand der Demographie betrachtet und versucht, ein Verständnis über die Dynamik der Wohnungslosen zu erhalten.
Im Gesamten wurden Trennung und/oder Scheidung, Ortswechsel, Miethöhe und Auszug aus der elterlichen Wohnung als die dominanten Auslöser für den letzten Wohnungsverlust genannt.
Geschlechtsspezifisch zeigt, dass bei Frauen der Auszug aus der elterlichen Wohnung und bei Männern die Höhe der Miete überproportional häufig genannt wurden (vgl. ebd.: 30).
Im weiteren Verlauf soll untersucht werden, wie hoch die wirkliche Dominanz der einzelnen Kapitalsorten war.
5.2.2.1.1.1 Ökonomisches Kapital
Die meisten betroffenen Personen (47%) lebten vor der Inanspruchnahme der Hilfsangebote des BAG W von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld (21%). Weitere 8% generierten ihr Einkommen durch eine Gelegenheitsarbeit, Betteln oder Prostitution. Das Überleben durch Rentengelder bestritten etwa 6% und restliche 4% bezogen ihr Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit (vgl. ebd.: 10). Die Tabelle zeigt zudem, dass mehr als 10% der Befragten kein Einkommen vorweisen konnten.
Tabelle 4: Einkommensarten der wohnungslosen Personen
(BAG W Statistikbericht 2003: 20)
Es zeigte sich mit etwa 64% der Wohnungslosen eine hohe Verschuldungsrate. Erschreckend ist darüber hinaus, dass mehr als die Hälfte der betroffenen Personen über kein eigenes Bankkonto verfügte. Das unzureichende Einkommen und die Verschuldung, welche letztlich zu Schufa-Einträgen und erheblichen Schwierigkeiten bei der Wohnungsvergabe führten, waren mitverantwortlich an der Wohnungslosigkeit (vgl. ebd.: 10).
5.2.2.1.1.2 Kulturelles Kapital
Die Untersuchung des kulturellen Kapitals zeigt, dass etwa 75% der Wohnungslosen über ein niedriges Bildungsniveau verfügten. Somit konnten lediglich ein Viertel eine mittlere bis hohe formale Bildungsqualifikation vorweisen. Frauen waren hierbei leicht im Vorteil, bei ihnen fiel das Bildungsniveau leicht höher aus, als bei den Männern der Stichprobe (vgl. ebd.: 16).
5.2.2.1.1.3 Soziales Kapital
Das soziale Kapital der Wohnungslosen unterliegt einem generativen Wandel. Die Zunahme nichtehelicher Lebensgemeinschaften und alternativer Lebensformen, sowie eine spätere Geburt des ersten Kindes führen dazu, dass die Wohnungslosen häufiger nicht verheiratet, sondern ledig sind (vgl. ebd.: 17). Die folgende Tabelle zeigt, dass Männer deutlich häufiger ledig waren, wohingegen Frauen eher geschieden oder verwitwet waren.
Tabelle 5: Familienstand der wohnungslosen Personen
(BAG W Statistikbericht 2003: 16)
5.2.2.1.2 Demographische Daten
Für diese Arbeit ist es besonders wertvoll, dass die Statistikberichte des BAG W demographische Daten muteinbezogen haben und somit nach Geschlecht, Alter und Nationalität trennten. Der Frauenanteil der Auswahlgesamtheit betrug 14%, durch Einbeziehung der Dunkelziffer stieg dieser Wert auf etwa 23%.
Die Betrachtung der Altersstruktur zeigt, dass die meisten wohnungslosen Personen 30 bis 39 Jahre (26%) bzw. 40 bis 49 Jahre alt waren. Es zeigte sich ein Anstieg der jungen Erwachsenen unter den betroffenen Personen, welches vermutlich aus der wachsenden Langzeitarbeitslosigkeit unter jungen Erwachsenen entstand (vgl. ebd.: 9). Frauen gingen tendenziell häufiger einer Erwerbstätigkeit nach und erhielten zudem öfter finanzielle Unterstützung durch Angehörige als Männer, die hingegen häufiger Arbeitslosengeld bzw. -hilfe bezogen (vgl. ebd.: 20).
Bei dem geschlechtsspezifischen Vergleich mit der Unterkunftssituation zeigt sich, dass Frauen zu Beginn und zum Ende der Betreuung progressiv häufiger eine eigene Wohnung besaßen als Männer (Männer von 17,9 % auf 23,5 % und Frauen von 35,9 % auf 44,0 %). Die Zahlen schüren die Vermutung, dass Frauen einen stärkeren Wunsch nach einer eigenen Wohnung besaßen und sie „leichter“ eine Wohnung erhielten. Vermutlich unterlag sie bei der Wohnungsvergabe nicht der selben Stigmatisierung der Männer, sie wurden nicht so enorm anhand Vorurteile über Wohnungslose diskreditiert. Abschließend sank der Anteil von Personen, die am Ende der Betreuung bei Bekannten wohnten (Männer von 19,2 % auf 11,5 % und Frauen von 21,3 % auf 12,5 %) (vgl. ebd.: 36).
5.2.2.1.3 Dynamik
Die Analyse der Dynamik zeigt, dass 47% der Wohnungslosen erst bis zu sechs Monaten wohnungslos waren, knapp über 10% waren hingegen schon sechs bis zwölf Monate, weitere 16% ein bis drei Jahre und mehr als 25% mindestens drei Jahre wohnungslos. Ein Großteil war bereits mehr als fünf Jahre ohne nennenswerten Wohnsitz (vgl. ebd.: 10).
Tabelle 6: Wohnbedarf der wohnungslosen Personen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BAG W Statistikbericht 2003: 31)
Die Betrachtung des Wohnbedarfs (Tabelle 6) zeigt, dass der Wunsch nach einer eigenen Wohnung mindestens die Hälfte der Befragten betraf. Bei Männern war dieser Wunsch noch einmal deutlich erhöht, statisch hätten Frauen auch eher eine Wohnung für 2 Personen befürwortet.
Interessanterweise bestand für die Männer entweder kein Wohnbedarf (15,3% zu 10,1%) oder der Bedarf nach einer stationären Einrichtung, bei welchem sich ein erheblicher geschlechtsspezifischer Unterschied findet (12,6% zu 2,6%).
5.2.2.2 BAGW Statistikbericht 2008
Die Stichprobe des Statistikberichts 2008 bestand aus einem Umfang von 19651 Personen, die in insgesamt 164 Einrichtungen und Diensten der Wohnungslosenhilfe befragt wurden
(vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2010: 2).
Im Vergleich zum Bericht aus dem Jahre 2003 umfasste diese Auswahlgesamtheit fast 3000 weitere Wohnungslose.
Der Anteil der wohnungslosen Frauen betrug 21,6%, weiterhin zwar ein deutlich geringer Frauenanteil, dennoch ist hierbei anzuführen, dass es auch hier ein enormer Anstieg im Vergleich zum Jahre 2003 vorlag. Weiterhin bildeten Trennung/Scheidung, Ortswechsel, Auszug aus der elterlichen Wohnung und Mietschulden die Gründe für die Wohnungsverluste. Beim weiblichen Geschlecht waren es zunehmend Gewalterfahrungen, die ihren Weg in die Wohnungslosigkeit bereiteten (vgl. ebd.: 3). Die Betrachtung der nachstehenden Tabelle zeigt, dass der Anteil, der späteren Wohnungslosen, die ohne Kündigung auszog, im Jahresverlauf von 2007 bis 2008 konstant über 30% blieb.
Tabelle 7: Grund des letzten Wohnungsverlustes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BAG W Statistikbericht 2008: 10)
5.2.2.2.1 Kapitalsorten
5.2.2.2.1.1 Ökonomisches Kapital
Etwa 8 von 10 Wohnungslosen waren nach SGB II erwerbsfähig. Einer nennenswerten Erwerbstätigkeit gingen allerdings nur etwa 12% nach (vgl. ebd.: 2).
Der Anteil der Wohnungslosen, die kein eigenes Bankkonto besaßen, sank.
Die Erhebung aus dem Jahre 2003 hatte erbracht, dass mehr als die Hälfte der Befragten nicht über ein solches verfügten. Weiterhin war ein Großteil (62,3%) der Wohnungslosen verschuldet, welches eine negative Auswirkung auf die Vergabe eines Bankkontos gehabt haben könnte (vgl.ebd.:2f.).
5.2.2.2.1.2 Kulturelles Kapital
Mehr als die Hälfte der Befragten verfügte weiterhin, wie auch im Statistikbericht 2003 zu erkennen, über keine Berufs-oder Anlernausbildung. 75% der Befragten konnten entweder keinen oder einen sehr niedrigen Bildungsabschluss. Es fand sich hierbei zwar ein leichter Anstieg, dieser ist jedoch nicht weiter auszuführen (vgl. ebd.: 6).
5.2.2.2.1.3 Soziales Kapital
Beinahe 15% der Befragten verfügte über keinerlei soziale Kontakte und lebte weitgehend isoliert. Geschlechtsspezifisch war dies besonders bei Männer der Fall, wobei der überwiegende Anteil an sozialen Kontakte durch Freunde und Bekannte, weniger durch die Familie geschaffen wurde(vgl. ebd.: 2). Mehr als 60% der Befragten waren ledig und weitere 20,1% hatten sich von ihrem Partner*in scheiden lassen. Frauen pflegten deutlich intensiver den Kontakt zu ihren Kindern, Eltern, Partnern oder Verwandten (siehe Tabelle 8). Zudem wurden Selbsthilfegruppen oder Verein von Frauen häufiger aufgesucht (vgl. ebd.: 7).
Tabelle 8: Soziale Kontakte der wohnungslosen Personen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BAG W Statistikbericht 2008: 7)
5.2.2.2.2 Demographische Daten
Erstaunlicherweise besaßen Frauen im Vergleich ein besseres Bildungsniveau, konnten aber seltener eine Berufsausbildung vorweisen. Seit dem Jahre 2007 hatte sich der Wert der Frauen ohne Berufsausbildung noch einmal deutlich erhöht (vgl. ebd.: 7). Zu vermuten ist hierbei, dass die Frauen keine Berufsausbildung absolviert haben, weil sie sich früh einem Partner untergeordnet haben und für Hausfrauentätigkeiten verantwortlich gewesen sind.
Dies mag einem Klischee entsprechen, ist aber in vielerlei Hinsicht Realität. Die Abhängigkeit der Frau vom Mann ist in vielen Fällen immer noch Bestandteil der gegenwärtigen Gesellschaft.
Die Analyse der Altersstruktur ergibt einen leichten Anstieg der unter 24 Jahre alten Wohnungslosen. Dieser Anstieg findet sich sowohl bei den Frauen (30,0%), als auch bei den Männern (16,0%) (siehe Tabelle 9)
Tabelle 9:Altersstruktur der wohnungslosen Personen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BAG W Statistikbericht 2008: 6)
5.2.2.2.3 Dynamik
Die Betrachtung der Dynamik der Wohnungslosen zeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten bereits mehrfach wohnungslos gewesen sind. Etwa 30% der Auswahlgesamtheit war zum ersten Mal wohnungslos und etwa 10% waren zuvor noch nie wohnungslos. Geschlechtsspezifisch waren Männer signifikant häufiger wohnungslos als Frauen (vgl. ebd.: 3).
5.2.2.3 BAG W Statistikbericht 2009
Die Auswahlgesamtheit des Statistikberichts von 2009 umfasste 22865 Personen, die in ingesamt 153 Einrichtungen und Diensten der Wohnungslosenhilfe Unterstützungen erhalten hatten.
Mit dieser Zahl zeigt sich ein Anstieg von mehr als 16%, zum Bericht aus dem Jahre 2008 (vgl. ebd.: 1). Auch der Anteil an wohnungslosen Frauen zeigt eine Progression (23,4%, im Vergleich zu 21,6% aus dem Jahre 2008) (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2011: 3).
5.2.2.3.1 Kapitalsorten
5.2.1.3.1.1 Ökonomisches Kapital
Die Periode von einem Jahr zeigte keine Veränderung in der Erwerbstätigkeit der befragten Wohnungslosen des BAG W. 90% waren arbeitslos, Frauen konnten hierbei leicht positivere Werte als Männer zugeschrieben werden. Fast die Hälfte der Klientinnen des BAG W erhielt Leistungen in Form von Arbeitslosen- und Sozialgeld nach SGB II. Wie bereits in den Vorjahren generierten Frauen ihr Einkommen häufiger aus Erwerbs-oder Berufstätigkeit und waren daher
signifikant seltener ohne Einkommen (vgl. ebd.: 4) (siehe Tabelle 10).
Tabelle 10: Einkommenssituation zu Beginn der Hilfen nach Geschlecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BAG W Statistikbericht 2009: 12)
5.2.2.3.1.2 Kulturelles Kapital
Im kulturellen Kapital, speziell im institutionalisierten, zeigte sich keine Veränderung. Weiterhin waren es 75% der Wohnungslosen, die eine niedrige Bildungsqualifikation vorwiesen
(vgl. ebd.: 4).
Geschlechtsspezifisch besaßen Frauen deutlich seltener eine Berufsausbildung (61%), im Gegenzug konnten sie jedoch häufiger einen fachschul- oder (fach-)hochschulbezogenen Berufsabschluss vorweisen (3,7% gegenüber 2,2% der Männer).
Tabelle 11: Höchster erreichter Berufsabschluss nach Geschlecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BAG W Statistikbericht 2009: 12)
Interessant wird im weiteren Verlauf zu betrachten, ob das kulturelle Kapital im Statistikbericht von 2017 ähnlich ausfällt oder in einem zeitlichen Abstand von 8 Jahren eine Veränderung vorweist.
5.2.2.3.1.3 Soziales Kapital
Die Betrachtung des sozialen Kapitals zeigt, dass die wenigsten Befragten des BAG W zu Beginn der Hilfen in sozialer Isolation lebten. Fast 95% verfügten über soziale Kontakte. Geschlechtsspezifisch waren es bei den Männern lediglich 83,8%, die Kontakte zu Verwandten, Partner oder Bekannten aufrecht erhielten (vgl. ebd.: 3).
5.2.2.3.2 Demographische Daten
Der Bericht aus dem Jahre 2009 liefert interessantes Datenmaterial zur Altersstruktur der Wohnungslosen. Der Personenkreis, der unter 25 Jahre alten Wohnungslosen erfuhr weiterhin einen Zuwachs. Von 2007 bis 2009 stieg der Anteil dieser Altersgruppierung um mehr als 3%. Zudem konnten 38,1% von ihnen keine Berufsausbildung vorweisen. Bei den unter 30 Jährigem waren es sogar mehr als die Hälfte (51,9%) (vgl. ebd.: 5).
5.2.2.3.3 Dynamik
Erfreuliche Daten finden sich bei der Dynamik der Wohnungslosen. Das Phänomen, der wiederholten Wohnungslosigkeit tritt immer seltener auf. Im Jahre 2007 waren es noch 60,5%, im Jahre 2008 mit 55,3% noch deutlich mehr als die Hälfte und im Jahre 2009 waren es nur noch knapp die Hälfte der Wohnungslosen (51,4%). Von der wiederholten Wohnungslosigkeit waren vor allem Alleinstehende (53,5%) betroffen. (vgl. S.5) Zudem war die Teilhabe der Personen, die länger als sechs Monate wohnungslos waren, seit 2007 regressiv (41%). Hingegen stieg der Anteil derer, die weniger als sechs Monate wohnungslos waren, von 52,6% im Jahre 2007 auf 59% im Jahre 2009 (vgl. ebd.: 5). Abschließend lebten etwa 40% der Wohnungslosen, die 2009 ein ihnen gewährtes Hilfeangebot beendeten, im Anschluss an die Hilfen in einer eigeneren, mietvertraglich abgesicherten Wohnung. Im Vergleich der Geschlechter waren es bei den Frauen sogar fast die Hälfte (vgl. ebd.: 8).
5.2.2.4 BAG W Statistikbericht 2017
Der Statistikbericht des BAG W aus dem Jahre 2017 lieferte wertvolle Daten zu den Kapitalsorten und der Demographie, vor allem für die Betrachtung des Verlaufs eines Jahrzehnts. Leider finden sich keinerlei, für diese Arbeit verwendbaren Daten zur Dynamik der Wohnungslosen.
Aus 183 Einrichtungen und Diensten der Hilfen in Wohnungsnotfällen konnten Daten über 35369 Wohnungslose, Klient*innen des BAG W gewonnen werden.
Hier zeigte sich ein Anstieg um mehr als 12000 Personen gegenüber der Stichprobe zum Jahre 2009. Die Anzahl an Befragten entstammt stationären bzw. teilstationären Einrichtungen (12,3%), sowie ambulanten Einrichtungen und Diensten (87,7%) (vgl. Neupert 2018: 4). Geschlechtsneutral war die häufigsten Auslöser für den Wohnungsverlust Miet-Und Energieschulden (17,7%), Ortswechsel (16,7%), Trennung und/oder Scheidung (16,4%) sowie Konflikte im Wohnumfeld (14,4%).
Im Vergleich der Geschlechter zeigte sich, dass Männer entscheidend häufiger ihren Wohnraum durch einen Ortswechsel (17,9% zu 13,3%), einen Haftantritt (9,2% zu 4,7%) oder durch den Verlust oder Wechsel des Arbeitsplatzes verloren (5,5% zu 2,7%). Frauen hingegen begründeten ihren Wohnungsverlust häufiger mit einer Gewalterfahrung durch den/die Partner/in (6,7% zu 0,7%), einem Auszug aus der elterlichen Wohnung (10,2% zu 7,8%) sowie der Veränderung ihrer Haushaltsstruktur (8,2% zu 4,6%) (vgl. ebd.: 9).
5.2.2.4.1 Kapitalsorten
5.2.2.4.1.1 Ökonomisches Kapital
Bereits wohnungslose oder von einer Wohnungslosigkeit gefährdete Personen waren umfassend aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Im Gesamten waren 86,7% der Wohnungslosen im Jahre 2017 arbeitslos, obwohl nahezu die gleiche Prozentanzahl als erwerbsfähig eingestuft wurde (vgl. ebd.: 12). Die Art des Einkommens hatte sich zwischen 2007 und 2017 kaum verändert. Einzig der Anteil an Sozialhilfebezieher*innen nach SGB XII war von über 13% auf 5,3% gesunken.
Tabelle 12: Erwerbssituation der wohnungslosen Personen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BAG W Statistikbericht 2017: 11)
Alarmierend ist bei der Untersuchung des ökonomischen Kapitals der Anteil der Wohnungslosen, die ohne jegliches Einkommen verweilen mussten. Hier zeigte sich ein Anstieg von 21,3% auf 28,3%. Die Quote der Überschuldung lag nach wie vor in einem sehr hohen Bereich. Es fand sich ein minimaler Rückgang, welcher mit einem Wert von 60,2% allerdings weiterhin mehr als die Hälfte betraf (vgl. ebd.: 12).
5.2.2.4.1.2 Kulturelles Kapital
Die Bildungsqualifikation der Wohnungslosen bestand weiterhin zumeist aus minderen Abschlüssen, darunter fallen fehlende Schulabschlüsse bzw. Sonder-, Haupt- oder Volksschulabschlüsse. Anzuführen ist hierbei jedoch, dass sich hier ein Rückgang von 7,6% zeigte. Mittlere und höhere Bildungsqualifikationen konnten immer häufiger von den Klientinnen vorgewiesen werden (vgl. ebd.: 10).
Geschlechtsspezifisch hatten Männer im Schnitt vermehrt einen Volks- bzw. Hauptschulabschluss (46,8% zu 40,6% der Frauen), wohingegen die Frauen öfter keinen Abschluss (10,5% zu 8,1% der Männer), die mittlere Reife (19,9% zu 16,6%) oder das Abitur (10,5% zu 8,1%) erlangten. Noch deutlichere Unterschiede zeigt sich in den Berufsabschlüssen. 61,4% der Frauen hatten nie eine Berufsausbildung abgeschlossen, bei den Männer zeigte sich mit einem Wert von 52,4% ein prozentualer Unterschied von fast 10% (vgl. ebd.: 10).
5.2.2.4.1.3 Soziales Kapital
Die Analyse des sozialen Kapitals der Wohnungslosen aus dem Jahre 2017 zeigt, dass weiterhin ein Großteil der Klient*innen ledig (68,8%) und alleinstehend (83,2%) war. Gestiegen ist der Anteil der Alleinerziehenden, der Paare mit oder ohne Kinder und der sonstigen Mehrpersonenhaushalte. Wie bereits in den früheren Statistikberichten zu erkennen, zeigte sich auch hier, dass Frauen (63,5%) deutlich seltener als Männer (90,7%) alleinstehend waren
(vgl. ebd.: 13). Die Begründung fand sich hierbei in der vermehrten Kontaktpflege und der Teilnahme an Hilfsprogrammen der Frauen.
5.2.2.4.2 Demographische Daten
Die Altersstruktur der Klient*innen hatte sich seit dem Jahre 2007 gewandelt. Vor allem die jungen Erwachsenen, sowie die 30-39-Jährigen erfuhren in den letzten 10 Jahren erheblichen Zuwachs. Im Jahre 2017 waren mehr als 20% der Wohnungslosen jünger als 25 Jahre und 14,5% zwischen 25 und 29 Jahre alt.
Tabelle 13: Altersstruktur der wohnungslosen Personen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BAG W Statistikbericht 2017: 7)
Im Vergleich der Geschlechter waren Frauen im Durchschnitt deutlich jünger als die Männer. Demnach waren 22,7% der Frauen jünger als 25 Jahre, wohingegen es bei den Männer „nur“ 17,0% waren. Abschließend zeigt sich, dass der Anteil der nicht-deutschen Klient*innen zwischen 2007 und 2016 kontinuierlich von 9,1% auf 29,7% anstieg (vgl. ebd.: 9).
Das traditionelle Bild des Wohnungslosen ist deutsch, männlich, alleinstehend, arbeitslos und im mittleren bis gehobenen Alter. Bedingt durch verschiedene gesellschaftliche und generative Faktoren verändert sich dieses Bild. Hilfesuchende sind zunehmend weiblich und weisen öfter eine Migration vor (vgl. ebd.: 13). Auch wenn der Frauenanteil immer noch einem Viertel der gesamten Wohnungslosen entspricht, erleben sie einen kontinuierlichen Zuwachs.
6. Ergebnisse und Diskussion
Die Interviews der Dissertation von Paulgerg-Muschiol zeigten solide, gutbürgerliche Lebensverläufe, die durch sich ähnelnde Schicksalsschläge zur Wohnungslosigkeit geführt haben.
So wie bei Erich B, der bis zur plötzlichen Wohnungslosigkeit über ein ausreichendes Vermögen an ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital verfügte. Die Enttäuschung über die Scheidungsklage seiner Frau und der damit verbundene Entzug seiner Kinder führte dazu, dass er fortan wohnungslos war. In seinem Fall, wie auch bei Egon S., war der Verlust der Familie der Auslöser für die Wohnungslosigkeit. Auch der interviewte Egon S. verfügte über ein ausreichendes Vermögen an Kapitalsorten. Einzig die Scheidung seiner Frau führte zu der Flucht vor Allem und der fortan herrschenden Planlosigkeit. In beiden Fällen nahm die jeweilige Ehefrau zwar ein Großteil des ökonomischen Kapitals an sich, jedoch kristallisierte sich in den einzelnen Interviewpassagen heraus, dass die Enttäuschung über die Scheidungsklage der Frau weitaus größeren psychischen Schmerz in den Wohnungslosen herbeigeführt hatte, als der Entzug des ökonomischen Kapitals. Die beiden Interviewten gaben an, dass die Wohnungslosigkeit unmittelbar nach dem Erhalt der Scheidungsklage begann.
Die freundschaftlichen Beziehungen von späteren Wohnungslosen können einen tatsächlichen Einstieg zumeist nur kurzfristig verhindern. Eine größere Wirkung haben hierbei familiäre Netzwerke, in den meisten Fällen durch die Mutter. Nicht selten, wie im Fall von Horst S., ziehen die Männer wieder bei der Mutter ein. Dies kann für beide Seiten positive Auswirkungen haben. Die bis dato Wohnungslosen müssen nicht mehr umherziehen, die Mütter erhalten von ihrem Sohn, wenn notwendig, Unterstützung bei der täglichen Pflege (vgl. Von Paulgerg-Muschiol 2009: 139).
Die Interviews haben verdeutlich, welchen Rückhalt und welche Bedeutung die Familie für die durch das Bild des Familienoberhauptes bzw. -ernährers geprägten betroffenen Personen besitzen. Die Flucht aus der familiären Wohnung resultiert aus einer starken Enttäuschung sowohl über die Ehefrau, als auch über die Familie als Ganzes (vgl. ebd.: 158).
Nach der Scheidung oder Trennung von der Ehefrau wird durch die Mutter ein Zufluchtsort erschaffen. In vielen Fällen ist die Mutter der letzte funktionierende Bestandteil des sozialen Netzwerks. Der Tod dieser letzten Instanz führt meistens unmittelbar in die Wohnungslosigkeit, da die Mutter nicht nur einen seelischen sondern auch finanziellen Anker schafft (vgl. ebd.: 160).
Auch wenn es häufig so wirkt, als wäre die Dominanz des männlichen Geschlechts über die Gesellschaft unaufhaltsam, so haben die Frauen immer noch großen Anteil an der Stabilität der Lebenslage.
Sie erschaffen, beleben und erhalten das soziale Kapital der Männer. Die Ergebnisse der Dissertation von Paulgerg-Muschiol haben diese Vermutung in den meisten Fällen mit aussagekräftigem Datenmaterial untermauert.
Ein Vergleich in Alter, Geschlecht und Nationalität konnte in diesem Fall nicht stattfinden, da es sich in der Grundgesamtheit um männliche Wohnungslose handelt, die Nationalität in einzelnen Fällen nicht weiter ausgeführt wurde und die Interviewten zumeist weit über 50 Jahre alt waren.
Die Betrachtung der bereits Wohnungslosen oder von akuter Wohnungslosigkeit betroffenen Personen anhand der Studie der ASH Berlin in Kooperation mit EBET e.V. zeigt, dass das ökonomische Kapital der Betroffenen nicht sonderlich ausgeprägt war. Zwar war ein Großteil der Wohnungslosen nicht oder nicht besonders hoch (unter 5000 Euro) verschuldet. Jedoch konnten viele von Ihnen ihre Bedürfnisse aufgrund von einer fehlenden Erwerbstätigkeit nicht befriedigen. Wohnungslose mit einer deutschen Staatsangehörigkeit waren weitaus häufiger verschuldet, vor allem bei Verschuldungssummen ab 5000 Euro. Nicht-Deutsche Wohnungslose verfügten häufiger über eine Erwerbstätigkeit ab 30 Std./Woche. Die Analyse des sozialen Kapitals hatte ergeben, dass mehr als 30% der befragten Wohnungslosen niemanden hatten, der sie bei Alltagsproblemen unterstützt. Die Erhebung anhand er Lebenslagenbereiche hat ergeben, dass es mehr als ein Drittel der Befragten schlecht oder sehr schlecht mit ihren privaten Beziehungen ging. Ein Großteil der Befragten besaß nur wenige soziale Kontakte. Hierbei kann davon ausgegangen werden, dass für viele der Wunsch nach mehr Beziehungen in Form von Familie, Freunde und Bekannte besteht. Diese könnten der entscheidende Faktor für den Weg aus der Wohnungslosigkeit sein. Erstaunlich ist, dass Langzeitwohnungslose ihre Lebensumstände deutlich besser bewerteten als der Personenkreis mit einer kürzeren Wohnungslosigkeit. Begründet kann dies unter anderem anhand er Anpassungsleistungen an die aktuelle Situation der Langzeitwohnungslosen.
Die Statistikberichte des BAG W zeigten eine hohe Verschuldungsrate der Wohnungslosen. Im Jahre 2003 verfügte ein Großteil der Grundgesamtheit über kein eigenes Bankkonto. Dies stand natürlich dem Wunsch nach einer eigenen Wohnung entgegen. Selbst wenn die Miete für eine Wohnung vom Arbeitsamt übernommen werden würde, hätten die Zahlungen nicht erfolgen können, da die betroffenen Personen kein Bankkonto vorweisen konnten.
Zudem sind Schufa-Einträge bei den Wohnungslosen keine Seltenheit, welche bei der Wohnungsvergabe immer häufiger angefordert werden.
Die Erwerbstätigkeit der Wohnungslosen war minimal. Der Statistikbericht aus dem Jahre 2009 untermauert diese Behauptung, da 9 von 10 Klient*innen des BAG W keine Erwerbstätigkeit vorweisen konnten. Geschlechtsspezifisch waren Frauen leicht im Vorteil, da sie tendenziell seltener arbeitslos waren. Wohnungslose genierten ihre Gelder zum Überleben nicht ausschließlich durch Betteln, fast die Hälfte von ihnen erhält Leistungen in Form von Arbeitslosen- und Sozialgeld nach SGB II. Auch wenn 90% der Wohnungslosen keine Erwerbstätigkeit nachwiesen, verfügten mehr als 50% von ihnen über monatliche Einkünfte, die wohlmöglich einen Ausstieg aus der Wohnungslosigkeit ermöglicht hätten können. Zudem besteht die Annahme, dass im Bedarfsfall und bei der Verfügbarkeit eines entsprechenden Wohnraumes die Miete vom Arbeitsamt übernommen werden würde. Hierbei ist die Behauptung aufzustellen, dass die anhaltende Wohnungslosigkeit anders, als durch das fehlende ökonomische Kapital begründen sein muss.
Mehr als 90% der befragen Wohnungslosen besaß soziale Kontakte, das heißt, dass die wenigsten von ihnen in sozialer Isolation leben mussten. Im Vergleich der Geschlechter zeigt sich jedoch, dass es bei den Männer lediglich 83,8% waren, die über soziales Kapital verfügten. Interessant wäre hierbei zu betrachten, welche Art von sozialen Kontakten es sind. Es ist zu bezweifeln, dass gleichgesinnte Wohnungslose den Weg aus der Wohnungslosigkeit ebnen könnten. Es bedarf nicht-wohnungslosen Kontakten, die einen Wohnraum vermitteln könnten.
Die Auswertung der Stichprobe des Berichts aus dem Jahre 2017 ergab, dass in den meisten Fällen der Eintritt in Wohnungslosigkeit mit einem Mangel an ökonomischen oder sozialen Kapital begründet wurde. Die Grundgesamtheit war umfassend aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Mehr als 85% der Wohnungslosen war im Jahre 2017 arbeitslos und das obwohl fast der gleiche Anteil als erwerbsfähig eingestuft wurde.
Die Betrachtung des kulturellen Kapitals zeigte, dass die Bildungsqualifikation der Wohnungslosen zumeist aus niedrigeren Abschlüssen, im besten Fall eines Hauptschulabschluss, bestand. Jedoch zeigte sich, dass mittlere und höhere Bildungsqualifikationen immer häufiger von den Wohnungslosen vorgewiesen werden konnten.
Das kulturelle Kapital wurde in den einzelnen Studien wenig ausgeführt und es wurde nicht ein einziges Mal ersichtlich, dass dies zur Wohnungslosigkeit führte.
Besonders die Dissertation von Paulgerg-Muschiol hat gezeigt, dass eine höhere Bildungsqualifikation unter den Wohnungslosen kein seltenes Phänomen war, sondern vermehrt auftrat. Alle drei Interviewten besaßen für die damalige Zeit überdurchschnittlich hohe Schul-und Berufsabschlüsse, welches dem kulturellen Kapital zu Gute kam.
Die Betrachtung des ökonomischen Kapitals hatte zwar gezeigt, dass ein geringer Teil der Wohnungslosen einer Erwerbstätigkeit nachging und wenige verschuldet waren. Wiederum zeigte sich, dass ein Großteil von ihnen Sozialleistungen bezogen und somit regelmäßige Gelder erhielten. Die Behauptung, der Zusicherung des Arbeitsamtes für die Übernahme der Mietzahlung, wenn ausreichender Wohnraum besteht und die Auflagen seitens der betroffenen Personen eingehalten werden, würde dazu führen, dass das ökonomische Kapital nicht der entscheidende Faktor für den Weg in und aus die/der Wohnungslosigkeit ist. Vielmehr hat die Analyse gezeigt, dass das soziale Kapital eine viel größere Wirkung auf die Wohnungslosen besitzt, als zu Beginn dieser Arbeit vermutet. Plötzliche Schicksalsschläge führten in vielerlei Fällen zur Flucht aus dem Zuhause und in das planlose Leben in der nächsten Großstadt. Das soziale Kapital kann der einzige Faktor sein, der die Wohnungslosigkeit verhindert. Die betroffenen Personen können zwar über ein ausreichendes ökonomisches Kapital verfügen, wenn sie jedoch keinen Zugang zu potenziellen Wohnungen erhalten und keinen Rückhalt durch Familie, Freunde oder Bekannte verspüren, dann sind sie von einer akuten oder bereits bestehenden Wohnungslosigkeit betroffen.
Die Wohnungslosen sind im sozialen Raum weit unten angeordnet. Tendenziell noch weit unter den Hilfsarbeitern und Erwerbslosen. Statistisch betrachtet besitzen sie weder ein hohes ökonomisches, noch kulturelles Kapital. Viele von ihnen besitzen geringe Bildungsabschlüsse und leben zumeist von ihren knappen Geldreserven. Somit ist ein Aufstieg im sozialen Raum, bei Verbleib in der Wohnungslosigkeit, nicht realistisch.
Der Habitus sowie die Macht-und Positionskämpfe im Feld in Bezug auf die Wohnungslosigkeit wurden in dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt. Das liegt vor allem daran, dass die einzelnen Studien keine geeignete Basis für die jeweilige Theorie lieferten. Die Studien ermöglichten eine Analyse der jeweiligen Kapitalsorten, jedoch konnten die Erhebungen keine Interviewpassagen oder statistische Zusammenhänge zu den Theorien des Habitus oder der Macht-und Positionskämpfe im Feld generieren. Relevante Studien zur Wohnungslosigkeit, die die erforderlichen wissenschaftlichen Kriterien erfüllen, sind ausgesprochen rar und liefern nach meiner Erkenntnis keine Daten zu den nicht berücksichtigten Theorien des Sozialen Raumes.
7. Fazit
Das folgende Kapitel schafft sowohl Raum für die Reflexion des theoretischen und methodischen Konstrukts. Darüber hinaus können hierbei Implikationen für die Praxis, vor allem aber Präventionsmaßnahmen ausgesprochen werden.
Die Analyse der Dynamik der Wohnungslosigkeit hat gezeigt, dass die schlechteste Empfindung über die Lebenslage der mittleren Verweildauer entsprang. Daher ist es unabdingbar die bereits eingetretene Wohnungslosigkeit schnellstmöglich durch entsprechende Hilfestellungen zu beenden. Wohnungslose mit einer mittleren Verweildauer benötigen gezielte Unterstützungsangebot, die auf ihre Situationen einer noch nicht verfestigten Wohnungslosigkeit zugeschnitten sind. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass eine Langzeitwohnungslosigkeit mit Anpassungsleistungen einherging. Hierbei bedarf es einer größeren Zuteilung von Ressourcen, um die mittlere Verweildauer, die unterdurchschnittliche schlechte Lebenslage, lebenswürdiger überwinden zu können (Gerull 2018: 32). Wenn die Wohnungspolitik in ihren Möglichkeiten beschränkt ist, so könnte die Sozialpolitik, aber auch die Arbeitsmarktpolitik ihren Anteil am Kampf gegen die gegenwärtige Wohnungslosigkeit halten (vgl. Von Paulgerg-Muschiol 2009: 170) Ein weiterer Faktor können die einzelnen Kommunen sein, die eine „Verunstaltung“ des städtischen Bildes sowie eine deutlich höhere Kostenaufbringung in Kauf nehmen müssten. (vgl.: 171).
7.1 Theoretisches Fazit
Die Theorie des Sozialen Raumes bildet ein verwendbares Konstrukt zur Analyse der Wohnungslosigkeit. Die Positionierung der Wohnungslosen anhand ihres ökonomischen und kulturellen Kapitals konnte problemlos erfolgen. Die Wohnungslosigkeit ist darüber hinaus ein ideales Beispiel, um die Dynamik im Sozialen Raum zu verdeutlichen. Die Ergebnisse zeigen, dass nicht alle Betroffenen seit jeher wohnungslos sind und es bleiben wollen. Es ist nicht undenkbar, dass mit dem Austritt aus der Wohnungslosigkeit ein Aufstieg im Sozialen Raum erfolgt. Der Habitus, sowie die Macht-und Positionskämpfe im Feld konnten anhand des Datenmaterials dieser Abschlussarbeit nicht erfolgen, da sich hierbei keine Strukturen oder Ansätze zeigten, die über Vermutungen im Kontext des Habitus oder der Macht-und Positionskämpfe im Feld und der Wohnungslosigkeit hinausgehen könnten.
7.2 Methodisches Fazit
In diesem Abschnitt wird resümiert, inwiefern das methodische Vorgehen umsetzbar war und die gewünschten Ergebnisse liefern konnte. Bei der Analyse der Wohnungslosigkeit im Sozialen Raum wurden nicht nur qualitative, sondern auch quantitative Studien herangezogen. Daher wird zunächst betrachtet, inwiefern die qualitative Studie wertvolles Datenmaterial lieferte. Die Interviews der Dissertation von Paulgerg-Muschiol ermöglichten tiefgreifende Einblicke in die Lebensverläufe der Wohnungslosen. Dies ermöglichte eine intensive Betrachtung und Analyse der individuellen Auslöser für die bestehende Wohnungslosigkeit. Leider sind die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht auf die Grundgesamtheit, alle Wohnungslosen in Deutschland, übertragbar. Daher war es unabdingbar, quantitative Studien, die repräsentativ für die genannte Grundgesamtheit sind, heranzuziehen. Die Verknüpfung aus der Studie der ASH Berlin in Kombination mit EBET e.V. mit den verschiedenen Statistikberichten des BAG W ermöglichten eine umfassende Analyse der Kapitalsorten im Sozialen Raum. Vermutungen konnten anhand mehreren Erhebungen bewiesen und widerlegt werden. Besonders die Dynamik sowie die demographischen Daten der Wohnungslosen konnte aufgrund des quantitativen Datenmaterials eingehend betrachtet werden. Zudem verdeutlichten die vielfachen Tabellen der einzelnen Studien, die Dringlichkeit der präventiven Arbeit gegen die Wohnungslosigkeit. Wünschenswert wäre es hingegen gewesen, wenn die Daten eine intensivere Analyse der kulturellen Bildung der Wohnungslosen ergeben hätten. Darüberhinaus wäre es ausgesprochen interessant zu betrachten, aus welchem Personenkreis das soziale Kapital der Wohnungslosen bestand, das heißt ob der Freundes-und Bekanntenkreis auch in der Wohnungslosigkeit verweilte.
7.3 Implikationen für die Praxis
Im Frühjahr 2008 verabschiedete die finnische Regierung ein Programm, welches die Anzahl an Wohnungslosen im Land bis 2011 halbieren und bis 2015 die Langzeitwohnungslosigkeit beseitigen sollte. Hierbei hatte die Wohnungsversorgung, die Voraussetzung für die Lösung sozialer und gesundheitlicher Probleme, oberste Priorität. Seit der Verabschiedung dieses Programmes wurden herkömmliche Notschlafstellen ausnahmslos in Einrichtungen für betreutes Wohnen umgewandelt, in den eine unabhängige Lebensgestaltung ermöglicht und entsprechend gefördert wurde.
Das besondere hierbei ist, dass sich nicht auf die Verwaltung, sondern auf die Verminderung, Beendigung sowie Vorbeugung der Wohnungslosigkeit konzentriert wurde. (vgl. Kipp 2013: 106f.)
Das Prinzip des „Housing First“ verschaffte innerhalb eines kurzen Zeitraumes 1250 zusätzliche Unterkünfte, betreute Wohneinheiten sowie sonstige begleitete Wohnplätze. Die Kosten wurden zu 50% von der finnischen Regierung getragen, die andere Hälfte wurde von den zehn größten von Wohnungslosigkeit betroffenen Städten getragen. Bemerkenswert ist hierbei, dass die grundlegende Instandsetzung von Schlafstellen und ihre Umwandlung in betreute Wohneinheiten vom finnischen Spielautomatenverband gefördert wurde (vgl. ebd. 107).
Die Einführung einer „Housing First“ wäre für Deutschland eine Möglichkeit der gegenwärtigen Wohnungslosigkeit entgegenzuwirken. Die Bereitstellung bzw. Ermöglichung einer Unterkunft ist der erste Schritt einer gefährdeten oder bereits betroffenen Person zu helfen. Aus dieser gesicherten Unterbringung gehen dann weitere Prozesse, wie eine psychische Beratung, die Arbeitsplatzsuche, aber auch die Pflege von Kontakten und Beziehungen hervor. Darüber hinaus bedarf es einer Erhaltung des Wohnraumes im Innenstadtbereich für Personen mit einem niedrigen Einkommen (vgl. ebd.: 110). In vielen Fällen sind dies Personen, die im unteren Bereich des Sozialen Raumes positioniert sind.
Um bezahlbaren Wohnraum langfristig bereitstellen zu können und die bestehende Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, bedarf es einem gemeinnützigem Wohnungsbausektor. Entscheidend ist hierbei der Bund, der den Rahmen und die Instrumente für solch einen gemeinnützigen Sektor schafft. Jede einzelne Kommune und jeder einzelne Landkreis muss diese politische Entscheidung, die Prävention von Wohnungsverlusten, unterstützen, da das Phänomen der Wohnungslosigkeit, so wie es die alarmierenden Zahlen des BAG W belegen, bundesweit besteht (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2019: 3).
8. Literaturverzeichnis
-Anhorn, Roland/ Balzereit, Marcus (Hrsg.)(2016): Handbuch Therapeutisierung und Soziale Arbeit. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
-Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (2001): Grundsatzprogramm der BAG Wohnunglosenhilfe. Bielefeld, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.
-Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (2019): Pressemitteilung. Bielefeld, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.
-Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (2010): Statistikbericht 2008. Bielefeld: Eigendruck.
-Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (2011): Statistikbericht 2009. Bielefeld: Eigendruck.
-Barlösius, Eva (2004): Kämpfe um soziale Ungleichheit. Machttheoretische Perspektiven. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
-Bauer, Ullrich (2012): Sozialisation und Ungleichheit. Eine Hinführung. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
-Bourdieu, Pierre (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 1. Auflage. Suhrkamp: Taschenbuch Wissenschaft.
-Bourdieu, Pierre (1993): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vemunft, Frankfurt/M.: Suhrkarnp.
-Bourdieu, Pierre (1997): Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital. In: Ders. (Hrsg) Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik und Kultur 1. VSA-Verlag, Hamburg.
-Bourdieu, Pierre 1998: Praktische Vemunft. Zur Theorie des Handelns, FrankfurtlM.: Suhrkamp
-Geißler, Rainer (2006): Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Bilanz zur Vereinigung. 4. Auflage. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
-Gerull, Sabine (2018): 1. systematische Lebenslagenuntersuchung wohnungsloser Menschen. Eine Studie der ASH Berlin in Kooperation mit Gerull 2018 e.V.
-Häußermann, Hartmut (Hrsg.)(1998): Großstadt. Soziologische Stichworte. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
-Kipp, Almut (2013): >>Alltagswelten<< obdachloser Frauen. Theaterpädagogik als Methodik der (Re)Integration. Freiburg: CENTAURUS Verlag & Media KG.
-Lenger, Alexander/ Schneickert, Christian/ Schumacher, Florian (Hrsg.)(2013): Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus. Grundlagen, Zugänge, Forschungsperspektiven. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
-Neupert, Paul (2018): Statistikbericht 2017 der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. Bielefeld: Eigendruck.
-Von Paulgerg-Muschiol, Larissa (2009): WEGE IN DIE WOHNUNGSLOSIGKEIT. Eine qualitative Untersuchung. Dissertation zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Philosophie. Wörthsee.
-Rudolph, Steffen (2019): Digitale Medien, Partizipation und Ungleichheit. Eine Studie zum sozialen Gebraucht des Internets. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
-Schröder, Helmut (2005): Statistikbericht 2003 der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. Bielefeld: Eigendruck.
-Werner, Walter(1999): Armut und Obdachlosigkeit in der Kommune. In: Wollmann, H./ Roth, Roland (Hrsg.)(1999): Kommunalpolitik. Politisches Handeln in den Gemeinden. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
-https://soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/view/243/367, aufgerufen am 01.01.2019, um 21:24 Uhr.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es handelt sich um die Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften an der Leibniz Universität Hannover, die eine Analyse der Wohnungslosigkeit in Deutschland anhand der Theorie des Sozialen Raumes von Pierre Bourdieu darstellt.
Was sind die Hauptthemen dieses Dokuments?
Die Hauptthemen sind Wohnungslosigkeit, die Theorie des sozialen Raumes nach Pierre Bourdieu (einschließlich Kapitalvolumen, Habitus und Machtkämpfe im Feld), Methodik (qualitative und quantitative Studien) und eine Analyse der Wohnungslosigkeit im sozialen Raum.
Welche Definition von Wohnungslosigkeit wird verwendet?
Wohnungslose sind unter anderem Heim- oder Haftentlassene sowie Personen oder Familien, die keiner Kommune zuzuordnen sind, ihren Aufenthalt regelmäßig wechseln und keine offizielle Meldeadresse besitzen. Diese Personen können sich keine eigene Wohnung leisten.
Welche Ursachen für Wohnungslosigkeit werden genannt?
Die Ursachen sind vielfältig und umfassen Mietschulden, Armut, Arbeitslosigkeit, steigende Mietpreise, Krankheiten, familiäre Ereignisse wie Scheidung oder Trennung sowie ein geringes Bildungsniveau.
Welche Rolle spielt die Theorie des Sozialen Raumes nach Bourdieu bei der Analyse der Wohnungslosigkeit?
Die Theorie des Sozialen Raumes ermöglicht es, Gesellschaftsgruppen anhand ihres Vermögens an Kapitalsorten (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) innerhalb eines Koordinatenkreuzes zu positionieren. Dies hilft bei der Analyse der Lebensbedingungen und Machtverhältnisse.
Welche Kapitalsorten werden unterschieden und wie beeinflussen sie die soziale Position?
Es werden drei Kapitalsorten unterschieden: ökonomisches Kapital (materieller Reichtum), kulturelles Kapital (Bildung, Wissen, Fähigkeiten) und soziales Kapital (Beziehungen und Netzwerke). Ein hoher Besitzanteil an diesen Kapitalsorten verschafft eine Position im oberen Abschnitt des Sozialen Raumes, während ein geringer Besitzanteil zu einer Positionierung im unteren Abschnitt führt.
Welche Methodik wird angewendet, um die Wohnungslosigkeit im Sozialen Raum zu analysieren?
Die Analyse basiert auf einer Kombination von qualitativen (Interviews) und quantitativen (statistische Erhebungen) Studien. Qualitative Studien (z.B. von Larissa von Paulgerg-Muschiol) liefern Einblicke in die Lebensverläufe, während quantitative Studien (z.B. von der ASH Berlin und BAG W) repräsentative Daten liefern.
Welche Erkenntnisse werden aus den qualitativen Studien gewonnen?
Die qualitativen Studien zeigen, dass viele wohnungslose Personen zuvor ein "normales" bürgerliches Leben geführt haben. Der Verlust des Wohnraums wird oft durch einschneidende Schicksalsschläge ausgelöst, wie z.B. Scheidung oder der Verlust der Familie.
Welche Erkenntnisse werden aus den quantitativen Studien gewonnen?
Die quantitativen Studien zeigen, dass Wohnungslose oft ein geringes ökonomisches und kulturelles Kapital besitzen. Ein Großteil ist arbeitslos und verschuldet. Das soziale Kapital ist oft gering, viele haben wenige unterstützende Kontakte. Junge Erwachsene und Menschen mit Migrationshintergrund sind zunehmend betroffen.
Wie wird die Dynamik der Wohnungslosigkeit in den Studien dargestellt?
Die Dynamik bezieht sich auf die Prozesse des Ein- und Ausstiegs aus der Wohnungslosigkeit. Studien zeigen, dass die Dauer der Wohnungslosigkeit variiert und dass viele Personen wiederholt wohnungslos werden. Es gibt auch Unterschiede in der Bewertung der Lebenslage je nach Dauer der Wohnungslosigkeit.
Welche Schlussfolgerungen werden in Bezug auf die Implikationen für die Praxis gezogen?
Es wird betont, dass die schnelle Beendigung der Wohnungslosigkeit durch gezielte Unterstützungsangebote entscheidend ist. Es wird auch die Einführung von "Housing First"-Ansätzen und der Aufbau eines gemeinnützigen Wohnungsbausektors gefordert, um bezahlbaren Wohnraum langfristig bereitzustellen.
Was ist "Housing First"?
"Housing First" ist ein Ansatz, bei dem wohnungslose Menschen zuerst eine Wohnung erhalten, ohne vorher bestimmte Bedingungen (z.B. Drogenfreiheit) erfüllen zu müssen. Die Wohnung wird als Basis für weitere Unterstützungsleistungen (z.B. Suchtberatung, Arbeitsplatzsuche) betrachtet.
Welche Literatur wird in dem Dokument zitiert?
Das Dokument zitiert eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten und Berichten, insbesondere von Bourdieu, Anhorn, Balzereit, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W), Geißler, Gerull, Häußermann, Kipp, Lenger, Schneickert, Schumacher, Neupert, Von Paulgerg-Muschiol, Rudolph, Schröder und Werner.
- Arbeit zitieren
- Enno Webermann (Autor:in), 2020, Wohnungslosigkeit im Sozialen Raum nach Pierre Bourdieu, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012777