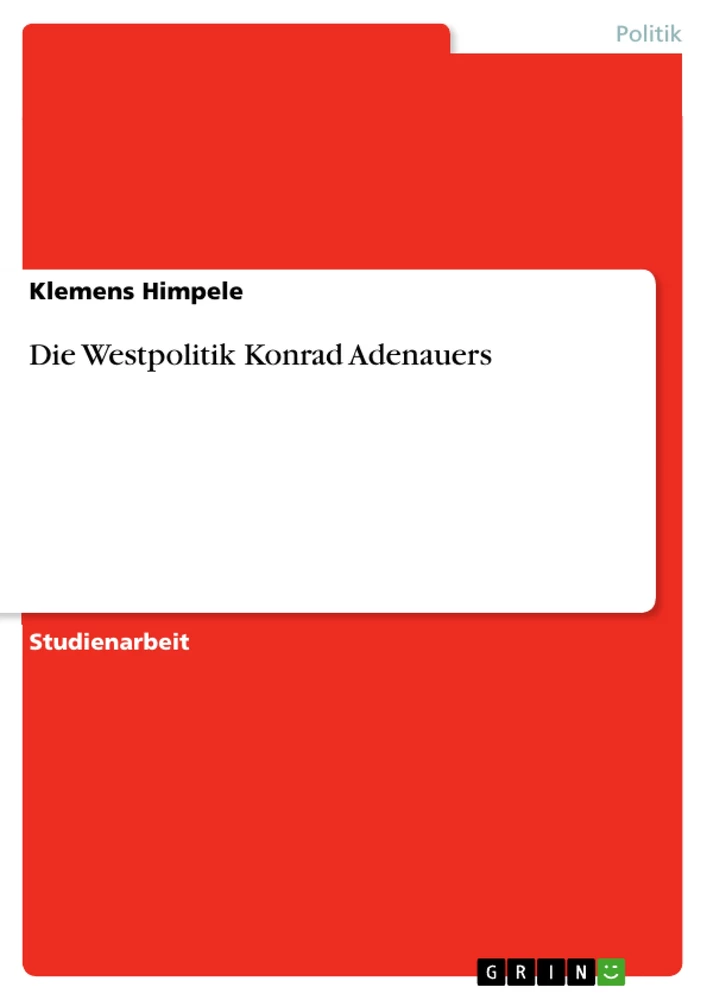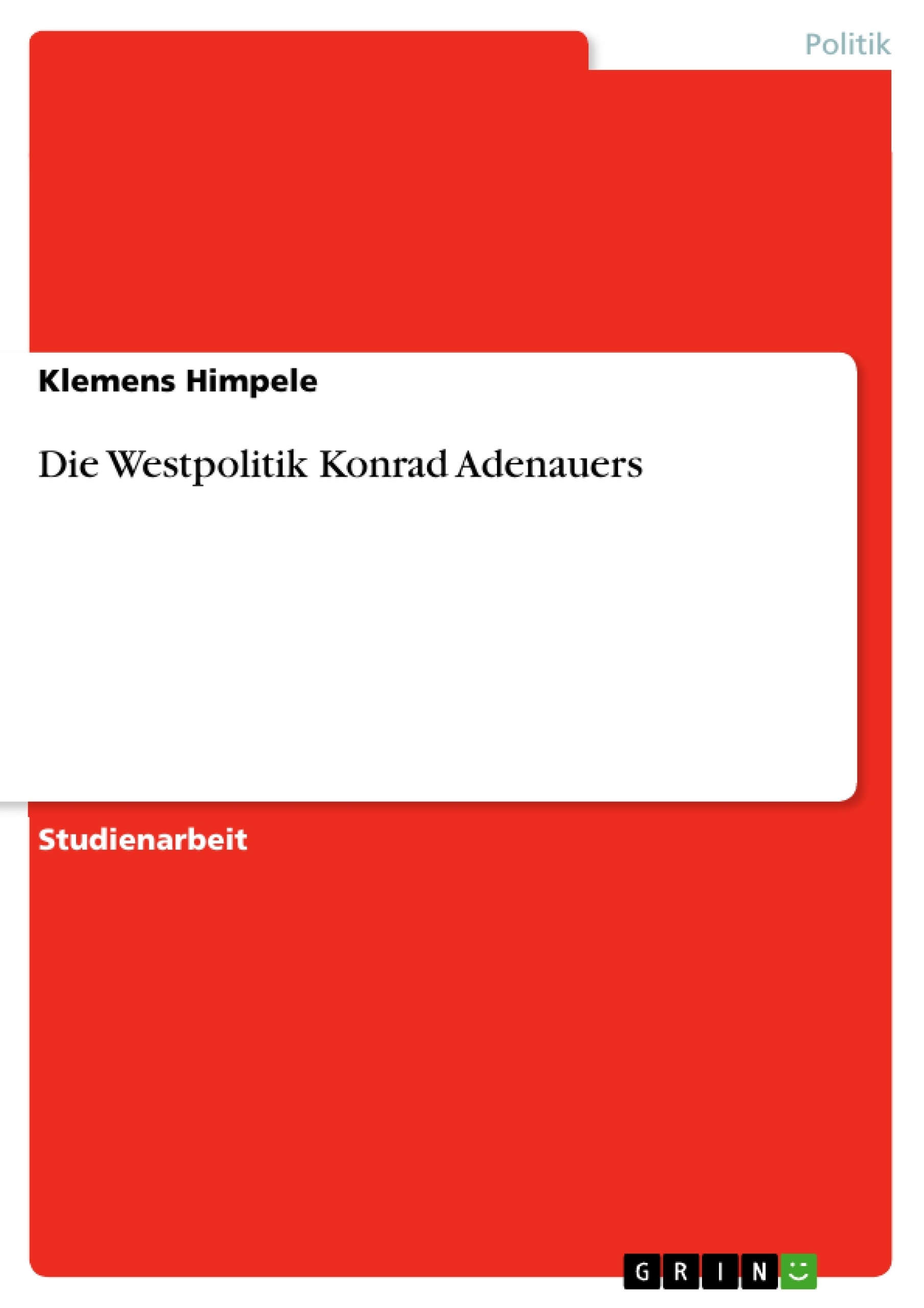0. Vorbemerkungen
Eine Hausarbeit über eine Persönlichkeit wie Konrad Adenauer zu schreiben birgt nicht das Problem der Literaturbeschaffung sondern das Problem der Literaturauswahl. Man kann über eine vierzehnjährige Kanzlerschaft Bibliotheken füllen, so dass eine klare Eingrenzung des Themas von Nöten ist. Deshalb reduziert sich die vorliegende Arbeit auf die außenpolitischen und für die Politik der Westintegration relevanten Gebiete. So sollen zunächst die Voraussetzungen für Adenauers Politik untersucht werden. Wie stand der Westen Deutschlands nach dem Kriege da? Welche Fähigkeiten musste der erste deutsche Bundeskanzler mitbringen?
Im zweiten Kapitel geht es dann um die Interessen Adenauers und um die Interessen der Alliierten, im besonderen der Westalliierten. Im dritten Abschnitt wird es um die vertragliche Festschreibung der Westintegration gehen. Hierbei kann es nicht Ziel einer Hausarbeit sein, die ganzen Verträge im chronologischen Ablauf darzustellen. Es würde auch den Rahmen sprengen, die Interessen aller Akteure bei der Entstehung dieser Verträge zu beschreiben. Vielmehr will ich versuchen, die wesentlichen Entwicklungen der Westbindung im Bezug auf die Leistungen Adenauers zu erläutern. Die Opposition wird daher nur am Rande behandelt.
Im vierten Abschnitt dieser Arbeit soll untersucht werden, ob es Alternativen zur Westbindung gab. Kritisch soll der Frage nachgegangen werden, ob ein weniger dogmatischer Antikommunismus Adenauers die Teilung Deutschlands hätte verhindern oder verkürzen können.
Im letzten Abschnitt geht es schließlich um ein Fazit der Regierungszeit Adenauers und um die Betrachtung der westdeutschen Entwicklung in der Regierungszeit Adenauers. Was hat sich in Deutschland geändert, wie steht die Bundesrepublik nun im Kreis der Nationen da?
1. Voraussetzungen 1949
Um die Leistungen und Fehler Konrad Adenauers zu bewerten, muss man die Ausgangslage seiner Politik mit dem Ergebnis seiner Politik vergleichen. Deshalb wird die Hausarbeit mit einer kurzen Betrachtung der Situation Deutschlands im Jahre 1949 beginnen.
Nach dem Ende des 2.Weltkrieges war Deutschland ein international isoliertes und geächtetes Land. Die Deutschen wurden von den Besatzungsmächten regiert und hatte selbst keine Entscheidungsbefugnisse. Deutschland war politisch und - durch die Aufwendungen und die Zerstörungen des Krieges - wirtschaftlich am Boden. Ein „Normaljahr 1937“, zu dem man zurück gekonnt hätte, gab es erstens nicht und hätte zweitens den schlimmen Verbrechen der Nationalsozialisten nicht Rechnung getragen. Zudem hatten sich die Koordinaten auch in der internationalen Politik verschoben, so dass eine grundlegende Neuorientierung von Nöten war. „Das Konzert der europäischen Großmächte war zu Ende1 “. Die ehemaligen Großmächte wurden abgelöst durch Supermächte, die durch die Erfindung der Atombombe in der Lage waren, die Menschheit als solche zu bedrohen. Diese neuen Koordinaten und die Tatsache, dass die beiden Supermächte USA und UdSSR gleichzeitig universelle und gegensätzlich Ideologien vertraten, machte die Entwicklung neuer diplomatischer Arbeitsweisen nötig. Schon bald nach Ende des Krieges traten die unterschiedlichen ordnungspolitischen Vorstellungen der Supermächte zu Tage.
Zwar dachte man nach dem Krieg wohl daran, „die große Allianz des Krieges auch im Frieden fortzuführen“2, doch schon bald zeichnete sich eine Teilung Deutschlands , Europas und der Welt ab. Es ist nicht genau zu fassen, „wann der point of no return war, aber Ende 1947 waren sowohl in der SBZ3 wie auch in den westlichen Besatzungszonen (...) die Voraussetzungen für zwei getrennte Staaten geschaffen worden.“4
Die Teilung der Welt in zwei Blöcke hatte sich manifestiert, als Konrad Adenauer erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wurde. Er musste mit Mut, Fingerspitzengefühl, Gespür für das Machbare und Diplomatie das nach dem Nationalsozialismus zurecht verachtete Deutschland zurück in den Kreis den Nationen bringen.
2. Strategische Ziele und Gründe der Westbindung
In diesem Abschnitt soll untersucht werden, was Adenauers außenpolitische Ziele waren, ob die Westbindung opportunistisch war und inwieweit die Westbindung den Interessen der Alliierten, insbesondere der Westalliierten entsprach.
2.1 Adenauers Ziele und Interessen:
„Aufs ganze gesehen dürfte Adenauers Antikommunismus und Russland-Furcht die zentralen Triebkräfte seiner Außen- und Europapolitik gewesen sein.“5 Damit ist die Hauptmotivation Adenauers in der Außenpolitik beschrieben. Er war davon überzeugt, dass sich die Bundesrepublik Deutschland von Russland entfernen und dem Westen zuwenden musste, um seine politische Eigenständigkeit wieder zu gewinnen. Es soll hier noch einmal betont werden, dass die „deutsche Außenpolitik nach 1945 keine Frage von Möglichkeiten [war], denn Deutschland unterlag zunächst dem Diktat der Sieger.“6 Adenauers erste Aufgabe bestand also darin, das Vertrauen der Westalliierten zu gewinnen um sich die Möglichkeit aktiven Gestaltens zu eröffnen. Die darauf folgende Entwicklung „war nicht allein das Ergebnis bewusster Entscheidungen, sondern wurde durch spezifische weltpolitische Konstellationen und Ereignisse begründet.“7
Was aber war nun Adenauers Stärke gegenüber den anderen Politikerinnen und Politikern der damaligen Zeit? Warum gewann gerade er selbst das Vertrauen der westlichen Sieger, was seinem innenpolitischen Gegenspieler Kurt Schumacher nie gelang? Sicherlich, Adenauer hatte, wie alle anderen auch, keinen Meisterplan8 in der Tasche. Die Richtung des Weges, den er gehen wollte, war ihm aber bekannt und macht in allen anderen überlegen. Des Weiteren verstand es Adenauer geschickt, sich den Westalliierten als besten deutschen Bundeskanzler zu verkaufen.
„Unausgesprochen, aber deutlich erkennbar, war er erst einmal auf dem Weg zur Gleichberechtigung zu einer Politik der Vorleis tungen entschlossen. In der Terminologie der zwanziger Jahre konnte man auch von »Erfüllungspolitik« sprechen.“9 Dies alles aber diente nur dem Ziel der deutschen Gleichberechtigung in Einheit und Freiheit. Es wäre demzufolge falsch, „Adenauer als bloßen Opportunisten abzutun, der im Verzicht auf eine eigenständige deutschen Willen sich den Siegern als Statthalter angeboten hätte“. Adenauers Linie gab es schon vorher, ehe die Alliierten zu seinen Verbündeten hätten werden können.10 Spitz formuliert kam ihm die Geschichte entgegen. Für Adenauer sprach - aus dem Blickwinkel der westlichen Sieger - dass er wie kein anderer den Sicherheitsbedürfnissen der Alliierten und im besonderen Frankreichs Rechnung trug. Des weiteren teilte er die Russland-Furcht mit den westlichen Nachbarn. In Russland sah der Bundeskanzler die Reinkarnation des Bösen schlechthin, was dogmatisch übertrieben ist aber durchaus der Gefühlslage des Westens in dieser Zeit entsprach.. „Sowjetrussland“ sei nur darauf aus, Europa in Unruhe zu versetzen „in der Hoffnung, dadurch seinen Machtbereich über Deutschland, Frankreich und die kleinen Länder bis an das Meer und dann auf England ausdehnen zu können,“11 so Adenauer über die UdSSR. „Ihr Ziel ist die Beherrschung der Welt durch den Kommunismus.“12 Da sich ein zerstörtes Land wie die Bundesrepublik Deutschland aber nicht gegen eine Expansionsmacht wie Russland wehren könne, kam ein Neutralität Deutschlands für Adenauer nicht in Frage. Neutralisierung hieß für ihn Sowjetisierung13. Um sich zu schützen und die Freiheit zu bewahren konnte es in der Sichtweise Adenauers also nur eine Integration nach Westen geben. Und „wer Solidarität erwartet, der muss sich auch solidarisch verhalten.“14 Diese Grundhaltung Adenauers hat die deutsche Außenpolitik bis heute geprägt und prägt sie weiter.
Ein weiteres Ziel Adenauers bezogen auf seine Politik der Westbindung war die Wiedervereinigung Deutschlands. Er glaubte, dass eine „Politik der Stärke“ des Westens und Westdeutschlands eine solche Anziehungskraft auf die DDR ausüben werde, dass die Wiedervereinigung die logische, quasi-kausale Konsequenz sein müsse. Auch glaubte Adenauer zu wissen, dass die Wiedervereinigung in Friede und Freiheit nicht vom „weltpolitischen Zwerg Deutschland“ erreicht werden konnte sondern nur im Zusammenhang mit der Bereinigung des Ost-West- Verhältnisses als Ganzes15. Der „Schlüssel zur Wiedervereinigung“ lag nicht in deutscher Hand sondern in Moskau und Washington.16 Zusammengefasst heißt dies, dass Adenauers Ziele in der Reihenfolge Freiheit - Friede - Einheit angeordnet waren17. Die Freiheit wollte er durch eine Integration der Bundesrepublik in ein westliches Bündnis erreichen, der Frieden sollte durch einen starken Westen gesichert werden und die Einheit käme dann als logischer Schluss automatisch. Diese Reihenfolge führte zu heftigen Kontroversen in Deutschland. : „Adenauers politische Gegner wie Jakob Kaiser, Kurt Schumacher, Gustav Heinemann, Thomas Dehler, Paul Sethe und andere waren fest davon überzeugt, dass Adenauer durch die Politik der Westbindung der Bundesrepublik letztlich die Spaltung
Deutschlands verewigen würde. Adenauer und seine politischen Freunde hingegen betonten die Notwendigkeit der Westbindung, weil durch die Politik der Sowjetunion die Spaltung Berlins, Deutschlands und Europas sowie der Welt unausweichlich geworden war.“18 Aus dieser Überzeugung rührte auch Adenauers Verständnis für den westdeutschen Staat her. „Je nachdem, aus welcher Perspektive man die Bundesrepublik betrachtete, konnte sie als souveräner Staat in spe, als Provisorium auf dem Weg zu einer Gesamtregelung zwischen den vier Deutschlandmächten oder als eine Art Protektorat mit einem starken Maß innerer Autonomie begriffen werden.“19 Adenauer begriff die BRD als souveränen Staat in spe, später dann als souveränen Staat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Adenauer aus einer tiefen Überzeugung heraus die Politik der Westbindung betrieb. Dadurch wurde er für die Westalliierten zum geachteten und berechenbaren Partner und hatte deren Unterstützung für die Wahlen. Ihm deshalb Opportunismus vorzuwerfen geht an der Sache vorbei, da die eigene Überzeugung eben nicht opportunistisch ist. Konrad Adenauer war der festen Überzeugung, dass die Westbindung Staatsräson ohne Alternative ist. Seine kompromisslose Politik der Westbindung muss mit dem Vorwurf leben, eine Hälfte unseres Staates schlichtweg im Stich gelassen zu haben.20. Die Frage, ob man vierzig Jahre DDR mit einem weniger dogmatischen Antikommunismus hätte vermeiden können, lässt sich nicht beantworten. Mit dieser Frage werde ich mich im Zusammenhang mit den Alternativen zur Westbindung auseinander setzen.
2.2 Die Interessen der Alliierten:
Ganz oben auf der politischen Agenda der Alliierten im Osten und im Westen Stand die Sicherheit vor Deutschland. Nach zwei Weltkriegen war es das erklärte Ziel der Sieger, Deutschland nicht mehr stark werden zu lassen. In dieser Gemütslage kam es zu verschiedenen Plänen der Alliierten, wie mit Deutschland zu verfahren sei. Der prominenteste ist der Morgenthau-Plan, der vorsah, Deutschland zu einem Agrarland zu machen. Von Seiten der UdSSR schlug Außenminister Molotow eine „völlige militärische und wirtschaftliche Abrüstung“21 Deutschlands vor. In den USA konnte sich der Morgenthau-Plan nicht durchsetzen. Man ging hier von einem „soziologischen Problem“ aus. Von Friedrich dem Großen über Bismarck bis hin zu Hitler wurde eine aggressive Disposition unterstellt. Diese Aggressivität wollte man den Deutschen aberziehen22.
Diese Einigkeit der Alliierten im Bezug auf Deutschland sollten sich - wie auch die Interessen der Siegermächte - bald ändern. Spätestens durch die Berlin-Blockade wurde die Interessendifferenz der Westalliierten und Russlands deutlich. Durch den Einsatz der USA für Westberlin wurde offensichtlich, dass sich das Verständnis und die Interessen auch im Westen geändert hatten. Westdeutschland wurde als Partner und als Schutzwall gegen den Kommunismus gebraucht und nicht mehr als unterlegener Feind. Die Westdeutschen ihrerseits hatten ein Interesse daran, nicht länger als besiegte angesehen zu werden. Der Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter (SPD) verknüpfte in seiner berühmten „Völker der Welt“- Rede geschickt westdeutsches und westalliiertes Schicksal, welches über gemeinsame Ideale, „die alleine unsere Zukunft und die auch allein eure Zukunft sichern können“ eng verknüpft sei.23.
Nach und nach hatte sich so auch die Einstellung der USA zu Deutschland geändert und spätestens mit der Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949 hatte sich „zumindest in den USA ein Kurs durchgesetzt, der von der Annahme langandauernder Gegensätze mit der Sowjetunion ausging und dementsprechend bestrebt war, die besiegten Kriegsgegner in die Gemeinschaft der freien Welt einzugliedern.“24 Die gleiche Entwicklung konnte man auch in Frankreich beobachten. Die Angst vor Deutschland war der Angst vor einer übermächtigen UdSSR gewichen. Als Puffer gegen den Osten wurde Westdeutschland gebraucht und die Angst, die Bundesrepublik der Sowjetunion in die Hände zu spielen führten zu einer Interessensentsprechung der Westalliierten und des westlichen Teils Deutschlands. Die BRD sollte in ein westliches Bündnis integriert werden, alleine schon, um sie nicht in feindliche Arme zu treiben. Das Konzept des Westens hieß Integration um die eigene Sicherheit zu gewährleisten und den antikommunsistischen Block zu stärken.
3. Vertragliche Festschreibung der Westbindung
Bevor mit dem Petersberger Abkommen die erste Festschreibung der Westbindung behandelt wird, sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Westmächte bis Mitte der 50-er Jahre das letzte Wort in der Außenpolitik behielten. „Im Rahmen dieser begrenzten Bedingungen lag bis Juni 1955 die außenpolitische Machtkonzentration bei Adenauer, die auffällig mit der strukturellen außenpolitischen Machtlosigkeit der Bundesrepublik der Anfangsjahre kontrastierte.“25 Adenauer musste mit den Alliierten Stück für Stück der Macht „zurückverhandeln“. Dabei kam ihm die weltpolitische Lage des Kalten Krieges entgegen. Die große Leistung des Kanzlers bestand darin, zur richtigen Zeit zuzugreifen. Die zentrale Funktion Adenauers in der Planung der Westalliierten zeigte nicht zuletzt, dass die Integration der BRD ein Ziel war, das in den Augen der Westalliierten leicht hätte verfehlt werden können.26 Deshalb war das Vertrauen in Adenauer so wichtig. Dieses Vertrauen konnte der Bundeskanzler durch eine klare, in einfache schwarz-weiß Bilder gefärbte Politik erlangen. Die Abgrenzung von „gut“ - dem Westen - und „böse“ - dem Osten - kam bei Adenauer aus tiefster Überzeugung und entsprach somit den Empfindungen der späteren Bündnispartner im Westen.
Innenpolitisch war Adenauer hingegen höchst umstritten. Vor allem die trotz des Marshall-Plans fortgeführten Demontagen verunsicherten die Bevölkerung. Sie stand zudem im krassen Widerspruch zu der geänderten Politik der Westmächte. Adenauer setzte sich in Deutschland an die Spitze einer Protestbewegung gegen die Demontagen, wohl wissend, dass sich deutsche Interessen nur durchsetzen ließen, wenn gleichzeitig die Integration der Bundesrepublik vorangetrieben wurde.27 Die deutsche Mitarbeit in der Ruhrbehörde war ein guter Preis, den Adenauer für den Stop der Demontagen zahlen konnte.
Die Ruhrbehörde war von den Alliierten eingerichtet worden, um die Kontrolle über die deutsche Stahlproduktion zu erhalten. Sie löste in Deutschland heftige Proteste aus, da dies eine eklatante Schwächung der deutschen Wirtschaft bedeutete. Sowohl die Regierungs- als auch die Oppositionsfraktionen im Bundestag lehnten eine Mitarbeit - und damit Legitimierung - in der Ruhrbehörde ab.
Als Adenauer nun die Idee mit dem Junktim von „Emanzipation und Integration“28 hatte, musste er zunächst sein Kabinett davon überzeugen. Die Beschreibung der Verhandlungen über das Petersberger Abkommen sollen auch dazu dienen, Adenauers Stil in der Außenpolitik zu exemplifizieren. Diese Passage beschreibt das, was man heute gerne als „Geheimdiplomatie“ Adenauers bezeichnet.
Seinem Kabinett erklärte Adenauer, dass die Ablehnung der Mitarbeit an der Ruhrbehörde einer Obstruktion gleichkäme, die man sich nicht leisten könne. Nachdem er sich so die Zustimmung gesichert hatte, sprach Adenauer unverbindlich davon, dass die BRD natürlich bereit sei, die Demontagen, die zur Sicherheit der Alliierten beitrugen, zu akzeptieren und das auch die Stahlproduktion dazu gehöre. Auf anderen Gebieten lehnte Adenauer Demontagen allerdings ab. Diese sollten auch als Konsequenz auf die nordamerikanischen Wirtschaftshilfen eingestellt werden. Um dies zu verwirklichen solle eine Kommission einberufen werden, während deren Beratungen die Demontagen ruhen sollten. Adenauer verknüpfte damit geschickt die ökonomischen Interessen und die Sicherheitsbedürfnisse Frankreichs mit den Interessen der Bundesrepublik, indem er Probleme in diesem Prozess auf eine höhere, internationale Ebene hievte und so auflöste.
Adenauer wusste bei dieser Idee die US-Amerikaner hinter sich, „nachdem die USA angesichts der Priorität ihrer antikommunistischen Strategie den deutschen Wunsch von Anfang an zu erfüllen bereit gewesen waren.“29 Auch die Engländer lenkten ein und nach weiteren vertrauensbildenden Maßnahmen auch Paris. Erst am Samstag 5.11.1949 wollte Adenauer nun die Fraktionsvorsitzenden konsultieren und stellte in seinen Memoiren belustigt fest, dass die Herren leider schon ins Wochenende gefahren waren. So gelang es dem „Alten vom Rhein“, dass weder die Bundesregierung noch der Bundestag entscheidend mitwirken konnten, als er die Paraphierung des Petersberger Abkommens erreichte. Adenauer hatte erklärt, dass das Petersberger Abkommen weder ein Vertrag noch ein Gesetz sei und damit der Zustimmung durch den Bundestag nicht bedürfe.
Das Petersberger Abkommen nun war ein „beachtlicher Erfolg“ für die Bundesregierung, wie es der französische Hohe Kommissar François -Poncet nannte.30 Es war das erste frei und auf gleicher Ebene ausgehandelte Abkommen der noch jungen Bundesrepublik. Adenauer hatte es geschafft - durch Kompromisse, „package deals “ und Diplomatie - den ersten Schritt in Richtung eines gleichberechtigten Regierungschefs zu tun. De r Westen begann, die Bundesrepublik als Akteur im internationalen System wieder ernst zu nehmen. Dass er dabei mit seiner „Geheimdiplomatie“ jede demokratische Spielregel missachtet hat, entzürnte nicht nur die Opposition. Es steht außer Frage, dass dieses Vorgehen unmöglich war. Viele Autoren werfen aber zu Recht die Frage auf, ob ein anderes Vorgehen damals überhaupt Sinn gemacht hätte. Man kann hier sicherlich geteilter Meinung sein. Dass die SPD sich übergangen fühlte und im Abkommen selbst einen Verrat an deutschen Interessen sah, verwundert nicht. Diese Auseinandersetzung war der Augenblick, indem der außenpolitische Konsens aller Parteien im Bundestag zerbrach.
Die Frage, inwieweit die deutsche Souveränität etwas selbstverständliches sei, das man von den Alliierten zu erhalten habe (Schumacher) oder ob man für diese Souveränität auch Eigenständigkeiten an die europäische Ebene abtreten müsse entzweite Sozial- und Christdemokraten. Die Linie der Unionsparteien war damit jedoch festgesteckt: Man wollte deutsche Eigenständigkeit erreichen, indem man Eigenständigkeit abgab. Dies heißt nichts anderes, als dass man im Gegenzug für Souveränität bereit war, sich immer weiter in ein gemeinsames Europa einzubinden. Ein weiterer Streitpunkt dieser Jahre war die so genannte „Saarfrage“. Hier ging es um die Zugehörigkeit des Saarlandes zu Deutschland, da Frankreich auf ein von der Bundesrepublik unabhängiges aber Frankreich wirtschaftlich verbundenes Saarland zielte. Diese Frage verhinderte auch den Beitritt der Bundesrepublik zum 1949 gegründeten Europarat. Da die Vereinigten Staaten aus weltpolitische Gründen auf das Tempo drückte, macht Adenauer klar, dass eine solche Integration der BRD in den Europarat nur mit Konzessionen an sein Land zu machen sei. Als sich die Saarfrage weiter zuspitzt, machte Adenauer den Vorschlag einer deutsch-französischen Union. Diesen Vorschlag greift der französische Außenminister Robert Schuman auf, indem er im Mai 1950 die Gründung einer Montanunion vorschlägt. Damit würden die wirtschaftspolitischen Fragen weniger wichtig und gleichzeitig würde der Einfluss von Paris auf die Saar zurückgehen. Adenauer war es zufrieden, da „der ohnmächtige und besiegte von 1945 (...) Frankreich zu einer grundlegenden Revision seiner Deutschlandpolitik veranlasst“ hatte.31 Mit dieser Strategie des Gebens und Nehmens integrierte Adenauer die Bundesrepublik immer stärker nach Europa und erreichte Gleichzeitig immer mehr Souveränität. Auch in der Frage der Wiederbewaffnung und des Deutschlandvertrages verfuhr Adenauer nach der alt bewährten Junktim-Politik, welche verschiedene politische Probleme verknüpfte und auf einer höheren,. Internationalen Ebene auflöste. So lehnten die Franzosen eine eigene deutsche Armee ab, mit einer europäischen Armee könnte man aber leben, wie der französische Europaabgeordnete André Philip meinte. Die Interessen des westlichen Nachbarn hatten sich geändert. „Die Sorge, sich gegen die Deutschen schützen zu müssen, war der bangen Frage gewichen, wie man sich zusammen mit den Deutschen gegen die Sowjets schützen könne“.32 Diese durch den Korea-Krieg angeheizte Debatte nutze Adenauer sehr geschickt, indem er die Last der Aufstellung einer Armee von mehr Gleichberechtigung Deutschlands abhängig machte. Er wollte einen „Preis“ dafür haben, wenn er die deutsche Bevölkerung vom Sinn der Aufstellung einer Armee überzeugen sollte.
Bald schon kristallisierte sich heraus, dass Frankreich dennoch Schwierigkeiten mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) hatte. So forderten die Franzosen z.B., dass jeder Akteur im Falle einer deutschen Wiedervereinigung aus der EVG aussteigen könne. Adenauer lehnte dies ab, da solch eine Bedingung Moskau geradezu einlade, die Wiedervereinigung gegen die EVG einzutauschen. Diese Aussagen macht einmal mehr Adenauers Primat der Westbindung - gegenüber der Wiedervereinigung - deutlich.
Auch wenn die EVG an Frankreichs Indochina-Interessen scheiterte33 hatte Adenauer es geschafft, das Thema deutsche Souveränität auf die Agenda zu heben. Mit dem Beitritt der BRD zur NATO 1955 und dem EVG-Ersatz der Römischen Verträge, EURATOM und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG / alle 1957) hatte Adenauer dieses Ziel de facto erreicht, auch wenn die BRD de jure erst 1990 volle Souveränität erreichte. Die Einbindung in ein westliches Bündnis war geschafft.
4. Kritik und Alternativen zur Westbindung
Die Frage, die immer mit der Westpolitik Adenauers einhergehen wird ist, ob man durch eine weniger dogmatische Haltung gegenüber dem Osten die Einheit Deutschlands hätte erreichen können unter gleichzeitiger Beibehaltung der demokratischen Grundstruktur des Westens. Das bekannteste alternative Konzept zur Westpolitik war die Betonung der „Brückenfunktion“ Deutschlands durch Jakob Kaiser (CDU) und den Publizisten Paul Sethe. Dieser schreibt 1966: „Keine Weltanschauung vermag die staatlichen Notwendigkeiten aufzuheben, die sich aus der geographischen Lage eines Landes ergeben. Deutschland gehört mit seinen staatspolitischen Grundanschauungen zum Westen. Aber es liegt in der Mitte Europas, am Rande der slawischen Welt, was heute bedeutet: der kommunistischen Welt. Es hat stets die Aufgabe gehabt, Mittler zwischen Ost und West zu sein. Die Zugehörigkeit zum Westen kann diese Aufgabe nicht auslöschen. Die bundesrepublikanische Politik hat sie verkannt.“34 Diese Alternative sah eine Neutralität Deutschlands vor, ohne die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufzuheben. Die Blockfreiheit war der zu bezahlende Preis für die Wiedervereinigung.
Die zweite, weniger bekannte Alternative kam vom Oppositionsführer Kurt Schumacher (SPD). Dieser betonte den Dreiklang zwischen Sozialismus, Demokratie und Nation. Die Wiedervereinigung war das oberste Ziel, welches man aber nicht um jeden Preis erreichen wollte. Schuhmacher sah sich und seine Partei auf Grund der Vergangenheit dabei zu Maximalforderungen berechtigt, übersah dabei aber oft die Sicherheitsinteressen der Alliierten. Konrad Adenauer fürchtete bei diesen Konzepten ein undemokratisches, zwangsneutralisiertes und außenpolitische schwankendes Deutschland, da er offensichtlich seinem Land die Stärke absprach, sich zwischen Ost und West zu behaupten.35 „Eine Großmacht wie das Deutsche Reich mochte Gleichgewichtspolitik mit unterschiedlicher Ausrichtung betreiben (...), ein strategisch schutzloses Land wie die Bundesrepublik aber ist auf dauerhafte Bündnissolidarität angewiesen“36. Dies war die feste Überzeugung des Kanzlers. Nicht zuletzt daher kam die oben schon angesprochene Trias von Freiheit, Friede und Einheit. Genau hier setzt dann auch die Kritik an Adenauers Politik an. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass es Adenauer in seinen einfachen schwarz-weiß-Denkschemata nicht möglich war, die Ansichten seiner politischen Gegner realistisch zu bewerten. Er entkräftete jeden Gegenvorschlag mit dem Totschlagargument, dass die Sowjetunion nur daran interessiert sei, ihren Machtbereich zu erweitern. „Politiker wie Gustav Heinemann und Thomas Dehler, hohe Militärs wie Bogislaw von Bonin und Günter Kießling, einflussreiche Publizisten wie Rudolf Augstein und Paul Sethe wären bereit gewesen, die Zugehörigkeit Deutschlands zur westlichen Verteidigungsgemeinschaft zur Disposition zu stellen, wenn auf diesem Wege das übergeordnete Ziel der Wiedervereinigung erreichbar gewesen wäre. Die Zugehörigkeit Deutschlands zum freiheitlichen System der westlichen Demokratien hätten sie allerdings um keinen Preis aufgegeben.“37 Diese Position schien Konrad Adenauer aber völlig unmöglich. Er warf seinen Gegnern vor, die Freiheit Deutschlands aufgeben zu wollen, nur um die Wiedervereinigung zu erreichen. Bei genauerer Analyse der Kritik an diesem national- neutralistischen Konzept wird aber schnell deutlich, dass viele der Kritiker die Einheit Deutschlands nicht nur für nicht realisierbar sondern für nicht wünschenswert hielten.38 Dies wurde mit unterschiedlichen Ansätzen begründet.
Robert Leicht ist der Meinung, dass die deutsche Einheit eine geschichtliche Ausnahmesituation war. Diese habe man verspielt. Loth dagegen erklärt, dass die Wiedervereinigung die Wahrscheinlichkeit eines atomaren Krieges erhöhen würde und Wehler ist der Auffassung, dass man den Deutschen in der DDR anders zur Freiheit verhelfen muss als durch die überholte Idee der Einheit.39 Auch Konrad Adenauer sah in der deutschen Wiedervereinigung mehr Gefahren als Chancen. Er „fürchtete durch die Wiedervereinigung Deutschlands negative Konsequenzen“40 Wie die Wahlen 1953 zeigten, folgte die absolute Mehrheit der Wähler diesen Auffassungen. Auch egoistische ökonomische Interessen der Bevölkerung dürften hier eine Rolle gespielt haben. Es ging ihnen nach dem einsetzenden „Wirtschaftswunder“ besser und diesen neu erworbenen Wohlstand wollte man nicht aufs Spiel setzen - auch nicht für die Einheit Deutschlands.
Als durch die Verträge mit dem Westen die Wiedervereinigung in weite Ferne gerückt war, wurde die Kritik an Adenauers Kurs zunehmend schärfer. Seine Politik der Westbindung muss mit dem Vorwurf leben, eine Hälfte unseres Staates schlicht im Stich gelassen zu haben.41 Rudolf Augstein, einer der härtesten Kritiker Adenauers, formulierte dies in seinem ihm eigenen Sarkasmus so: „Das Volk, das so gerne geführt werden möchte und das so stark ist auf Kosten anderer Völker, diesmal sogar auf Kosten der eigenen Landsleute.“42
In dieser Phase wurde erstmals die „Hörigkeit des Bundeskanzlers gegenüber dem Westen“43 thematisiert und hinterfragt. Es wurde strittig, „ob die deutschen Interessen tatsächlich so entschieden nach Westeuropa wiesen, wie Adenauer dies meinte.“44 Kritisierte wurde zum einen die nach Ablehnung der Stalin-Noten 1952 wohl endgültig verpasste Chance der Wiedervereinigung und zum anderen die damit verbundene Ankettung an den Westen. Deutschlands Kraft und Einfluss in Europa wuchs, indem es zum „Festlanddegen Amerikas“ - und damit zunehmend abhängiger von Amerika - wurde.45
Die Stalin-Noten bedeuten in der Tat einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Politik Adenauers. Dieser hatte es versäumt, die Frage des Preises46 für die deutsche Einheit zu stellen. Das Unbehagen darüber fraß sich nun immer weiter in das Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit ein und die Politik Adenauers hatte ihre Unschuld verloren. So forderten z.B. die FDP-Abgeordneten Pfleiderer und Dehler immer wieder, konkrete Gegenleistungen für die Wiedervereinigung anzubieten. Der status quo dürfe nicht betoniert werden. Die Position der Bundesregierung aber war, dass man prinzipiell das Recht der Deutschen einfordere und dafür keinen Preis zahlen müsse. Wenn man aber nicht bereit war, einen Preis zu zahlen, dann gab es eben keine Wiedervereinigung. Und dieses Schweigen zu der Frage des Preises, dieses dogmatische Verharren auf seiner Position macht Adenauer verwundbar. Er muss mit dem Vorwurf leben, kein großer Kämpfer für die deutsche Wiedervereinigung gewesen zu sein.
Seit dem Frühjahr 1952 ist die Diskrepanz zwischen Westbindung und Wiedervereinigung offensichtlich. Um keinen Zweifel an seiner Politik aufkommen zu lassen, betonte Adenauer immer häufiger, dass die Bundesrepublik ein Staat und das Grundgesetz eine Vollverfassung sei. „Die SPD kämpfte verbissen für das Provisorium. Sie sorgte sich in der Tat um Deutschland in den Grenzen von 1937 mehr als Adenauer, der sich das Recht genommen hatte, mit vollen Segeln und ohne Rücksicht auf die Entwicklung im anderen Teil Deutschlands nach Westen zu steuern.“47 Adenauers Haltung zu den Stalin-Noten war auch in der Bundesregierung nicht unbestritten. In einer höchst emotionalen Rede rechnete der Justizminister von 1952, Thomas Dehler (FDP) mit Adenauer ab, als er 1958 im Bundestag sagte: „Wenn wir überdenken, was wir 1952 ausgelassen haben - was war die Gegenbedingung damals? Verzicht auf EVG. - Verzicht auf den Vertrag. Hier hätte man eine Verhandlungsmöglichkeit gehabt. (...) Ich war Mitglied des Kabinetts. Der Bundeskanzler hat uns damals erklärt: Das ist ein Störungsmanöver. Genau das Gleiche, was er heute erklärt. Und ich hab, ich hab ihm vertraut, ich schäme mich. Ja, ich beneide den Heinemann wegen seines Mutes. Aber warum? Der Heinemann kannte seine Pappenheimer besser, der war ja in der CDU. Ich in meiner ja... war am Ende ein kleiner Mann, der glaubte, was dieser große, geniale Staatsmann sagt, sei richtig.“48 Diese Haltung, nichts für die Wiedervereinigung hergeben zu wollen, war Adenauers Politik so inhärent, dass der Bundeskanzler fest davon überzeugt war, eine Einigung Deutschlands nur durch eine „Politik der Stärke“ erreichen zu können. Die sich stetig verschlechternde Situation der Deutschen im Osten berührte in dabei kaum. Dem gleichen Denkmuster entspringt auch seine Erklärung für den Mauerbau, bei dem er es im Übrigen nicht einmal für nötig erachtete, sofort nach Berlin zu reisen. Er meinte der Mauerbaue sei die Quittung an die USA für die Aufgabe der „Politik der Stärke“, Man habe zu viel mit den Sowjetrussen geredet.49
5. Fazit
Die Westpolitik Adenauers wird immer mit Kritik und Lob zu bewerten sein. So wird seiner Politik immer anhängen, nichts für die Deutschen im Osten den Landes getan zu haben. Diese schienen ihn auf seinem Weg nach vorn, den er mit dem Westen Deutschlands zweifelsohne angetreten hatte, geradezu lästig zu sein. Es war Adenauer in seinem dogmatischen Antikommunismus nicht möglich, über seinen Schatten zu springen und ernsthaft in Verhandlungen mit der Sowjetunion einzutreten. Chancen dazu gab es genug, so zum Beispiel die Stalin-Noten. Mit dem Abzug aus Österreich bei gleichzeitiger Neutralisierung des Alpenstaates im Jahre 1954 wurde ein deutliches Signal an die Bundesrepublik gesandt: Neutralisierung heißt eben nicht Sowjetisierung. So oder ähnlich hätte man dies interpretieren können, so oder ähnlich interpretierten es auch viele Politiker/innen und Publizist/innen. Doch Adenauer war ein nicht kritikfähiger Kanzler, so dass er sich - wir kennen dieses Schema auch von Helmut Kohl - bei Angriffen keinen Millimeter bewegte, den Angreifer beschimpfte und neue Themen besetzt.50 Damit gelang es ihm zwar, sich schadlos an der Macht zu halten, er unterdrückte allerdings sinnvolle Debatten über Deutschland als Ganzes. Adenauer hatte sich für die Westbindung entschieden und war nicht bereit, diese Position auch nur eine Sekunde zu überdenken. Blickt man zurück auf Adenauers Amtsjahre, dann hat man manchmal den Eindruck, der alte
Mann hatte geradezu Angst vor der Einheit Deutschlands. Er war in diesem Punkt ein Visionär des Machbaren, aber ein Zauderer wenn es um die große Sache der deutschen Einheit ging.
Die Kritik an Adenauers Politik gen Osten verblasst oft gegenüber seinen anderen Leistungen. Mitte der fünfziger Jahre war die Bundesrepublik Deutschland dank des mutigen Zupackens gen Westen - hier konnte und wollte der Kanzler dies - ein wirtschaftlich blühendes, im Westen geachtetes und souveränes Land. Denkt man noch einmal zurück an die direkten Nachkriegsjahre so wird man schnell feststellen, dass Adenauers Leistungen auf fast allen Gebieten kaum zu unterschätzen sind. Westdeutschland hatte seinen Stolz und seine politische Überzeugungskraft zurückgewonnen. Man hatte sich wieder in den Kreis der Nationen eingereiht und konnte als gleichberechtigter Partner mit anderen Staaten verhandeln. Vergessen war der Hunger der Nachkriegsjahre, der durch das „Wirtschaftswunder“ und den dadurch beginnenden Wohlstand der Vergangenheit angehörte. Abgestreift waren die Fesseln der Unmündigkeit. Das Besatzungsstatut war aufgehoben, man lebte in Frieden mit den westlichen Nationen. Mit dem „Erbfeind“ Frankreich begann vorsichtig eine Freundschaft, zumindest gelang es Adenauer, den Grundstein hierfür zu legen.
Nimmt man diese Entwicklungen zusammen, so wird man schnell zu der Einsicht kommen, dass die Menschen im Westen Deutschlands einen ungeheuren Wandel erlebten und das Adenauer sich dafür verantwortlich zeichnete. Die bitteren Jahre des Krieges waren gerade vor einer Dekade vergangen, und Adenauer hatte mit seiner Junktim-Politik, seiner Überzeugungskraft und unter Mithilfe der weltpolitischen Entwicklung des Ost-West-Konfliktes entscheidend dazu beigetragen, dass Hoffnung in diesem Land keimte.
Den Osten hat Adenauer im Stich gelassen. Er hat dies nicht alleine zu verantworten, da die Gesellschaft im Westen deutlich zu verstehen gegeben hatte, wo die Prioritäten gesetzt werden sollen. Bert Brecht hatte recht als er schrieb: „Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral“: Hätte man von einem Staatsmann wie Adenauer in diesem einem Punkt mehr Mut und Courage erwarten können? Diese Frage wird sich wohl nie beantworten lassen. Fest steht nur, dass auch die Oppositionsparteien kein Konzept hatten, wie man die Wiedervereinigung umsetzt. Ideen freilich waren da, und diese hätte man beachten und weiterentwickeln können.
Das einzig ehrlich Fazit zu Adenauers Politik der Westbindung und der damit verbundenen Abschottung gegen den Osten stammt von Besson: „Man hätte alles auch anders machen können. Aber niemand kann wissen, ob es auch erfolgreich gewesen wäre.“51
[...]
1 Vgl. Waldemar Besson: Die Außenpolitik der Bundesrepublik - Erfahrungen und Maßstäbe, München 1970, S .21
2 ebenda Seite 23
3 SBZ - sowjetisch besetzte Zone
4 Christian Lanz: Hausarbeit für das Seminar „Einführung in die Sozialwissenschaften II“ bei Prof. Dörr, Sommersemester 1998
5 Winfried Baumgart: Adenauers Europapolitik 1945-1963. Hier zitiert aus: Günter Rinsche (Hrsg.): Frei und geeint. Europa in der Politik der Unionsparteien, Köln Weimar Wien 1997, S.13
6 Hacke, Christian: Die Entscheidung für die politische Westbindung nach 1945, in: Rainer Zitelmann, Karlheinz
Weißmann, Michael Großhei (Hrsg.): Westbindung. Chancen und Risiken für Deutschland, Frankfurt / Main Berlin 1993, S.129f
7 ebenda. Seite 130
8 Vgl.: Besson, Waldemar, S.57f
9 Hans-Peter Schwarz: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Band 2: Die Ära Adenauer 1949-1957, Stuttgart 1981, S.56
10 Vgl. Besson, S 59
11 zitiert nach Besson, Seite 60f
12 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): Freiheit, Wohlfahrt, Sicherheit für Deutschland und Europa. Regierungserklärung von Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer zur deutschen Außenpolitik vor dem deutschen Bundestag am 15. Dezember 1954, S.2
13 Vgl. Besson, S. 148f
14 Hans-Peter Schwarz: Die gezähmten Deutschen. Von der Machtbesessenheit zur Machtvergessenheit, Stuttgart 1985, S.24
15 Vgl.: Winfried Baumgart, in: Rinsche, Günter (Hrsg.) (Fußnote 4), S.18
16 Vgl.: Schöllgen, Gregor: Die Macht in der Mitte Europas. Stationen deutscher Außenpolitik von Friedrich dem Großen bis zur Gegenwart, München 1992, S.136
17 Vgl. Hacke, S.133
18 Hacke, S. 137
19 Schwarz: Geschichte der Bundesrepublik, S. 46
20 Vgl.: Herbst, Ludolf: Option für den Westen. Vom Marshallplan bis zum deutsch- französischen Vertrag, München 1989, S.126. Vgl. auch: Daniel, Jens (Pseudonym von Augstein, Rudolf): Gott schütze sie, mein Kanzler, in: Der Spiegel, Nr.38, 16.09.1953, S.4 und: Daniel, Jens: Wir Kriegsgewinnler, in: Der Spiegel, Nr. 43, 21.10.1959, S.22
21 Christian Lanz: Hausarbeit für das Seminar »Einführung in die Sozialwissenschaften II« bei Prof. Dörr, Sommersemester 1998
22 Vgl.: Besson: Die Außenpolitik der Bundesrepublik - Erfahrungen und Maßstäbe, München 1970, S. 28
23 Zitiert nach: Gazdar, Kaevan (Hrsg.): Reden die Deutschland bewegten (Kassette), Henstedt-Uelzburg, 1989
24 Hans-Peter Schwarz: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Band 2: Die Ära Adenauer 1949 - 1957, Stuttgart 1981
25 Hacke, S.135
26 Hahn, Karl-Eckhard: Westbindung unter Vorbehalten: Bonner Diplomaten und die Deutschlandpolitik von 1949- bis 1959, in: : Rainer Zitelmann, Karlheinz Weißmann, Michael Großhei (Hrsg.): Westbindung. Chancen und Risiken für Deutschland, Frankfurt / Main Berlin 1993,S.151
27 Vgl. Besson, S. 82-89 und Schwarz, Geschichte der Bundesrepublik, S. 61ff
28 Besson, S.84
29 ebenda
30 Vgl. Besson, S. 85
31 Besson: Die Außenpolitik der Bundesrepublik, S.93
32 ebenda S. 99
33 ebenda 151f
34 Sethe, Paul: Öffnung nach Osten. Weltpolitische Realitäten zwischen Bonn, Paris und Moskau., Frankfurt am Main 1966, S. 7
35 Vgl. Hacke, Christian, S. 139
36 Schwarz, Hans-Peter: Die gezähmten Deutschen, S.24
37 Zitelmann, Rainer: Neutralitätsbestrebungen und Westorientierung, in: , in: Rainer Zitelmann, Karlheinz Weißmann, Michael Großhein (Hrsg.): Westbindung. Chancen und Risiken für Deutschland, Frankfurt / Main Berlin 1993, S.182
38 Vgl.: Zitelmann, Rainer S. 182
39 Alle nach Zitelmann, Rainer S. 183
40 Hacke, S.139
41 Vgl.: Herbst, Ludolf: Option für den Westen. Vom Marshallplan bis zum deutsch- französischen vertrag, München 1989, S. 126
42 Daniel, Jens: Gott schütze sie, mein Kanzler, in: Spiegel, Nr. 38, 16.09.53, S.: Zitiert nach: Doler, Ingolf: Rudolf
Augstein, die deutsche Frage und die Westbindung, in: Rainer Zitelmann, Karlheinz Weißmann, Michael Großhein (Hrsg.): Westbindung. Chancen und Risiken für Deutschland, Frankfurt / Main Berlin 1993, S.203
43 Augstein, Rudolf, zitiert aus: Besson, Waldemar, Seite 95
44 Besson, Seite 95
45 vgl. ebenda. S.96
46 Vgl. dazu: Hahn, Eckhardt, S.155f und Besson, WaldemarS.135f
47 Besson, Seite 140
48 zitiert nach: Gazdar, Kaevan (Hrsg.): Reden die Deutschland bewegten (Kassette), Henstedt-Uelzburg, 198949 Vgl.: Schöllgen, Gregor: Die Macht in der Mitte Europas, S. 145
50 Vgl.: Leyendecker, Hans: Gelernt ist gelernt, in: Süddeutsche Zeitung, 29.6.2000, Seite 3
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit über Konrad Adenauer?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf Konrad Adenauers Außenpolitik und insbesondere auf seine Politik der Westintegration. Sie untersucht die Voraussetzungen für seine Politik, die Interessen der Alliierten und Adenauers, die vertragliche Festschreibung der Westintegration und mögliche Alternativen.
Welche Voraussetzungen sah Adenauer im Jahr 1949 für seine Politik?
Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg international isoliert und politisch sowie wirtschaftlich am Boden. Adenauer musste Deutschland nach dem Nationalsozialismus zurück in die Völkergemeinschaft führen.
Was waren Adenauers strategische Ziele bei der Westbindung?
Adenauers Hauptziel war es, die Bundesrepublik Deutschland vom Einfluss Russlands zu entfernen und sich dem Westen zuzuwenden, um die politische Eigenständigkeit wiederzugewinnen. Er glaubte, dass ein starker Westen und Westdeutschland die DDR anziehen und zur Wiedervereinigung führen würden. Freiheit, Frieden und Einheit waren seine Prioritäten.
Welche Interessen hatten die Alliierten an der Westbindung?
Die Alliierten hatten zunächst das Ziel, Deutschland nicht mehr stark werden zu lassen. Nach der Berliner Blockade änderte sich dies, und Westdeutschland wurde als Partner und Schutzwall gegen den Kommunismus gebraucht. Die Westalliierten hatten ein Interesse daran, die BRD nicht in die Hände der Sowjetunion zu spielen.
Wie wurde die Westbindung vertraglich festgelegt?
Das Petersberger Abkommen war ein erster Schritt, der die BRD als Akteur im internationalen System ernst nahm. Die deutsche Mitarbeit in der Ruhrbehörde war ein Preis, den Adenauer für den Stopp der Demontagen zahlte. Später folgten der Beitritt zur NATO und die Römischen Verträge.
Gab es Alternativen zur Westbindung?
Ja, es gab Alternativen wie die Betonung der "Brückenfunktion" Deutschlands durch Jakob Kaiser und Paul Sethe, die eine Neutralität vorsahen. Kurt Schumacher (SPD) betonte den Dreiklang zwischen Sozialismus, Demokratie und Nation, wobei die Wiedervereinigung das oberste Ziel war.
Wie steht die Hausarbeit zur Kritik an Adenauers Westbindung?
Die Hausarbeit thematisiert die Kritik, dass Adenauers Politik die Teilung Deutschlands verewigt habe und eine Hälfte des Staates im Stich gelassen wurde. Es wird diskutiert, ob durch eine weniger dogmatische Haltung gegenüber dem Osten die Einheit hätte erreicht werden können.
Was ist das Fazit der Hausarbeit zu Adenauers Politik?
Adenauers Politik wird als zwiespältig bewertet. Einerseits hat er Westdeutschland zu einem wirtschaftlich blühenden, geachteten und souveränen Land geführt. Andererseits wird ihm vorgeworfen, nichts für die Deutschen im Osten getan zu haben. Es wird betont, dass auch die Opposition keine überzeugenden Konzepte für die Wiedervereinigung hatte.
- Quote paper
- Klemens Himpele (Author), 2000, Die Westpolitik Konrad Adenauers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101271