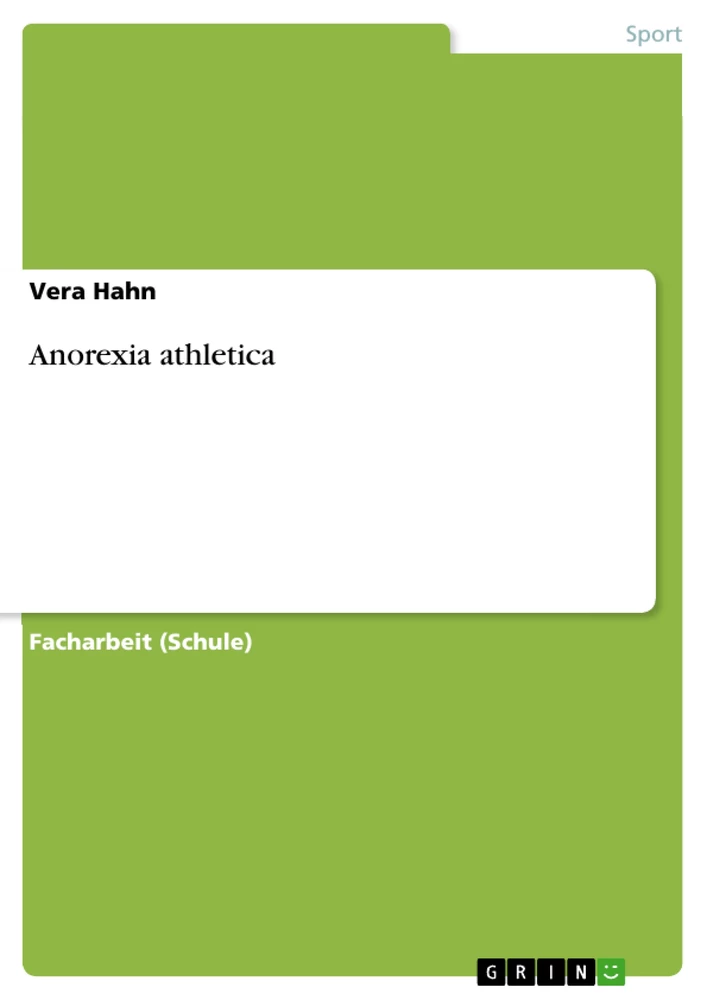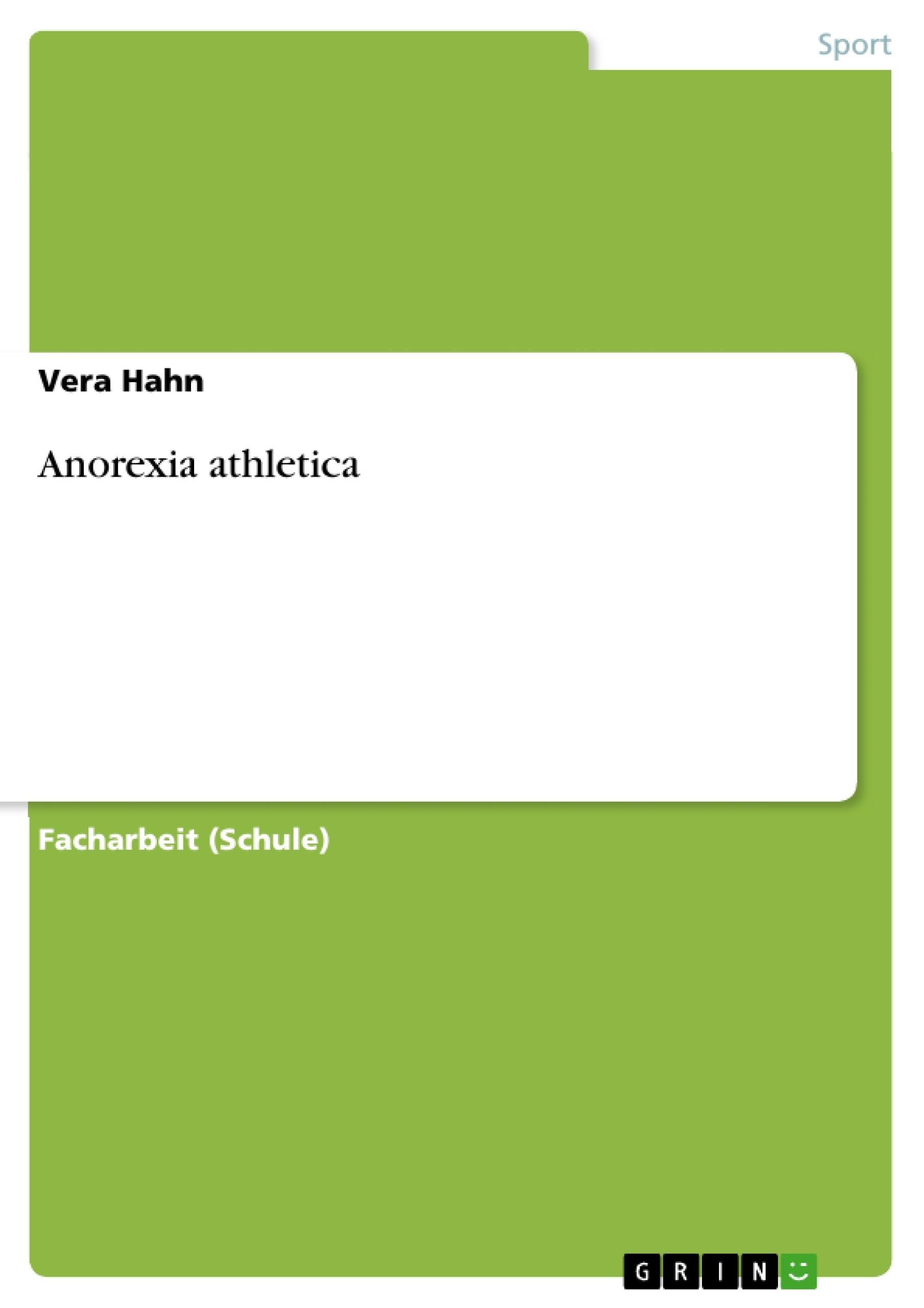Inhalt
0. Einleitung
1. Definitionen
1.1. Anorexie mit ihren unterschiedlichen Typen
1.1.1. Restriktiver Typ
1.1.2. Puring-Typ
1.2. Anorexia nervosa
1.3. Anorexia athletica
2. Vergleich von Anorexia athletica und Anorexia nervosa
2.1. Unterschiede
2.2. Übergang von Anorexia athletica zur Anorexia nervosa
2.3. Augenfällige Gemeinsamkeiten der beiden Fehlverhalten
3. Gefahren und gesundheitliche Folgen der Anorexia athletica
3.1. Knochenstoffwechsel
3.2. Hormonhaushalt
3.3. psychische Gesundheit
3.4. während der Pubertät
3.5. zusätzliche Risiken
4. Ätiologie der Anorexia athletica
4.1. Freudianische Theorie
4.2. Systemisch-familientherapeutische Theorie
4.3. Lerntheoretische Theorie
4.4. Neurochemische Theorie
5. Merkmale der Anorexia athletica
5.1. mögliche Frühsymptome
5.2. körperliche Veränderungen und Beschwerden im Zusammen- hang mit Anorexia athletica
5.3. Verhaltensmerkmale bei Anorexia athletica
6. Gewicht als Leistungsfaktor
6.1. Wie kommt es zu einem durch Untergewicht bedingten Leistungsrückgang?
6.2. Körperbewusstseinsproblematik
6.2.1. bei gemessener Leistung
6.2.2. bei bewerteter Leistung
7. Therapie von Anorexia athletica
7.1. Die zwei Phasen der Therapie
7.2. Sport als Heilmittel gegen Anorexie
8. Prävention von Anorexia athletica
8.1. durch Kontrolle
8.2. durch Aufklärung, Beratung und Unterstützung
8.3. durch das richtige Verhältnis zwischen Belastung und Energie- bedarf/Ernährung
9. Schlusswort
Anhang
Literaturverzeichnis
0. Einleitung
Sport ist die schönste Nebensache dieser Welt!
Das war einmal. Heute gilt mehr und mehr, dass Sport bei zunehmender Vermarktung der Athleten und boomender milliardenschwerer Zubehörin- dustrie zum Wirtschaftsfaktor Nummer Eins in unserer Freizeitgesellschaft wird.
Der klassische Amateur, der aus purer Liebe zu seinem Sport diesen mit Freu- den und mit Freunden ausübt, ohne nach kommerzieller Entlohnung und ge- sellschaftlicher Anerkennung zu schielen, ist selbst aus den Dörfern nahezu verschwunden.
Naturbestimmt erfüllt der Bewegungsapparat des Menschen eine Vielzahl von Funktionen. Dazu gehören die lebensnotwendigen Atembewegungen ebenso, wie die räumlichen Fortbewegungen, die von einfachen Ortsveränderungen bis zu komplizierten Bewegungsabläufen, wie z. B. im Eiskunstkauf, reichen. Das Streben nach vermarktbarer Perfektion in nahezu allen Sportarten führt heutzutage fast automatisch dazu, dass der Athlet seinen Körper und seine Seele diesem Ziel unterordnet.
Daley Thompson, das sportliche Multitalent, sagte einmal: ""Ich wollte eigentlich immer ein Star sein, jetzt bin ich´s und frage mich ständig, ob ich eigentlich noch mir selbst gehöre!""1
Diese Fremdbestimmung des Körpers führt zu einer bis heute noch wenig erforschten Folge: die "Anorexia athletica". Ist es einmal soweit gekommen, ist der Weg zurück zwar immer offen, aber immer schwer!
Die Probleme, die die Medizin, insbesondere die Sportmedizin mit diesem Fehlverhalten hat, wird spätestens beim Anblick der orientierungslos tau- melnden Schweizer Marathonläuferin Gabriela Andersen-Schiess auf der Ziel- geraden offenkundig. Der zynische Kommentar der Sportmediziner damals: ""Warum die Frau stoppen, wenn sie entschlossen ist ihr Rennen zu beenden ... - verdammt noch mal, dann lasst sie es doch tun!" - So einfach ist das."2
Noch wird es als leidige Nebenerscheinung des Leistungssportes akzeptiert, dass laut einer Studie des amerikanischen Colleges für Sportmedizin unter 62% der Sportlerinnen im Eiskunstlauf und im Turnen Essstörungen auftre- ten.3
Es gibt jedoch Ansätze hier einiges zu ändern. Das Internationale Olympische Komitee und der Internationale Schiverband ... "legen ihr ganzes Gewicht in die Waagschale, damit es in Zukunft Schwere leichter haben".4 In der Folge will ich aufzeigen, wie es zu der pathologischen Entwicklung im Umgang mit Leistungssport kommt und wie man diesen Teufelskreis durch- brechen kann.
1. Definitionen
1.1. Anorexie mit ihren unterschiedlichen Typen
"Anorexia, Anorexie, Asitie: Verlust des Nahrungstriebes; auch Appetitlosigkeit, Magersucht."5
Im Wesentlichen gibt es bei der klassisch beschriebenen Anorexie zwei Grundtypen.
1.1.1. Restriktiver Typ:
Hier findet die Gewichtsreduktion ausschließlich durch eine Verringerung der Nahrungsaufnahme oder das Meiden hochkalorischer Speisen statt.6
1.1.2. Puring-Typ:
Hier steht selbstinduziertes Erbrechen und der Missbrauch von Abführmitteln, wie Laxantien oder Klistiere, Entwässerungsmittel, z. B. Diuretika (harnstoff- treibend) oder stoffwechselsteigernde Mittel, z. B. Schilddrüsenhormone im Vordergrund.7
1.2. Anorexia nervosa
Sie ist eine "organisch unbegründete endogene, auf psychischer Fehlhaltung beruhende Appetitlosigkeit, die zu Magersucht und einer - evtl. tödlichen - Kachexie führt und von sekundärer Schilddrüsen-, Nebennieren- und Keimdrüsenunterfunktion begleitet ist; tritt vor allem bei Mädchen in der Pubertät und bei jungen Frauen auf." 8
1.3. Anorexia athletica
Sie ist eine Anorexie in engem Zusammenhang mit der intensiven Ausübung verschiedener Sportarten.
Bis heute ist Anorexia athletica keine eigene medizinisch anerkannte Diagnose. Ohne Zweifel ist sie jedoch ein ernstzunehmendes, immer öfter auftretendes Problem, das zunehmend mit der Anorexia nervosa gleichzusetzen ist, und damit zur Krankheit wird. Die Grenzen dabei sind fließend.
2. Vergleich von Anorexia athletica und Anorexia nervosa
2.1. Unterschiede
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten9
2.2. Übergang von Anorexia athletica zur Anorexia nervosa
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Trotz der unterschiedlichen Parameter spricht man von einer anorektischen Reaktion im Sinne einer Anorexia athletica, welche selbst aber, im Gegensatz zur Anorexia nervosa, heute noch nicht zu den psychiatrischen Erkrankungen gezählt wird.10 Die Gefahr, dass sich die Gewichtsreduktion auch hier ver- selbstständigt und der Betroffene in das Vollbild der Magersucht abgleitet ist jedoch relativ hoch. Ist man erst einmal in solch einem Teufelskreis gefangen, ist ein Entkommen nur noch mit fachmedizinischer Hilfe durch einen guten Therapeuten möglich.
2.3. Augenfällige Gemeinsamkeiten der beiden Fehlverhalten
a) Sowohl im Leistungssport, als auch bei anorektischen Krankheiten finden wir eine starke Selbstbezwingung, oder gar ein asketisches Benehmen, bei welchem ein Raubbau am Körper statt findet. Eine einseitige gesundheitsschä- digende Beanspruchung wird billigend in Kauf genommen. Diese einseitige körperliche, geistige und auch emotionale Belastung führt oft durch das Bilden eigener Ideologien zu einer, die Gesamtsituation weiter verschlechternden, Isolation.
b) Egozentrik, also eine starke Ich-Bezogenheit, ist eine Eigenschaft des Anorexiepatienten und auch häufig unter Spitzensportlern zu finden.
c) Bei beiden Fehlverhalten kann es leicht zu dem Gefühl kommen, dazu ge- drängt zu werden, sich oder auch anderen etwas beweisen zu müssen. Mager- süchtige fühlen sich gezwungen, immer noch dünner zu werden. Leistungs- sportler stehen unter dem Druck immer mehr Erfolge zu bringen. Bei beiden wird erwartet, dass diese ihnen Anerkennung einbringen, welche für sie sehr wichtig ist.
d) Der Erfolg ist das einzige was zählt. Er wird zum Gradmesser für Werte und Gefühle. Bei den einen besteht der Erfolg im extremen Abnehmen, bei den anderen ist es der große Sieg. Bei beiden lösen Misserfolge Depressionen, Minderwertigkeitskomplexe oder sogar Selbsthass aus.
e) Für beide gilt dies: Fanatische Kontrolle über dem eigenen Körper wird zum zwanghaften Lebensziel.11
3. Gefahren und gesundheitlich Folgen der Anorexia athletica
Die Gefahren und gesundheitlichen Folgen einer Anorexia athletica sind von der Dauer des Mangelstoffwechsels abhängig. Je länger er anhält, desto schlimmer und lebensbedrohlicher werden die Folgen insbesondere auch für das Skelett, den Hormonhaushalt und natürlich auch die psychische Gesund- heit.
3.1. Knochenstoffwechsel
Die geringe Zufuhr von Nährstoffen kann zu einem Östrogenmangel im Körper führen, welcher eine Osteoporose verursacht. Trotz des intensiven Körpertrainings nimmt die Knochendichte und die Knochenmasse ab. Die Feinstruktur im Knochen ändert sich und es kann leichter zu Ermüdungsbrüchen, oder Spontanfrakturen kommen.
Besonders der Oberschenkelhals ist, wie man es sonst nur bei alten Menschen sieht, gefährdet schon bei geringer Belastung zu brechen.
Auch Karies tritt als Folge der Veränderungen im Knochenstoffwechsel ge- häuft auf.
3.2. Hormonhaushalt
Durch die extrem hohe Belastung unter Mangelzufuhr von Nährstoffen gerät auch der Hormonhaushalt in Unordnung. Der Wachstumshormonspiegel unterliegt ebenfalls Schwankungen, was sich negativ auf das Körperwachstum auswirkt. Der Kortisolspiegel erhöht sich, was zur Folge hat, dass sich der periphere Metabolismus von Schilddrüsenhormonen ändert und Störungen der Insulinstoffwechselreaktionen hervorgerufen werden.
3.3. psychische Gesundheit
Ein ausgeglichener Hormonhaushalt, speziell bei Jugendlichen und Heranwachsenden, und psychische Gesundheit sind stets im direkten Zusammenhang zu betrachten.
Besonders gefährlich wird es dann, wenn sich bei ausbleibendem Erfolg der Gewichtsreduzierungsmaßnahmen Angstzustände entwickeln, die ihrerseits dann zu gesundheitsschädlichen Überreaktionen führen. So führt der Sport dazu, dass die jungen Menschen die ihnen zustehende Lebensfreude Schritt für Schritt verlieren , weil sie sich selbst um das unbeschwerte Ausleben ihrer Jugend bringen.
Hier ist das regelmäßig geführte Gespräch und eine einfühlsame, verstehende Führung des Gefährdeten unverzichtbar.
3.4. während der Pubertät
Während der Pubertät durchlaufen Kinder, die z. B. eine Turnerkarriere vor sich haben, ihre gesamte geistige und körperliche Entwicklung unter den begleitenden, äußerst belastenden Umständen eines intensiven körperlichen Trainings oft ohne die notwendige psychologische Betreuung.
Im jugendlichen Alter kommt es dann teilweise zu einer verspäteten Pubertät. Meist sind solche Störungen bei Mädchen auszumachen; seltener bei Jungen. Die bei intensiver Sportausübung notwendige Nahrungsumstellung ruft bei Mädchen eine Imbalance des Serotoninstoffwechsels hervor. Die körperliche Entwicklung wird dadurch verzögert, oder gar gehemmt. Es kann zu einem Ausbleiben der Menstruation (Amenorrhöe) kommen. Die Menarche (erste Monatsblutung) kann sich um Jahre verspäten. Auch die Ausbildung der se- kundären Geschlechtsmerkmale verzögert sich bei Jungen wie bei Mädchen.
Bei beiden Geschlechtern kann es zu einem Wachstumsstopp oder anderen Wachstumsstörungen kommen. Grundlegend hierfür sind die enormen hor- monellen Störungen. Gott sei Dank kommt es, nachdem die Ernährung und die geistige Haltung wieder umgestellt wird und dem Körper genügend Nähr- stoffe zu Verfügung stehen, meist zu einem normalen, wenn auch verzöger- ten, Entwicklungsabschluss.
3.5. zusätzliche Risiken
Eine Infektionsgefahr ist wesentlich höher, wenn die Stoffwechselvorgänge im Körper gestört ablaufen.
Schwankungen im Elektrolythaushalt, im Säure-Basen-Haushalt, wie auch da- durch bedingte Herzrhythmusstörungen erhöhen das lebensbedrohende Risiko eines plötzlichen Herzstillstandes bei Extrembelastungen (plötzlicher Herz- tod).
Die Turnerin Cathy Rigby, die bei den olympischen Spielen 1972 teilnahm litt 12 Jahre an Anorexie. In Folge dieser Krankheit erlitt sie 2 mal einen Herzstillstand.12
Trotz oder vielleicht sogar wegen der hohen Anforderungen an einen trainierten Körper kann auch bei einer permanenten Überforderung eine große Ausdauerenergie bereitgestellt werden, welche es ermöglicht, nachhaltig körperlich aktiv zu bleiben.
Bei alldem sind in erster Linie das Verdrängen des Hungergefühls und die Ein- bildung von Übergewicht trotz Untergewichts, die Ursachen für schlimme, (lebens-) bedrohliche Folgen. Dabei beobachtet man im fortgeschrittenen bis präfinalen Stadium einer Anorexie, dass Hände und Füße blau werden, der Puls sich verlangsamt und es zu einer allgemeinen Mangeldurchblutung kommt, was letztlich zu einem plötzlich Versagen des gesamten Kreislaufsys- tems führen kann.
4. Ätiologie der Anorexia athletica
Genaue Ursachen für eine Anorexia athletica sind nicht bekannt. Dennoch gibt es verschiedene Theorien und Hypothesen.
Dass ein schlanker und den jeweils geltenden Schönheitsidealen entsprechen- der Körper nicht immer nur das Resultat eines umfangreichen Trainings ist, ist offensichtlich. Andere Faktoren spielen eine große Rolle wie z. B. falsche Ernährung/Essgewohnheiten, die zwar der Sportart, nicht aber dem Sportler zugute kommen. Ungenügendes Wissen über die Zusammenhänge, oder un- realistische, von der Mode diktierte Figurvorstellungen spielen ebenso eine Rolle, wie der familiäre Rahmen und das gesellschaftliche Umfeld, welche den Ehrgeiz und die Trainingseinstellung, z. B. durch Leistungsdruck deutlich be- einflussen können.
4.1. Freudianische Theorie
Die betroffenen Personen denken gutes und reichliches Essen sei ein Ersatz für sexuelle Aktivität. Diesen Gedanken finden sie abstoßend, deshalb essen sie nichts, bzw. so wenig wie möglich. Um zwischengeschlechtliche Beziehungen und sexuellen Drang zu unterdrücken, betreiben sie Sport und wandeln so ihre sexuellen Energien um.13
4.2. Systemisch-familientherapeutische Theorie
Den Sportler beschäftigt eine Tabu- oder Konfliktbekämpfung. Die Anorexie ist dann eine Folge des indirekten, innerlichen Potests gegen z. B. die elterliche oder "trainerliche" Dominanz.14
4.3. Lerntheoretische Theorie
In diesem Fall handelt es sich um eine Gewichtsphobie, bei welcher die Norm des Schlankseins im Vordergrund steht. Die Orientierung des Sportlers an Vorbildern und Idealkörpern wird derart extrem, dass es bei ihr/ihm zu einer krankhaften Sucht wird, diesen Idealen nachzueifern.15
4.4. Neurochemische Theorie
(Celina Bergh, Per Södersten vom schwedischen Karolinska Institut)
Wie der Name schon sagt, werden hier neurochemische Ursachen für den Ausbruch einer Anorexie vermutet. Durch Tierversuche mit weiblichen Rat- ten hat man festgestellt, dass Tiere, die ein Laufrad und genügend Futter be- kommen, in einem direkt von der Laufleistung abhängigen Verhältnis fressen. Gibt man ihnen kein Laufrad, so fressen sie ihrem geringeren Energiebedarf entsprechend weniger.
Haben sie ein Laufrad, aber nicht genügend Futter, steigern sie ihr "Training" immer weiter, je mehr sie an Gewicht abnehmen. Fatale Folge: Nach kurzer Zeit sterben sie!
Hunger und gleichzeitiger körperlicher Stress erhöhen die Ausschüttung des Corticotropin-Releasing-Faktors (CRF) im Hypothalamus. Dadurch wird der Cortisolspiegel im Blut gesteigert. Dieser Vorgang unterdrückt den Hunger für mehrere Stunden. Die Glucocortcoide lösen dagegen Euphorien aus, die zu Abhängigkeiten führen können.
Dem zufolge ist bei Magersüchtigen der CRT-Spiegel im Hirn und die Corti- solwerte im Blut erhöht. Das Ergebnis ist seit ca.25 Jahren bekannt: Nah- rungsverzicht und Gewichtsverlust bei hungernden Frauen (bei Männern äu-ßerst selten) kann ein trügerisches Wohlbefinden hervorrufen, und so das Ri- siko zur Selbstaushungerung im weiblichen Spitzensport deutlich höher er- scheinen lassen als in anderen Sportarten. Wird erst mal die Verbindung von Hunger und Sport als angenehm empfunden, ist die Gefahr einer Sucht deut- lich erhöht.16
5. Merkmale der Anorexia athletica
5.1. mögliche Frühsymptome
- Unterschreiten der persönlich individuellen Gewichtsgrenze (Body-Mass- Index)
- Veränderte Körperzusammensetzung im Bezug auf das Verhältnis von Körperfett zu Körpermasse
- Veränderte, auffällige Eßgewohnheiten
- Menstruationsstörungen
- Auffälliges oder gestörtes psychisches Verhalten17
5.2. körperliche Veränderungen und Beschwerden im Zusammenhang mit Anorexia athletica
a) Die auffälligste Veränderung ist wohl der drastische Körpergewichtsverlust. Dieses gilt bei mehr als 5% (bis zu 15%) unter das eigentlich zu erwartende Gewicht.
b) Auch gastrointestinale Beschwerden, also solche die den Magen und den Darm betreffen, sind auf Grund der mangelnden Ernährung häufig im Krankheitsbild mit inbegriffen.
c) Eine kritische Grenze für den Körper ist bei einem BMI (Body-Mass-Index) von weniger als 18 kg/m² erreicht.
Berechnung des BMI:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten18
d) Des weiteren kann es zu
- trockener, schuppiger Haut
- Haarausfall
- feinem, dünnen Flaumhaar in Gesicht und Nacken
- brüchigen Fingernägeln
- gelblicher Hautfärbung
- gesteigerter Herzfrequenz
- Verstopfung
- verringerter Körpertemperatur19 kommen.
5.3. Verhaltensmerkmale bei Anorexia athletica
a) Eine Person, die an Anorexia athletica leidet, zeigt (neben den körperlichen Veränderungen) auch Änderungen im persönlichen Auftreten.
b) Die selbstgeforderten Trainingseinheiten übersteigen wiederholt die An- forderungen, die der Körper(bei Erhalt der Gesundheit) erfüllen kann.
c) Man nimmt fanatische Gedanken in sich auf, im Bezug auf sein Gewicht und Diäten. Es vergeht oft keine Stunde, in der nicht zumindest über das Gewichtverlieren nachgedacht wird.
d) Mehrfach besteht auch die Angst fett zu werden, bzw. an Gewicht zuzu- nehmen, obwohl die Schwelle zum Untergewicht schon überschritten ist. Dies führt zu einer Nahrungsverweigerung, bzw. einer Nahrungsaufnahme unter dem Minimalbedarf, also weniger als 5000 kJ/Tag(= 1200 kcal/Tag), und durch diese Angst werden individuelle, zwanghafte Kontrollgewohnhei- ten entwickelt.
e) Die Wahrnehmung der eigenen Figur und des Körpergewichts ist so sehr gestört, dass die Bedrohlichkeit der Lage geleugnet, oder gar nicht erst er- kannt wird.
f) Oft wird in der Zeit, in welcher man sich in der Schule, oder am Arbeitsplatz befinden sollte, trainiert. Ebenso werden Freundschaften und auch die Familie häufig vernachlässigt.
g) Das Selbstwertgefühl wird allein von der erbrachten Leistung bestimmt. Nur wenn das Ziel der Leistungserbringung erfüllt wird, ist die Person mit sich zufrieden. Das ist für die betroffene Person der einzige Weg, sich das notwendige Selbstwertgefühl zu geben.
h) Sie zeigt sich selten, oder sogar nie mit einem Sieg (persönlicher Erfolg) zufrieden.
i) Auch empfindet sie keine Freude am Sieg, sondern widmet sich unmittelbar nach einem Erfolg sofort wieder dem Training für den nächsten Wettkampf. Der Sieg ist nur ein weiterer Antrieb für den nächsten.
j) Häufig bedeutet der Gewichtsverlust eine persönliche Leistung und ist ebenfalls ein Beleg für Willenskraft und Disziplin. Gewichtszunahme oder Stagnation hieße Versagen.
k) Das Verhalten dieser Sportler vor anderen und auch vor sich selbst wird dadurch gerechtfertigt, dass er oder sie sich selbst als Elite-, oder Spitzen- sportler sieht, und aus diesem Grunde auf das Training nicht verzichten kann.
6. Gewicht als Leistungsfaktor
Durch die "berufsbedingte" Notwendigkeit eines schlanken Körpers finden sich in Leistungssportarten wie z. B. Turnen, Rhythmische Gymnastik, Eiskunstlaufen oder Skispringen weit mehr anorektische und bulimische Essstörungen, als außerhalb solcher Sportarten.
Turnerinnen wie Kathy Johnson oder Nadia Comaneci gaben sogar öffentlich zu, an einer Essstörung zu leiden.20
Es ist immer schwierig, zwischen leicht und schwer zu unterscheiden, zumal es nur ein schmaler Grat zwischen Wettbewerbsnachteilen, durch zu viel, und Leistungseinbußen, durch zu wenig Körpergewicht, ist.21 Als Folge davon werden in radikalen Versuchen, dem spezifisch leistungssportlichen, schlanken Körperideal zu entsprechen, die Erwartungen manchmal übertroffen bzw. übererfüllt.
Oft spielen auch einfach falsche Vorstellungen von den Zusammenhängen zwischen Körper, Gewicht und Leistung bei Sportlern und Trainern zu individuellen psychischen und physischen Auffälligkeiten.
Zusätzlich erhöhen zu viele Gewichtskontrollen, Körperfettmessungen, Ernährungsumschulungen und Ernährungspläne die Anfälligkeit für ein verzerrtes Wahrnehmungsvermögen des eigenen Körpers22 und führen so schlimmstenfalls zur Magersucht.
In Sportarten wie Turnen, Rhythmische Gymnastik, Eiskunstlauf, Tanzen o- der Synchronschwimmen kommt es auf eine extrem schlanke Figur an. Zum einen, weil ein geringes Gewicht gut für die Ausübung des Sportes ist, zum anderen, weil das Aussehen eine wichtige Rolle für die Bewertung durch die Schiedsrichter und das beobachtende Publikum spielt.
Auch in Kampfsportarten, Bodybuilding und Gewichtheben ist das Gewicht von entscheidender Bedeutung, da die Sportler stets bedacht sind, in einer möglichst niedrigen Gewichtsklasse anzutreten.
Neuerdings werden auch die Skispringer immer dünner und dünner, um möglichst wenig Masse mit auf die Bretter zu nehmen und so weiter zu fliegen als die schwerere Konkurrenz.
6.1. Wie kommt es zu einem durch Untergewicht bedingten Leistungsrückgang?
Manchmal reicht es aus, wenn der Trainer oder ein Schiedsrichter eine verlet- zende Bemerkung über zu viel Körpergewicht macht, oder ein herausfordern- des Wort zum Abnehmen von sich gibt, und der angesprochene Sportler be- ginnt, unterstützt durch zu häufiges Messen und Festhalten von Körperge- wicht und Körperfettwerten, noch intensiver als bislang auf sein Gewicht zu achten.
Zu der Weltklasseturnerin Christy Henrich sagt 1988 bei einem Treffen in Budapest ein Schiedsrichter, dass sie fett sei, und abnehmen müsse, wenn sie in die olympische Besetzung kommen will. Christy flüchtete hierauf in die Magersucht. Sie starb am 26. Juli 1994 in Alter von 22 Jahren an mehrfachen Organausfall.23
Gewicht wird nun zur Belastung. Zunächst gilt: Je weniger man mit sich herumtragen muss, desto schneller oder besser fühlt man sich bei der Sportausübung. Indirekt stärkt das auch die maximale Ausdauerfähigkeit. Bewegungsabläufe sind einfacher zu vollziehen.
Nach diesem anfänglich guten Gefühl bei der Kombination von Hungern und Sport, bei welcher zunächst auch eine Leistungssteigerung festzustellen ist, kommt es rasch zu einem zu hohen Gewichtsverlust, welcher die Leistung wieder rückläufig werden lässt. Der Anfang dieser Leistungsrückbildung wird zunächst übersehen. Deshalb leben die Sportler weiter in ihrer Ruhelosigkeit, bzw. Hyperaktivität, durch welche sie, unterstützt durch das vermehrte Auf- treten anorexigener Stoffe im Körper, den Hunger weiter unterdrücken und sogar innere und emotionale Spannungen recht gut ausgleichen können.24
Hat nun der Leistungsrückgang einmal begonnen, kommt schnell ein Punkt, an dem es nicht mehr möglich ist weitere Muskelmasse aufzubauen. Folglich geht die Bereitschaft zu weiterem harten Training hier meist verloren. Nicht zuletzt weil sich die Regenerationszeit des Körpers deutlich erhöht hat.
6.2. Körperbewusstseinsproblematik
6.2.1. bei gemessener Leistung
Bei gemessener Leistung ist es das Ziel, zur Erbringung von Leistung den bestmöglich austrainierten Körper maximal einzusetzen, wie es z. B. in Kampfsportarten und bei der Leichtathletik der Fall ist.
Frauen entsprechen auf Grund dieser Tatsache oft nicht der Vorstellung von Weiblichkeit. Doch diese als Folge intensiven Trainings entstandenen körperlichen Veränderungen sind im Leistungssport nicht zu vermeiden. Leider kann dieser Umstand zu einem zwiespältigen, oder gar widersprüchlichen Verhältnis zum Körper und sich selbst führen.25
6.2.2. bei bewerteter Leistung
Bei bewerteter Leistung geht es um ein technisches, künstlerisches Werten, wie z. B. beim Tanzen oder Eiskunstlaufen. Schlanksein ist hier immer ein wichtiges Kriterium für Schiedsrichter und Trainer. auch das applaudierende und bezahlende Publikum spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Dies ist in allen kompositorischen Sportarten der Fall wo man den Körper auch optisch zu Wirkung bringen muss. Körperlichkeit und Darstellung wer- den von anderen kontrolliert und mit der Konkurrenz oder einem Idealbild verglichen. Dies führt zu einem täglichen Kampf mit den Proportionen, da zum einen die Handlung der Sportler mit ihrem Erscheinungsbild, zum ande- ren auch körperliche Ideale und Bewertungsmassstäbe mit der Präsentation übereinstimmen müssen, um in ein sportarttypisches Klischee zu passen. Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann dem Auftreten die geforderte Attraktivität zugeschrieben werden.26
7. Therapie von Anorexia athletica
Anorexie ist immer heilbar!
Egal ob Magersucht, Bulimie oder Anorexia athletica, sind diese Erscheinungen jedoch schwer zu behandeln, da meist die Einsicht der Patienten fehlt, oder diese versuchen die Warnsignale ihrer Körper zu überspielen, oder gar zu ignorieren. Oft kommt gerade im Falle der Anorexia athletica eine Einsicht des Sportlers erst dann, wenn in Folge einer Krankheit, oder Verletzung, die aufgrund einer mangelnden Ernährung entstanden ist, die Leistungsfähigkeit eingeschränkt und dadurch die Sportkarriere bedroht wird.
7.1. Die zwei Phasen der Therapie
Grundsätzlich teilt man die Therapie einer Anorexie in zwei Phasen. Das Ziel der ersten Phase ist es, das Körpergewicht zu steigern, das der zweiten, es zu halten!
Angestrebt wird das Erlangen einer angemessenen, realistischen Körperauffas- sung von Seiten der Patienten und der Abbau des Meideverhaltens gegenüber der Nahrungsaufnahme. Gleichzeitig gilt es ein regelmäßiges Essverhalten auf- zubauen.27
Zu einer solchen Behandlung werden oft verhaltenstherapeutische Vorgehensweisen erfolgreich angewandt.
Bei extremen Fällen wird eine stationäre Behandlung notwendig, welche in seltenen Fällen zum Wohle des Erkrankten auch gegen dessen Willen durchgeführt werden muss.28
Doch selbst nach erfolgreichen Behandlungen sind verbleibende Persönlichkeitsstörungen leider nicht auszuschließen.
7.2. Sport als Heilmittel gegen Anorexie
Sport ist allerdings im Bezug auf Magersucht nicht nur als Auslöser zu sehen. Nicht selten fungiert er auch als Heilmittel gegen eine solche. Ein Mensch, der bereits Magersucht hat, unterliegt oft dem oben beschriebe- nen Bewegungsdrang. Aus dieser Hyperaktivität heraus beginnt er oder sie Sport zu betreiben, um dann, zweckdienlich, weiter Gewicht zu verlieren. In deren Denken ist Sport dann zum einen eine Legitimation für ihr Dünnsein, zum anderen ein Beweis ihrer körperlichen Fitness. Durch die große Motiva- tion, die mitgebracht wird, und die Fähigkeit der enormen Selbstdisziplin, die es ermöglicht Gefühle wie Hunger oder Schmerz zu ignorieren, gelangt man zu guten Leistungen im Spitzensport.
Der Sport und vor allem die damit verbundenen Erfolge können nun wichti- ger werden, als das Hungern. Dies führt zu einer anderen, gesünderen Ein- stellung zum eigenen Körper. Es wird der/dem Magersüchtigen bewusst, dass ein leistungsfähiger Körper Nahrung benötigt, weshalb sie/er sich folgerichtig ausreichend ernährt.
Auf diese Weise kann Sport eine Hilfe für Essgestörte darstellen.29
8. Prävention von Anorexia athletica
(Vorbeugen ist besser als Heilen)
Nur durch Aufklärung und Beobachtung der Sportler ist eine frühzeitige Erkennung von Anorexia athletica möglich.
8.1. durch Kontrolle
Auf wöchentliches Wiegen und regelmäßige Kontrolle der Hautfaltendicke zur Bestimmung des Körperfetts, sollte bei keinem Hochleistungssport verzichtet werden.30
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach dieser Formel kann einer zu extremen Reduzierung der Körpermasse vorgebeugt werden.
Auch eine Beobachtung der Leistungskurve kann zur Früherkennung dienen, indem man z. B. bei unerklärtem Leistungsrückgang nach dessen Ursachen forscht.
Einseitige Ernährungsweisen, wie z. B. streng vegetarische Kost, sollten genauso vermieden werden, wie ständiges, bzw. längeres Diäthalten, oder Reduktionsdiäten unter 1500 kcal bzw. 6000J.31
8.2. durch Aufklärung, Beratung und Unterstützung
(ganz wichtig!)
Die Sportler selbst (auch Eltern, Betreuer, Ausbilder und Trainer) sollten ü- ber die Prävention und die Gefahren und Anzeichen einer Anorexie informiert werden.
a) Dem Sportler muss klar sein, dass das Mindestgewicht deutlich über der Magersuchtgrenze liegen soll (BMI >18). Naturgemäß muss speziell bei Kin- dern besonders darauf geachtet werden, dass sie im Rahmen der Norm wach- sen.
b) Für jeden Spitzensportler sollten individuelle, ausgewogene Ernährungspläne aufgestellt werden.
c) Beratungsgespräche sollten schon mit dem heranwachsenden Sportler durchgeführt werden. Auch Eltern, Trainer und Betreuer müssen mit einbe- zogen werden. In Gesprächen kann die Sensibilität für die speziellen Probleme geschult werden. Frühsymptome werden leichter und schneller erkannt.
d) Trainer und Ausbilder müssen über genug Wissen verfügen, das sie in die Lage versetzt, zu erkennen wenn das Training zwanghaft wird und zu ungesunden Mitteln zur Gewichtsverringerung gegriffen wird.
e) Trainer und Eltern dürfen keinen zu großen Leistungsdruck auf die Sportler ausüben. Sie sollen ermutigen und helfen, eine gesunde Art des Trainings zu entwickeln, ohne Verletzungsgefahren und ohne die Gefahr den Körper zu schädigen. Lob und Anerkennung sollen dem Sporttreibenden sicher sein, egal auf welchem Platz er aus einem Wettkampf geht.
8.3. durch das richtige Verhältnis zwischen Belastung und Energiebedarf/Ernährung
Auf keinen Fall darf vernachlässigt werden, dass auf das richtige Verhältnis zwischen Belastung und Energiebedarf geachtet wird.
Um diese Forderung zu erfüllen ist Folgendes zu beachten:
a) Als Grundlage sind optimale Bedarfsproportionen festzulegen.
b) Essgewohnheiten und Essverhalten soll in einen Zusammenhang mit einem ein- bis zweifachen Training pro Tag gestellt werden.
c) Die Zusammenhänge von Ernährung und Körperfunktionalität sollten allen Sportlern deutlich dargestellt werden.
d) Die Gewichtsverhältnisse müssen für jeden Sportler individuell festgelegt werden.32
9. Schlusswort
Damit es nie wieder dazu kommt, dass Sportler, wie z. B. die Weltklasseturnerin Christy Henrich mit 22 Jahren, als Folge ihrer durch Sport ausgelösten Magersucht sterben, müssen bereits die Eltern am besten dadurch vorbeugen, indem sie frühzeitig das Selbstwertgefühl ihrer Kinder stärken und ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie, so wie sie sind, geliebt werden. Je früher Betroffene und Umwelt handeln, desto größer sind die Chancen mit möglichst geringen Folgeschäden der Störung zu entkommen. Das Problem der Magersucht verschwindet nicht von heute auf morgen. Das zeigen die Erfahrungsberichte vieler Betroffener.
Ich bin jedoch sicher, dass mit zunehmender Aufklärung der Sportler und ih- rer Trainer und mit der Anpassung des sportlichen Reglements an die Bedürf- nisse des menschlichen Körpers die "Anorexia athletica" immer seltener dazu führen wird, dass Sport nicht (mehr) die schönste Nebensache der Welt ist.
Anhang
Literaturverzeichnis
Zeitschriften/Zeitungen:
Clarsing, Anorexia athletica: eßgestört durch Sport, in: EU.L.E.N- SPIEGEL, 3. Jahrgang, Nr.8, 24.11.1997, S.7
Krause-Fabricius, Gisela, Krankhafte Sucht nach dünnen Körpern, in: Die Welt , 4.8.1998
Bergh, C., Södersten, P., Anorexia nervosa, self-starvation and the reward of stress, in: Nature Medicine 1996, Nr. 2, S. 21-22
Neumärkter K.-J., Bartsch, A. J., Anorexia nervosa und "Anorexia athleti- ca"?, in: Wiener Medizinische Wochenschrift, 1998, Heft 148, S. 245-250
Bücher:
Valérien, Harry, Olympia 84, München, 1984
Offizielle Bilddokumentation des DLV, Leichtathletik WM 83, München, 1983
Roche Lexikon Medizin, hg. von der Hoffmann-La Roche AG und Urban & Schwarzenberg, München, 1984
Internetdokumente:
Strack, A., Trainingsbegleitende Maßnahmen, Probleme und Fehler bei der Ernährung im Spitzensport,
http://www.unet.univie.ac.at/~a9100011/training/ernaehr.htm, (27.12.00)
Klapper, Sabine, Die Vernunft ist der Besessenheit gewichen, in: Tagesanzei- ger vom 07.02.96, http://www.tages-
anzeiger.ch/archiv/96februar/960207/56423.htm, (26.12.00)
Magersucht-Online, Eßstörungen bei Sportlern, Magersucht bei Sportlern, http://www.magersucht-online.de/sport.htm, (26.12.00)
Mentalhealthindia, Disorders, Anorexia athletica, http://www.mentalhealthindia.com/Disorders/Eating%20Disorder/eating_ athletica.htm, (27.12.00)
Department of Psychology, University of Zurich, Eßstörungen, Anorexia ner- vosa, http://www.psych.unizh.ch/klipsy/rink/psys00f.htm, (26.12.00)
Schweiger, Andreas, IOC-Projekt verleiht Flügel, Magere Zeiten für leichte Spitzensportler, in: Unizeit 4/00, http://www.kfunigraz.ac.at/ainst/uz/aktuell/2000/heft4/4-00-01.html, (27.12.00)
Uni Leipzig, Anorexia, F50.0 Anorexia nervosa http://www.uni- leipzig.de/~anorexia/anorebes.htm, (26.12.00)
Sonstiges:
Kling, Christiane, Wissenschaftliche Hausarbeit, Thema: Magersucht und
Körperproblematik - Konsequenzen für den Sportunterricht der Mädchen, Schriesheim, 30.10.1998
Ich erkläre hiermit, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.
.., den
Ort Datum Unterschrift des Schülers
[...]
1 Offizielle Bilddokumentation des DLV, Leichtathletik WM 83, München, 1983, S. 89
2 Valérien, Harry, Olympia 84, München, 1984, S. 23
3 vgl. Magersucht-Online, Eßstörungen bei Sportlern, Magersucht bei Sport- lern, http://www.magersucht-online.de/sport.htm
4 Schweiger, Andreas, IOC-Projekt verleiht Flügel, Magere Zeiten für leichte Spitzensportler, in: Unizeit 4/00, http://www.kfunigraz.ac.at/ainst/uz/aktuell/2000/heft4/4-00-01.html,
5 Roche Lexikon Medizin, hg. von der Hoffmann-La Roche AG und Urban & Schwarzenberg, München, 1984, S. 66
6 vgl. Department of Psychology, University of Zurich, Eßstörungen, Anore- xia nervosa, http://www.psych.unizh.ch/klipsy/rink/psys00f.htm,
7 vgl. http://www.psych.unizh.ch/klipsy/rink/psys00f.htm, a.a.O.
8 Roche Lexikon Medizin, a.a.O., S. 66
9 vgl. Kling, Christiane, Wissenschaftliche Hausarbeit, Thema: Magersucht und Körperproblematik - Konsequenzen für den Sportunterricht der Mäd- chen, Schriesheim, 30.10.1998, S. 31
10 vgl. Kling, Magersucht und Körperproblematik, a.a.O., S. 31
11 vgl. Kling, Magersucht und Körperproblematik, a.a.O., S. 53 ff
12 vgl. http://www.magersucht-online.de/sport.htm, a.a.O.
13 vgl. http://www.psych.unizh.ch/klipsy/rink/psys00f.htm, a.a.O.
14 vgl. http://www.psych.unizh.ch/klipsy/rink/psys00f.htm, a.a.O.
15 vgl. http://www.psych.unizh.ch/klipsy/rink/psys00f.htm, a.a.O.
16 vgl. Bergh, C., Södersten, P., Anorexia nervosa, self-starvation and the reward of stress, in: Nature Medicine 1996, Nr. 2, S. 21-22
17 vgl. Kling, Magersucht und Körperproblematik, a.a.O., S. 45
18 Strack, A., Trainingsbegleitende Maßnahmen, Probleme und Fehler bei der Ernährung im Spitzensport, http://www.unet.univie.ac.at/~a9100011/training/ernaehr.htm
19 vgl. http://www.psych.unizh.ch/klipsy/rink/psys00f.htm, a.a.O.
20 vgl. http://www.magersucht-online.de/sport.htm, a.a.O.
21 vgl. http://www.unet.univie.ac.at/~a9100011/training/ernaehr.htm, a.a.O.
22 vgl. Klapper, Sabine, Die Vernunft ist der Besessenheit gewichen, in: Ta- gesanzeiger vom 07.02.96, http://www.tages- anzeiger.ch/archiv/96februar/960207/56423.htm,
23 vgl. http://www.magersucht-online.de/sport.htm, a.a.O.
24 vgl. http://www.tages- anzeiger.ch/archiv/96februar/960207/56423.htm, a.a.O.
25 vgl. Kling, Magersucht und Körperproblematik, a.a.O., S. 40
26 vgl. Kling, Magersucht und Körperproblematik, a.a.O., S. 41
27 vgl. http://www.psych.unizh.ch/klipsy/rink/psys00f.htm, a.a.O.
28 vgl. http://www.psych.unizh.ch/klipsy/rink/psys00f.htm, a.a.O.
29 vgl. Kling, Magersucht und Körperproblematik, a.a.O., S. 32
30 vgl. http://www.unet.univie.ac.at/~a9100011/training/ernaehr.htm, a.a.O.
31 vgl. http://www.unet.univie.ac.at/~a9100011/training/ernaehr.htm, a.a.O.
Häufig gestellte Fragen zu Anorexia Athletica
Was ist Anorexia Athletica?
Anorexia athletica ist eine Form der Anorexie, die eng mit der intensiven Ausübung verschiedener Sportarten verbunden ist. Sie ist zwar keine offizielle medizinische Diagnose, aber ein ernstzunehmendes Problem, das zunehmend mit der Anorexia nervosa gleichgesetzt wird.
Was sind die Unterschiede zwischen Anorexia Athletica und Anorexia Nervosa?
Obwohl es Unterschiede gibt (wie in Abschnitt 2.1 dargestellt), besteht die Gefahr, dass sich die Gewichtsreduktion verselbstständigt und in das Vollbild der Magersucht abgleitet.
Welche Gefahren und gesundheitlichen Folgen hat Anorexia Athletica?
Die Folgen sind vielfältig und hängen von der Dauer des Mangelstoffwechsels ab. Dazu gehören Knochenstoffwechselstörungen (Osteoporose), hormonelle Ungleichgewichte, psychische Probleme und in der Pubertät Entwicklungsverzögerungen. Im Extremfall kann es zu Herzrhythmusstörungen und plötzlichem Herztod kommen.
Was sind die Ursachen für Anorexia Athletica?
Die genauen Ursachen sind nicht bekannt, aber es gibt verschiedene Theorien, darunter freudianische, systemisch-familientherapeutische, lerntheoretische und neurochemische Ansätze.
Welche Merkmale kennzeichnen Anorexia Athletica?
Mögliche Frühsymptome sind Unterschreiten der individuellen Gewichtsgrenze, veränderte Körperzusammensetzung, auffällige Essgewohnheiten, Menstruationsstörungen und gestörtes psychisches Verhalten. Körperliche Veränderungen sind Gewichtsverlust, gastrointestinale Beschwerden, trockene Haut, Haarausfall und brüchige Nägel. Verhaltensmerkmale sind fanatische Gedanken über Gewicht, Angst vor Gewichtszunahme, zwanghafte Kontrollgewohnheiten, gestörte Körperwahrnehmung und Leistungsdruck.
Welche Rolle spielt das Gewicht als Leistungsfaktor?
In bestimmten Sportarten (Turnen, Eiskunstlauf, Skispringen) kann ein schlanker Körper als notwendig angesehen werden. Falsche Vorstellungen über Körper, Gewicht und Leistung können zu psychischen und physischen Auffälligkeiten führen. Zu viele Gewichtskontrollen können die Anfälligkeit für eine verzerrte Körperwahrnehmung erhöhen.
Wie wird Anorexia Athletica behandelt?
Die Therapie umfasst zwei Phasen: Gewichtssteigerung und Gewichtserhaltung. Ziel ist es, eine angemessene Körperauffassung zu erlangen, Meideverhalten abzubauen und ein regelmäßiges Essverhalten aufzubauen. Verhaltenstherapeutische Ansätze werden oft angewandt. In extremen Fällen ist eine stationäre Behandlung notwendig.
Kann Sport als Heilmittel gegen Anorexie dienen?
Ja, Sport kann in bestimmten Fällen eine Hilfe sein, wenn die damit verbundenen Erfolge wichtiger werden als das Hungern und zu einer gesünderen Einstellung zum eigenen Körper führen.
Wie kann Anorexia Athletica vorgebeugt werden?
Prävention umfasst Kontrolle (wöchentliches Wiegen, Hautfaltenmessung), Aufklärung (über Gefahren und Anzeichen), Beratung und Unterstützung (für Sportler, Eltern, Trainer) und ein richtiges Verhältnis zwischen Belastung und Energiebedarf.
Was ist das Ziel der Prävention und Behandlung von Anorexia Athletica?
Das Ziel ist es, zu verhindern, dass Sportler an den Folgen von Anorexia Athletica sterben. Durch Aufklärung und Anpassung des sportlichen Reglements soll Anorexia Athletica immer seltener dazu führen, dass Sport nicht mehr die schönste Nebensache der Welt ist.
- Quote paper
- Vera Hahn (Author), 2001, Anorexia athletica, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101263