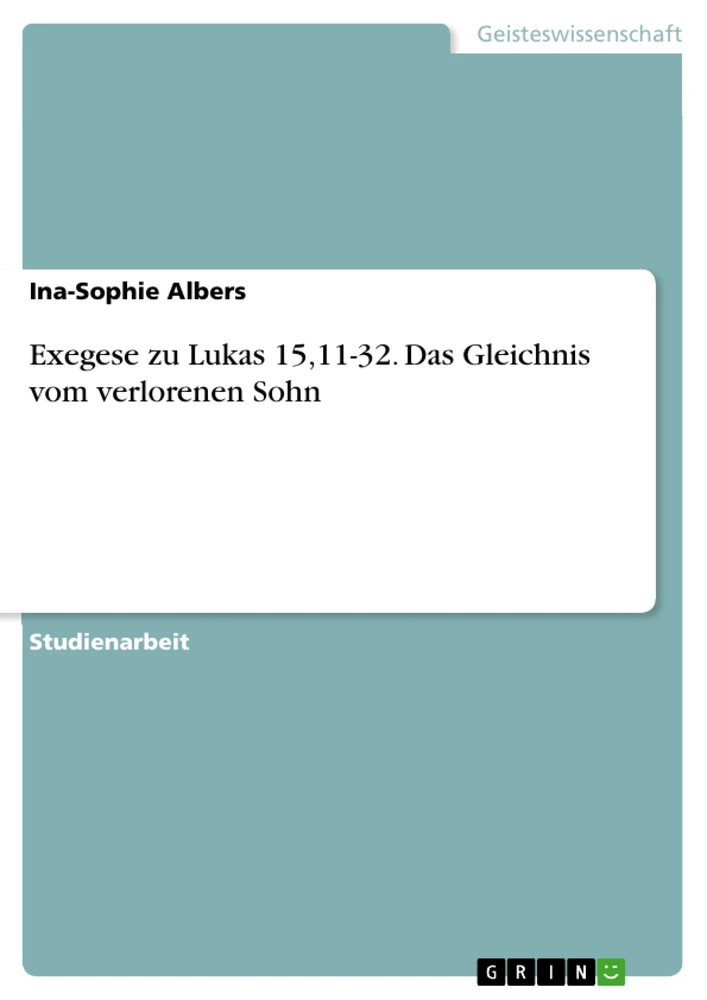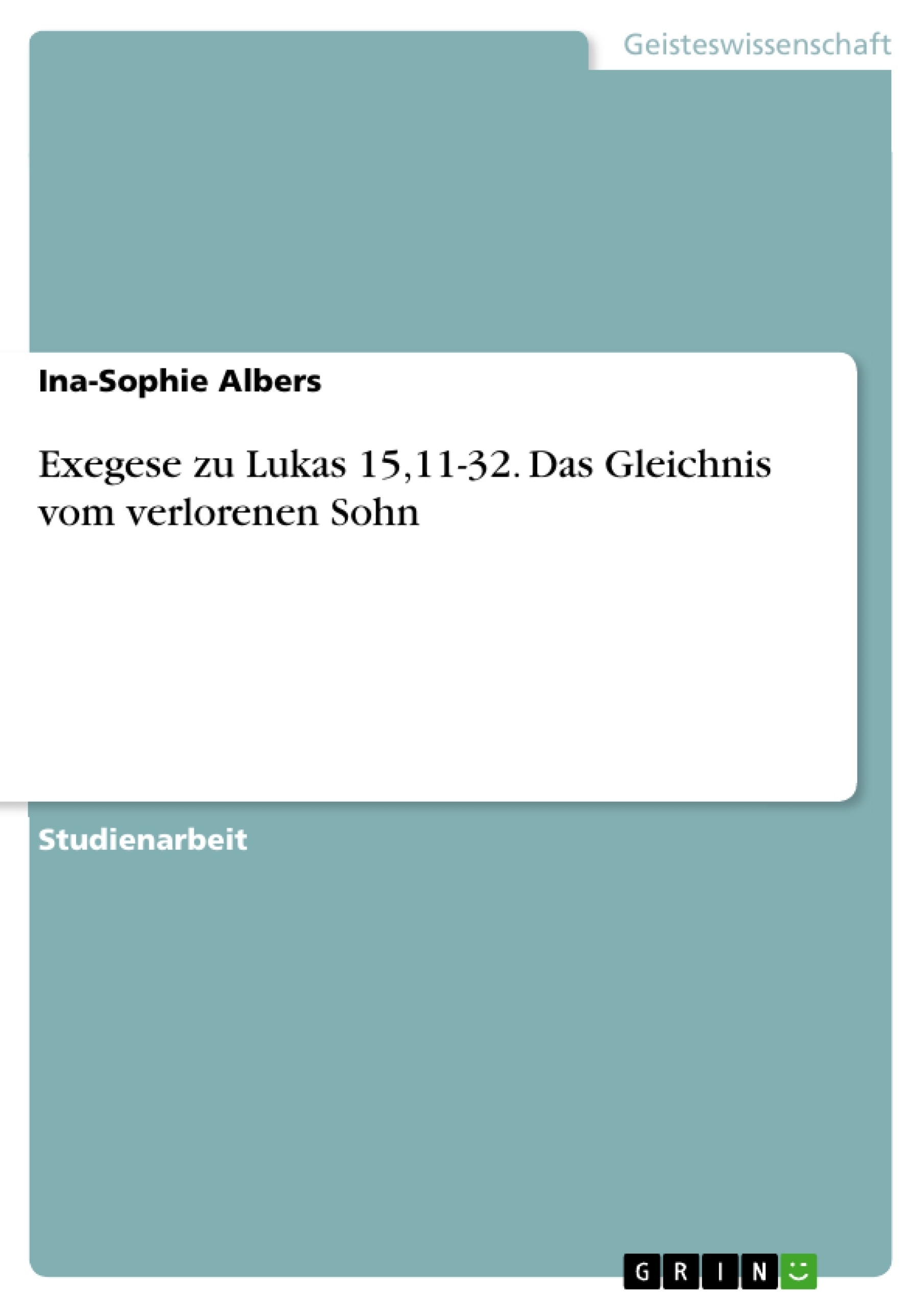In Lukas 15,11-32 fällt bereits bei erster Lektüre die Vielseitigkeit und der große Interpretationsrahmen in Bezug auf die drei Hauptpersonen auf. Bei erster Betrachtung des Gleichnisses kommt die Frage auf, aus welchem Grund nur männliche Figuren benannt werden. Eine Mutter wird an keiner Stelle benannt. Auch wenn in Vers 11 zunächst die Rede von einem Menschen ist, wird im Folgenden deutlich, dass es sich um einen Vater und dessen Söhne handelt, ohne Erwähnung der zugehörigen Mutter.
Somit ergibt sich die Frage, ob die Erzählung mit mütterlichem Einfluss anders verlaufen wäre. Des Weiteren stößt in diesem Kontext auf, auf welcher Grundlage lediglich von Söhnen berichtet wird und nicht von einer Tochter die Rede ist. Bei weiterem Lesen der Perikope lässt sich hinterfragen, ob das Verhalten des Jüngeren als verwerflich angesehen werden kann. Wie ist die Forderung des Erbteiles und die Auswanderung zu bewerten bzw. welchen Motiven liegt sein Verhalten zugrunde? Dem gefolgt kann die Reaktion des Vaters bei der Rückkehr des jüngeren Sohnes als fraglich aufgegriffen werden. Auf welcher Grundlage verzeiht er seinem Jüngeren bedingungslos? Schlussendlich wirft die Reaktion des Älteren auf die Wiederaufnahme des Jüngeren Fragen auf. Kann er seinem jüngeren Bruder verzeihen oder leben sie fortan in Rivalität? Handelt das Gleichnis in Lukas 15,11-32 eventuell von zweiverlorenen Söhnen? Um den aufgeworfenen Fragestellungen nachzugehen, basiert die folgende Ausführung auf der Luther Übersetzung von 1984.
Inhaltsverzeichnis
- Vorüberlegungen und Textsicherung
- Persönlicher Zugang zum Text
- Abgrenzung der Perikope
- Sprachlich-sachliche Analyse
- Sozialgeschichtliche und historische Fragen, Realien
- Textlinguistik
- Die Aussageabsicht des Autors
- Formkritik
- Textpragmatik
- Ermittlung der Pointe
- Kontextuelle Analyse / das innovative Potenzial
- Traditionsgeschichte
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkonzepts
- Kompositionskritik
- Redaktionskritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Exegese zum Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11-32) analysiert den Text im Hinblick auf seine sprachliche und sachliche Struktur, sowie dessen theologische und narrative Bedeutung. Das Ziel der Arbeit besteht darin, den Text in seiner historischen, sozialgeschichtlichen und literarischen Kontextualisierung zu verstehen und die Aussageabsicht des Autors zu ergründen.
- Die Rolle der Geschlechter in der Erzählung und das Fehlen einer Mutterfigur
- Die Motive und Hintergründe des Verhaltens der Söhne
- Die Reaktion des Vaters und die Frage nach bedingungsloser Vergebung
- Das Verhältnis der Brüder zueinander und die Frage nach Rivalität oder Versöhnung
- Die Bedeutung des Gleichnisses für die theologische Deutung von Gottes Liebe und Barmherzigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorüberlegungen und Textsicherung: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem persönlichen Zugang zum Text und den aufgeworfenen Fragestellungen, insbesondere hinsichtlich der Geschlechterrollen, den Motiven der Söhne und der Reaktion des Vaters. Außerdem wird die Perikope im Kontext der anderen Gleichnisse in Lukas 15 abgegrenzt.
- Sprachlich-sachliche Analyse: Hier werden soziale und historische Aspekte des Gleichnisses beleuchtet, wie z.B. das Rechtssystem der damaligen Zeit, die Lebensbedingungen der Familien und die Bedeutung des Auswanderns. Die Textlinguistik spielt ebenfalls eine Rolle, jedoch wird diese hier nicht weiter ausgeführt.
- Die Aussageabsicht des Autors: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Formkritik, der Textpragmatik und der Ermittlung der Pointe des Gleichnisses. Es werden Fragen nach der Funktion und Zielsetzung der Erzählung gestellt und die Bedeutung des Gleichnisses in Bezug auf die Interpretation von Gottes Liebe und Barmherzigkeit betrachtet.
- Kontextuelle Analyse / das innovative Potenzial: In diesem Abschnitt wird der Text in einem größeren Kontext betrachtet. Es werden Themen wie die Traditionsgeschichte des Gleichnisses und Vergleiche mit anderen religionsgeschichtlichen Texten beleuchtet. Das innovative Potenzial des Gleichnisses wird ebenfalls angesprochen, jedoch nicht im Detail erörtert.
- Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkonzepts: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Kompositionskritik und der Redaktionskritik des Gleichnisses. Es wird erörtert, wie das Gleichnis im Kontext des Lukasevangeliums und des Gesamtkonzepts des Neuen Testaments zu verstehen ist.
Schlüsselwörter
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein zentrales Beispiel für die christliche Lehre von Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Die Exegese beleuchtet die sozialen und historischen Hintergründe der Erzählung, die Motive und Handlungen der Figuren, sowie die theologische Bedeutung des Gleichnisses im Kontext des Neuen Testaments. Dabei werden Begriffe wie Vergebung, Versöhnung, Liebe, Barmherzigkeit, Familienleben, Erbe, Auswanderung, und das Verhältnis von Vater und Sohn im Vordergrund stehen.
- Citar trabajo
- Ina-Sophie Albers (Autor), 2020, Exegese zu Lukas 15,11-32. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012197