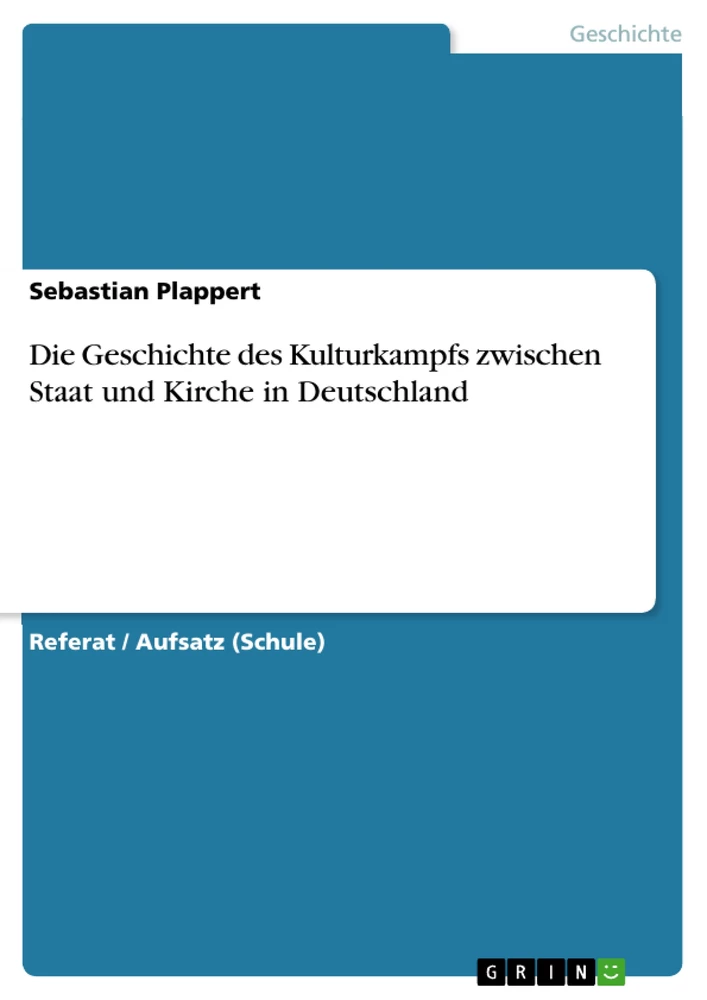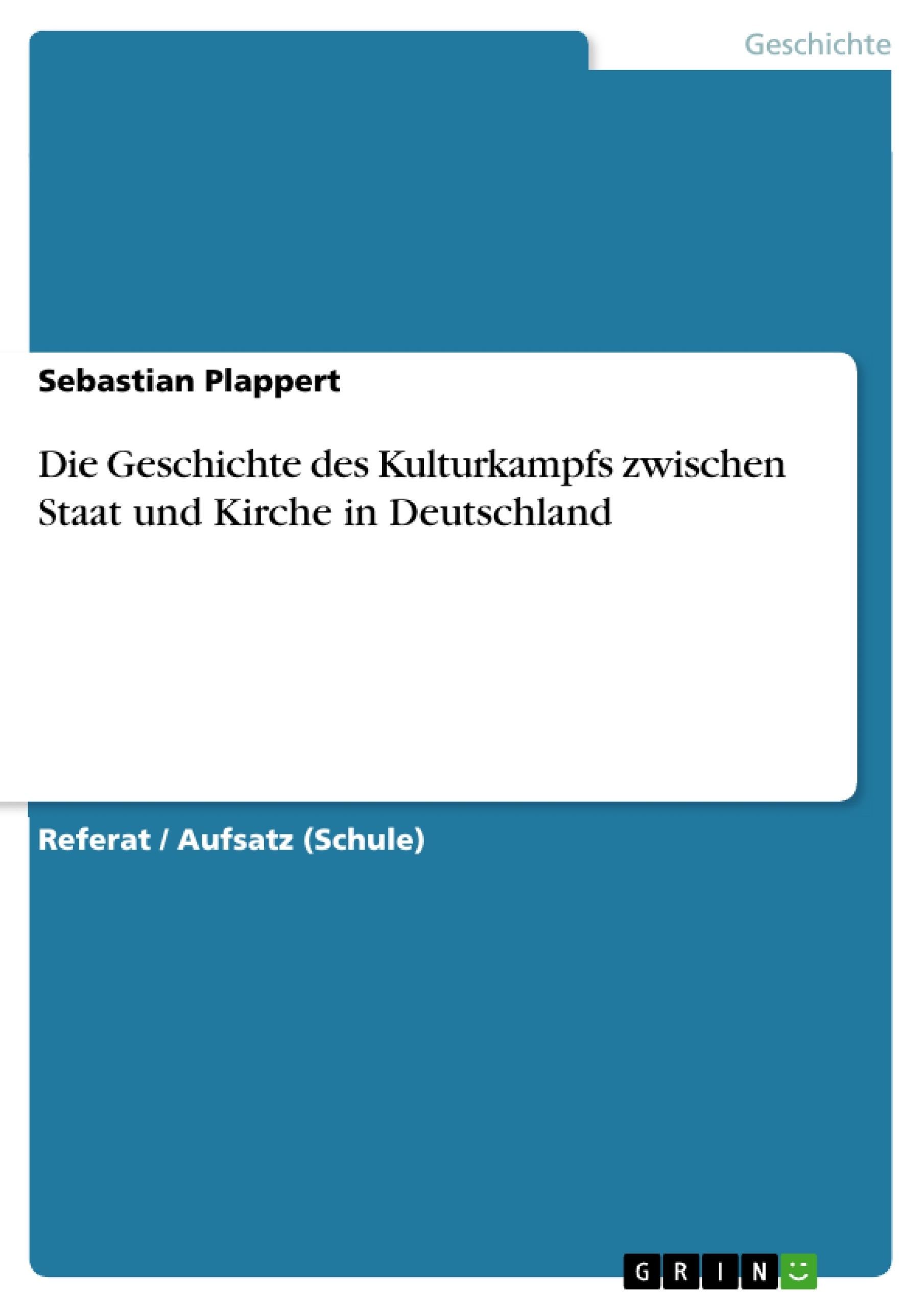Der Kulturkampf (1871 - 1878)
Diese Bezeichnung für die Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche geht aus der Frage hervor, wer die kulturellen Grundzüge der Gesellschaft bestimmen sollte.
Ursachen
Schon seit der Französischen Revolution wird der Einfluß der Kirche auf Staat und Gesellschaft mehr und mehr zurückgedrängt. Um sich dieser Bestrebungen zu erwehren richteten sich viele Katholiken nach den Anweisungen des Vatikans. Dieser hatte aufgrund der italienischen Einigung einen entscheidenden Machtverlust zu verkraften und reagierte darauf zunächst mit der sogenannten „Syllabus errorum“1, deren Inhalt als eine Provokation für den Liberalismus und als Angriff auf den Staat gedeutet wurde. Das 1870 folgende päpstliche Unfehlbarkeitsdogma erweckte nicht nur die Furcht vieler Politiker vor Übergriffen der Kirche in die Belange des Staates, sondern es bewirkte auch die Lossagung der Altkatholiken vom Papst. Die Forderung der Entlassung solcher Staatsbeamter nutzte Bismarck um seine Innenpolitik zu koordinieren. Für ihn stellte das Zentrum, eine katholische Partei, einen staatsgefährdenden Feind dar, schließlich pflegte sie die Zusammenarbeit mit den Minderheiten die gegen ihren Willen in das deutsche Reich eingegliedert worden sind. Unterstützung erhielt Bismarck durch die Liberalen, die sich davon einerseits Zugeständnisse von seiten des Reichskanzlers versprachen und andererseits die Gelegenheit nutzten die Gegenaufklärung in Form der Zentrumspartei zu bekämpfen. Um das Zentrum seiner politischen Bedeutung zu berauben wollte Bismarck, dass der Papst sich von der Partei distanziert. Als dieser ablehnte nahm Bismarck den Kampf gegen den „Ultramontanismus“2 auf.
Verlauf
Bismarcks Ziel ist es das Zentrum als politische Macht und den Einfluß der Kirche auf die Politik ausschalten.
Schon 1871 drohte er Geistlichen mit dem „Kanzelparagraphen“ Strafen an, wenn sie „Staatliche Angelegenheiten in aufwieglerischer Weise im Amt [...]3 “ behandelten. Im Jahr darauf ersetzte Bismarck die geistige Schulaufsicht durch eine staatliche, verbot den Jesuitenorden, und regelte in den „Maigesetzen“ 1873 die Einstellung Geistlicher. So musste vorher ein „Kulturexamen“ in Philosophie, in Geschichte und in deutscher Literatur bestanden werden. Aufgrund dieser Maßnahmen rief der Papst mit Erfolg alle Gläubigen zur Nichtbeachtung auf, worauf der Staat mit Geld- und Haftstrafen reagierte. Zu einer weiteren Verschärfung der Gesetze kam es 1875, als Papst Pius IX. die staatlichen Bestimmungen des Kulturkampfes für ungültig erklärte und allen die sich daran hielten mit Kirchenausschluß drohte. So wurde als Folge die „Zivilehe“4 eingeführt, alle finanziellen Zuwendungen an die Kirche gestrichen und bis auf die sanitären Orden alle anderen aufgelöst.
Aufgrund von politischen Differenzen in der Zollpolitik5 musste Bismarck auf die Konservativen zurückgreifen um die benötigte Unterstützung der Mehrheit des Parlaments zu erhalten. Dies machte aber eine Aussöhnung, also eine
1.[griech. ‘Verzeichnis‘] / Enzyklika über 80 Irrtümern in Fragen der Religion, der Politik und der Wirtschaft / veröffentlicht im Jahre 1864 unter Papst Pius IX.
2. [lat. ultra montes ‘jenseits der Berge‘], Bezeichnung für dt. polit. Katholizismus, der die Ansprüche des Papstes über die der eigenen Nation stellt.
3. Berg, Rudolf: Wege durch die Geschichte: Grundkurs Geschichte 12. Berlin: Cornelson 1993.
4. Einführung von Standesämtern, kirchliche Trauung freiwillig
5. Ausarbeitung der Bestimmungen über die Art der Schutzzölle aufgrund der Gründerkrise
Kompromißbildung mit dem Zentrum, zur Bedingung, denn die Konservativen betrachteten die Kirche nicht als Gegner, sondern als Halt für die Gesellschaft und somit auch als Stütze für den Staat.
Folgen
Auch Bismarck musste den Mißerfolg seiner Maßnahmen einsehen, denn nichts hatte die Katholiken wirklich getroffen. Zwar waren alle preußischen Bischöfe verhaftet oder ausgewiesen und viele Pfarreien gar nicht mehr besetzt, aber das Zentrum erhielt immer mehr Stimmen in den Reichstagswahlen und war auf dem besten Weg die Mehrheit zu erlangen. Deswegen musste Bismarck, dessen Zusammenarbeit mit den Liberalen nicht mehr der von ihm gewünschten Richtung folgte, die Konservativen für sich gewinnen. Sehr gelegen kam ihm daher 1878 der Tod Pius IX., denn dessen Nachfolger Papst Leo XIII. war an einer Aufhebung der Streitigkeiten interessiert. So einigte man sich dann in einem Kompromiß: Viele der Gesetze des Kulturkampfes wurden wieder rückgängig gemacht, aber die staatliche Schulaufsicht, der „Kanzelparagraph“ und die „Zivilehe“ blieben bestehen.
Die Liberalen wurden durch die Niederlage im Kulturkampf und nicht zuletzt auch aufgrund des Bündniswechsels Bismarcks stark geschwächt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kulturkampf?
Der Kulturkampf (1871-1878) bezeichnet die Auseinandersetzung zwischen dem Staat und der Kirche darüber, wer die kulturellen Grundzüge der Gesellschaft bestimmen sollte.
Was waren die Ursachen des Kulturkampfes?
Die Ursachen waren vielfältig, darunter die Zurückdrängung des kirchlichen Einflusses seit der Französischen Revolution, die Reaktion des Vatikans auf die italienische Einigung mit der "Syllabus errorum", das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma von 1870 und Bismarcks Wahrnehmung des Zentrums als staatsgefährdender Feind.
Welche Rolle spielte Bismarck im Kulturkampf?
Bismarck sah im Zentrum eine Gefahr für den Staat und wollte den Einfluss der Kirche auf die Politik ausschalten. Er nutzte den Kulturkampf, um seine Innenpolitik zu koordinieren und die Zusammenarbeit des Zentrums mit Minderheiten zu unterbinden.
Welche Maßnahmen wurden im Kulturkampf ergriffen?
Zu den Maßnahmen gehörten der "Kanzelparagraph", die staatliche Schulaufsicht, das Verbot des Jesuitenordens, die "Maigesetze" zur Regelung der Einstellung von Geistlichen, die Einführung der "Zivilehe" und die Streichung finanzieller Zuwendungen an die Kirche.
Wie reagierte die Kirche auf die staatlichen Maßnahmen?
Der Papst rief die Gläubigen zur Nichtbeachtung der staatlichen Bestimmungen auf, woraufhin der Staat mit Geld- und Haftstrafen reagierte. Papst Pius IX. erklärte die staatlichen Bestimmungen für ungültig und drohte allen, die sich daran hielten, mit Kirchenausschluss.
Warum beendete Bismarck den Kulturkampf?
Bismarck musste feststellen, dass seine Maßnahmen die Katholiken nicht wirklich trafen und das Zentrum immer mehr Stimmen gewann. Aufgrund von politischen Differenzen in der Zollpolitik benötigte er die Unterstützung der Konservativen, was eine Aussöhnung mit dem Zentrum zur Bedingung machte.
Welche Folgen hatte der Kulturkampf?
Viele Gesetze des Kulturkampfes wurden wieder rückgängig gemacht, aber die staatliche Schulaufsicht, der "Kanzelparagraph" und die "Zivilehe" blieben bestehen. Die Liberalen wurden geschwächt, während das Zentrum gestärkt aus dem Konflikt hervorging. Mit den Katholiken entstand neben den nationalen Minderheiten und den Arbeitern eine weitere Gruppe, die sich nicht mit dem deutschen Kaiserreich identifizieren konnte.
Wer war Papst Leo XIII. und welche Rolle spielte er bei der Beendigung des Kulturkampfes?
Papst Leo XIII. war der Nachfolger von Pius IX. und an einer Aufhebung der Streitigkeiten interessiert. Er ermöglichte eine Einigung und Kompromissbildung mit Bismarck, wodurch der Kulturkampf schließlich beendet wurde.
Was ist der "Kanzelparagraph"?
Der "Kanzelparagraph" drohte Geistlichen Strafen an, wenn sie staatliche Angelegenheiten in aufwieglerischer Weise im Amt behandelten.
Was versteht man unter "Ultramontanismus"?
"Ultramontanismus" (lat. ultra montes 'jenseits der Berge') ist eine Bezeichnung für den deutschen politischen Katholizismus, der die Ansprüche des Papstes über die der eigenen Nation stellt.
- Quote paper
- Sebastian Plappert (Author), 2001, Die Geschichte des Kulturkampfs zwischen Staat und Kirche in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101045