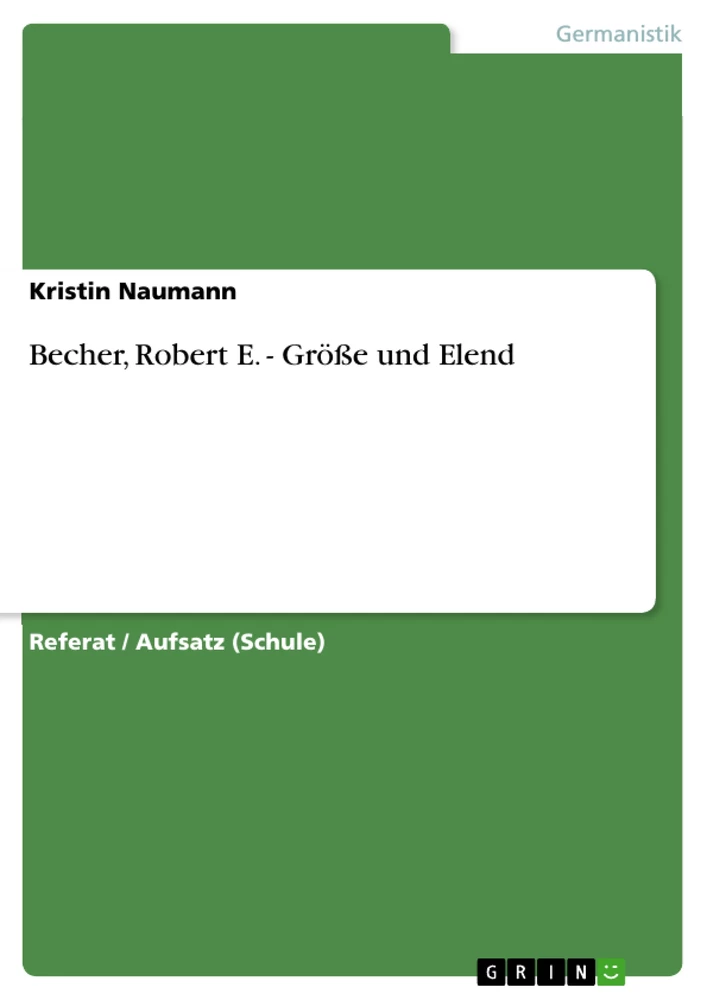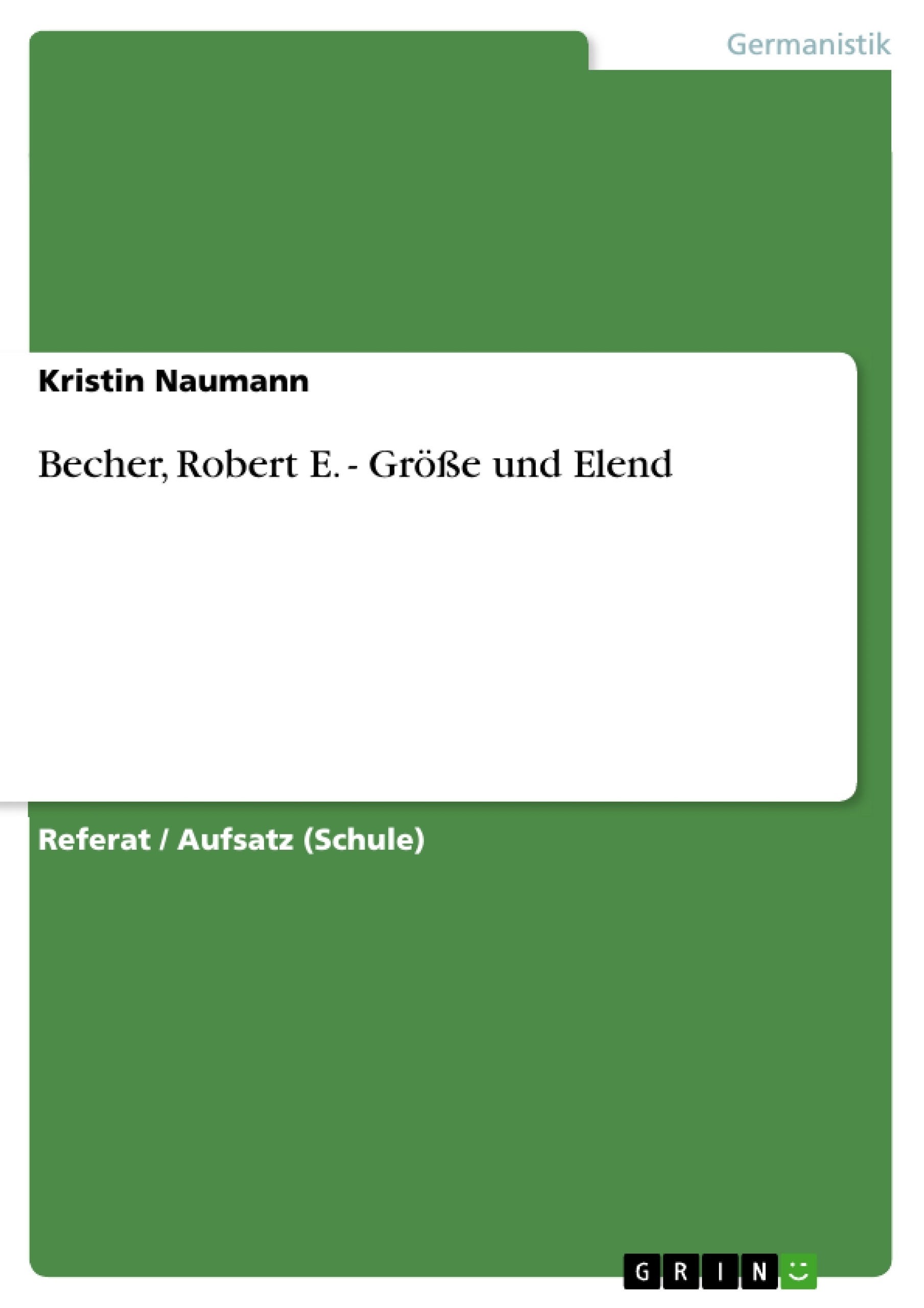Was macht den Menschen wirklich aus? Ist es die strahlende Fassade des Fortschritts und der Errungenschaften, oder verbirgt sich dahinter ein Abgrund aus Fehlern und dunklen Taten? Johannes R. Bechers Gedicht "Größe und Elend", entstanden in der widersprüchlichen Atmosphäre der DDR, wagt einen schonungslosen Blick auf die menschliche Natur. Es ist ein Sonett, das in Kreuzreimen und ohne feste Metren die Frage nach der Essenz des Menschseins aufwirft. Der Autor feiert zunächst die "wahrheitstiefen und farbenprächtigen" Leistungen in Architektur, Kunst und Wissenschaft, den Aufstieg "bis in die Stratosphäre". Doch dieser Lobgesang wird jäh unterbrochen durch die Anklage gegen "Irrtum und falsche Lehre", gegen die Abgründe der Geschichte und die dunklen Seiten der menschlichen Seele. Ist der Mensch also ein "nichtiges und niederträchtiges" Wesen, oder steckt mehr dahinter? Becher findet die Antwort in der Versöhnung der Gegensätze: Der Mensch ist beides – Größe und Elend, Gut und Böse. Diese dialektische Einheit macht ihn erst vollkommen. Wahre Größe liegt darin, sich von der bösen Seite abzuwenden und das Gute zu wählen. Das Gedicht, reich an Ausrufezeichen, kurzen Sätzen und Ellipsen, ist ein eindringlicher Appell an die Menschlichkeit, eine Aufforderung, die eigenen Fehler zu erkennen und anzunehmen, denn "Nobody ist perfect!". Es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Widersprüchen des menschlichen Daseins, die den Leser dazu anregt, über die eigene Rolle in der Welt nachzudenken. Bechers Werk ist nicht nur ein Gedicht, sondern ein Spiegel, der uns unsere Stärken und Schwächen vor Augen führt und uns dazu auffordert, ein besseres Verständnis für uns selbst und für unsere Mitmenschen zu entwickeln. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzen wollen, insbesondere im Kontext deutscher Lyrik und sozialistischer Literatur. "Größe und Elend" ist ein Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Natur, ein zeitloses Werk, das auch heute noch seine Relevanz besitzt und zum Nachdenken anregt.
Kristin Naumann
Interpretation des Gedichts
„Größe und Elend“ von Robert E. Becher
Der Mensch - ein Wesen, welches gerne an die Spitze der Evolution gestellt wird, ein Wesen, was alle anderen Individuen auf dieser Erde überragt und das Beste zu sein scheint. Doch ist es wirklich so?
Der Mensch – was ist er eigentlich? Ein Lebewesen mit jeweils zwei Armen und Beinen, Lunge, Herz und Niere, der ein durchschnittliches Lebensalter von 80 Jahren erreicht und während seines Leben ungefähr 3000 Billigramm Vitamin C verbraucht. Doch sagt uns dies wirklich alles? Soll dies die Begründung für die uns so oft zugewiesene Perfektheit sein, mit der wir allen anderen Wesen überlegen sind? Ich finde, um dies herauszufinden, sollte man sich von der äusseren Hülle lösen und in das Innere des Menschen schauen und eine andere Fragestellung benutzen: Wie ist er? Mit der Aufgaben, eine Antwort zu dieser Frage zu finden, befassten sich in vergangenen Zeiten schon viele Wissenschaftler, Psychologen und auch Literaren. Alle kamen sie zu unterschiedlichen Meinungen und Ansichten über das Individuum, mit dem wir jeden Tag verkehren und das wir letztendlich auch selbst sind. Eine Differenzierung des Wesen Mensch ist berechtigt, denn keiner ist so wie sein gegenüber – und dies nicht nur auf sein Aussehen bezogen. Im Charakterbild hat jeder seine Vorzüge und auch Nachteile – der eine mehr, der andere weniger. Doch machen nicht erst diese kleinen und großen Fehler einen charakterstarken Menschen aus? Mit einem klarem ‚Ja‘ beantwortete Johannes R. Becher diese Frage in seinem 1958 erschienen Gedicht „Größe und Elend“, in welchem er sowohl die positiven wie auch negativen Eigenschaften des Menschen beleuchtete, beides von einander getrennt bewertet, um es dann doch wieder in einer Einheit verschmelzen zu lassen und daraus die Antwort abzuleiten - er möchte nicht differenzieren, sondern verbinden. Entstanden in einer Zeit der sozialistischen Verankerung (1954 wurde Becher Minister für Kultur der DDR) und in einem Widerspruch zwischen politische und dichterischen Ansichten lebend, entstand dieses in einer Sonettform geschriebenes und mit Kreuzreimen verbundenes, jedoch ohne feste Metren verbundenes Gedicht, welches meiner Meinung nach eine sehr wichtige Lebensphilosophie in sich vereint. Um diese aber erkennen und verstehen zu können, bedarf es einer genauen „Untersuchung“, um auch die Erkenntnisse und Wahrheiten zwischen den Zeilen lesen zu können. Dies möchte ich heute einmal versuchen.
Beginnen wir mit der ersten Strophe – dem Loblied auf die Menschen. Die Errungenschaften der Menschen in der Architektur, der Kunst, sowie Literatur, werden als „wahrheitstief und farbenprächtig“ gelobt, er schaffte es sogar sich vom Erdboden abzugrenzen und „bis in die Stratosphäre“, ein Metapher für die Errungenschaften der Luftfahrt, aufzusteigen. All dies haben die Menschen geschaffen – ihr Leben verbessert und mit den Wundern der Technik, sowie den Künsten ausgekleidet – „Dem Menschen Ruhm und Ehre!“, wie es Becher als Siegesruf an den Menschen formulierte. Der Mensch hat das alles geschaffen – eine These, welche die Kraft und Macht des Menschen hervorhebt.
Jedoch kommt in der zweiten Zeile die Ernüchterung. Schnell verliert man sich in den Lobreden, in den Auszeichnungen für die geleisteten guten Taten, und vergisst darüber auch die real existierenden dunkle Kapitel, für welche man sich ebenfalls verantworten und für die man stehen muss. In sachlichen, harten und wahren Worten klagt Becher die Menschen an. „Wie viel an Irrtum und an falscher Lehre [der Mensch doch sei]!“, so formulierte es Becher in der zweiten Strophe und schnitt damit das wohl grauenvollste und auch schmerzlichste Kapitel in der unseren Geschichte an – die versuchte Übernahme der Weltherrschaft durch die Nationalsozial-isten unter der Führung Adolf Hitlers. Es wurde viel falsch gemacht und dies nicht nur auf die Zeit um ’45 bezogen, und diese Unwahrheiten, als das einzig richtige und Beste deklariert, verbreitet. Der Mensch sah nicht das ankommende Unheil oder auch oft genug verschloss er die Augen davor, wofür er sich nun verantworten muss. Eigentlich, im Grunde betrachtet, ist der Mensch nichtig und niederträchtig, ein Lebewesen, dem nichts heilig ist und der alles machen kann, selbst das allerschlimmste Verbrechen – so urteilt Becher in der zweiten Zeile und bildet eine Antithese, den vollkommenen Widerspruch zum vorher gesagten. Doch was soll man nun glauben? Ist der Mensch nun ein bewundernswertes Wesen, dem der „Thron“ der Welt mit Recht zusteht? Oder ist er auch nur ein Glied in der Kette des Lebens, welches zwar den Vorteil des Denkens und Kombinierens gegenüber den anderen Lebewesen in der Natur besitzt, doch schon oft genug dieses Privileg missbraucht und für seine Pläne, welche mehr als einmal alles andere als human waren, benutzt? Für welche der beiden Seiten soll man sich nun entscheiden?
Diese Frage beantwortet Becher in der dritten Strophe ganz präzise, indem er meint: „Ein Wesen, das in sich vereint du trennt/ Das menschlich Gute und das menschlich Böse.“ Eine Synthese der ersten beiden Strophen, durch Gegenüberstellung in Zusammenhang gebracht und als dialektische Einheit dargestellt, woraus schliesslich die Erkenntnis gewonnen wird: Der Mensch ist etwas bewundernswertes, denn er vereint in sich sowohl Gutes wie auch Böses, obwohl die se Kombination als einzelnes gesehen sehr widersprüchlich ist.
Doch dies ist genau das was einen guten Menschen ausmacht – so wie es uns Becher in der vierten Strophe erklärt. Der Mensch ist in sich vollendet – er kann aus sich herausgehen bzw. sich von jeder Seite, ob nun von der bösen oder der guten, lossagen, wobei die Abwendung von der Bösen und hin zur Guten Seite die wahre Erfüllung ist. Damit erhält der Mensch Grösse und kann mit dem Zwiespalt der Seele – der Haupterkenntnis des Gedichtes – leben und auch umgehen.
Hinsichtlich der sprachlichen Gestaltung ist häufige Verwendung von Ausrufezeichen markant, doch dies hat einen Grund. Becher wollte damit seinen Aussagen mehr Nachdruck verleihen, was zudem noch durch die sehr kurzen und somit prägnanten Sätze und zahlreichen Ellipsen verstärkt wird.
Metapher verwandt Becher sehr sparsam, lediglich in der ersten Strophe, sowie in der zweiten sind solche zu finden.
Nachdem ich mir dieses Gedicht immer und immer wieder durchgelesen habe, erlangte ich zu einer sehr wichtigen Kenntnis, welche meiner Meinung nach sich jeder Mensch immer wieder und besonders beim Umgang mit anderen Mensch vor Augen halten sollte: Der beste Mensch, ist jener welcher das Gute und Böse in dich erkennen kann – denn: „Nobody ist perfect!“ Jeder hat Fehler, aber sind es nicht die, die einen Menschen so liebenswert machen?
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Interpretation des Gedichts „Größe und Elend“ von Robert E. Becher?
Die Interpretation des Gedichts „Größe und Elend“ von Robert E. Becher befasst sich mit der Frage, was den Menschen ausmacht. Es werden sowohl die positiven Errungenschaften und Fähigkeiten des Menschen als auch seine negativen Eigenschaften und Fehltritte beleuchtet. Das Gedicht versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob der Mensch wirklich das perfekte Wesen ist, als das er oft dargestellt wird.
Welche positiven Aspekte des Menschen werden im Gedicht hervorgehoben?
Im Gedicht werden die Errungenschaften des Menschen in den Bereichen Architektur, Kunst und Literatur gelobt. Auch die Fähigkeit des Menschen, sich über seine irdischen Grenzen hinaus zu entwickeln, wird positiv hervorgehoben. Der Mensch hat sein Leben verbessert und mit den Wundern der Technik und der Künste ausgeschmückt.
Welche negativen Aspekte des Menschen werden im Gedicht kritisiert?
Das Gedicht kritisiert die Irrtümer und falschen Lehren, die vom Menschen verbreitet wurden. Es wird insbesondere auf die dunklen Kapitel der Geschichte angespielt, wie die Zeit des Nationalsozialismus. Der Mensch wird als nichtig und niederträchtig dargestellt, als ein Lebewesen, dem nichts heilig ist und das zu schlimmsten Verbrechen fähig ist.
Wie löst das Gedicht den Widerspruch zwischen den positiven und negativen Aspekten des Menschen?
Das Gedicht löst den Widerspruch, indem es feststellt, dass der Mensch sowohl Gutes als auch Böses in sich vereint. Diese Kombination mag widersprüchlich sein, ist aber genau das, was den Menschen ausmacht. Ein guter Mensch ist in der Lage, aus sich herauszugehen und sich von der bösen Seite abzuwenden, um zur guten Seite zu gelangen. Dies ermöglicht es dem Menschen, Größe zu erlangen und mit dem Zwiespalt seiner Seele zu leben.
Welche sprachlichen Mittel werden im Gedicht eingesetzt?
Das Gedicht verwendet häufig Ausrufezeichen, um den Aussagen mehr Nachdruck zu verleihen. Zudem werden kurze und prägnante Sätze sowie zahlreiche Ellipsen eingesetzt. Metaphern werden eher sparsam verwendet, hauptsächlich in der ersten und zweiten Strophe.
Was ist die wichtigste Erkenntnis aus dem Gedicht?
Die wichtigste Erkenntnis aus dem Gedicht ist, dass der beste Mensch derjenige ist, der das Gute und Böse in sich erkennen kann. Niemand ist perfekt, und es sind oft die Fehler, die einen Menschen liebenswert machen. Diese Erkenntnis sollte man sich immer wieder vor Augen führen, besonders im Umgang mit anderen Menschen.
- Quote paper
- Kristin Naumann (Author), 2001, Becher, Robert E. - Größe und Elend, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100976