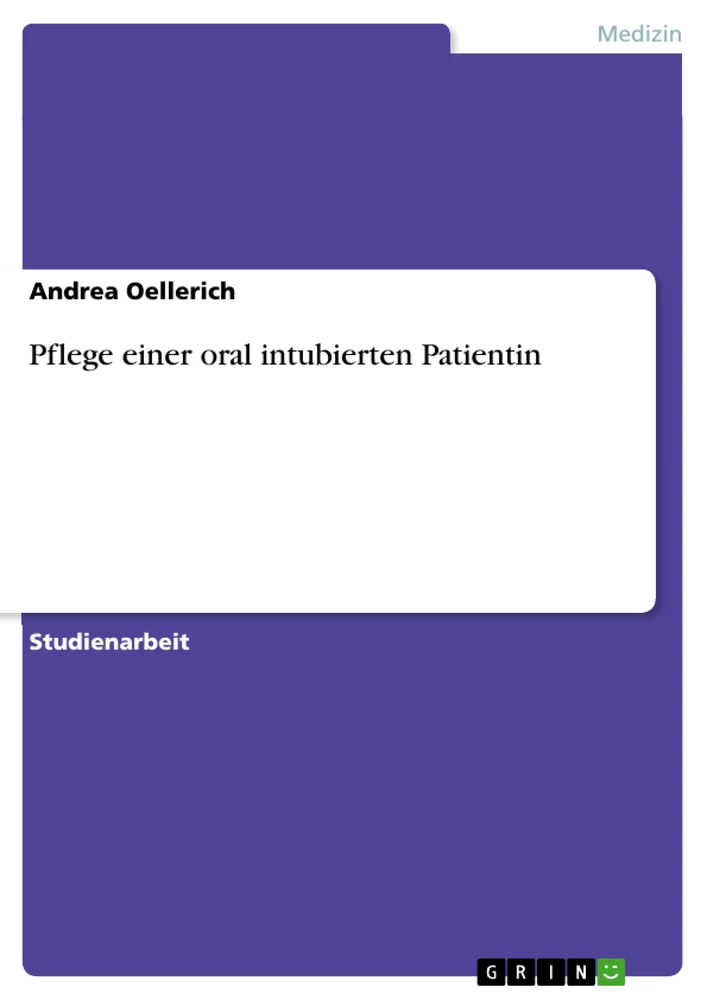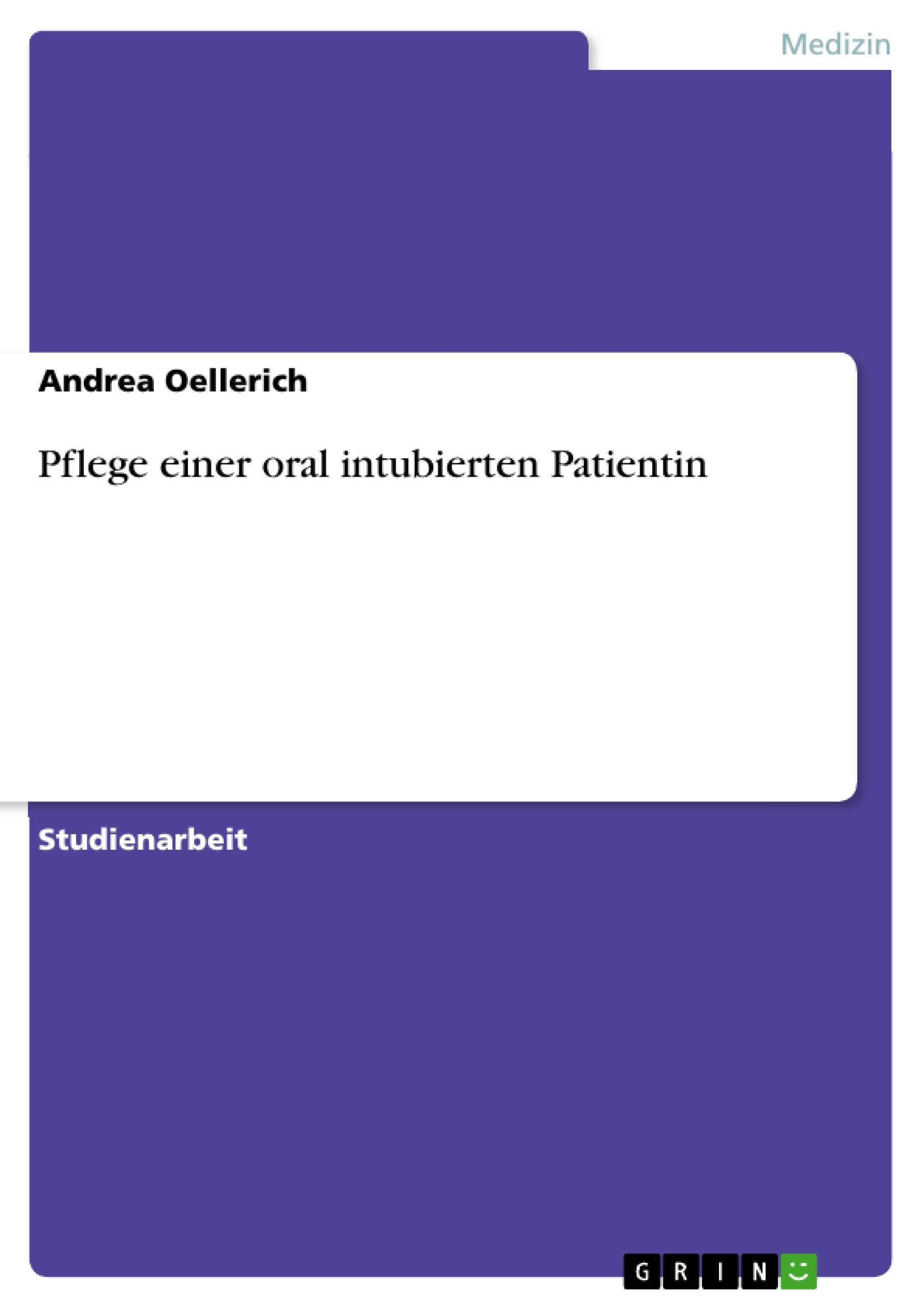Pflege eines oral intubierten Patienten
1 Pflegesituation – Pflegekonzepte ( 1. Ebene )
1.1 Pflegesituation aus Sicht der Pflegenden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2 Pflegesituation aus Sicht der Patienten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.3 Pflegesituation aus Sicht der Angehörigen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.4 Pflegesituation aus Sicht des Arztes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.5 Pflegesituation aus Sicht der verschiedenen Dienste
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2 Mögliche pflegerische Zielsetzungen ( 2. Ebene )
2.1 Pflegen als Haltungskompetenz
Biographie
- Reflexion eigener Erfahrungen mit Atemnot
- Reflexion eigener Erfahrungen mit Untersuchungen im Mund- und Rachenraum und damit verbundenen Würgereizen
- Reflexion eigener Erfahrungen mit Krankenhausaufenthalten
- Reflexion eigener Erfahrungen von Zuständen der Hilflosigkeit, sowohl als Patient und als Angehöriger
- Reflexion des Gefühls bei Verständigungsproblemen
- Reflexion der eigenen Probleme und Ressourcen
- Akzeptanz der Individualität des Patienten und seiner Angehörigen und deren Ressourcen im Umgang mit der Intensivmedizin
Beruf
- stellt die Bedürfnisse des Patienten ins Zentrum, die Ressourcen werden erhalten und gegebenenfalls erweitert
- pflegt nach neuesten Erkenntnissen
- misst der Einbeziehung der Angehörigen bei der Betreuung der Patienten große Bedeutung bei
- verhält sich Patient und Angehörigen gegenüber empathisch, ohne dabei die eigenen Grenzen dabei aus dem Auge zu verlieren
- betrachtet die psychische Betreuung als genauso wichtig, wie die medizinisch-pflegerische Versorgung
- Teilnahme an Teambesprechungen, Supervisionen und Fortbildungen gehören zum Berufsverständnis
- nimmt Patient und Angehörige in ihren Bedürfnissen ernst
- koordiniert Tagesabläufe im Sinne des Patienten
Institution
- identifiziert sich mit den Zielen und dem Pflegeleitbild des Krankenhauses
- reflektiert das eigene Pflegeverständnis im Bezug auf das Pflegeleitbild
- reflektiert die Realisierbarkeit neuer Möglichkeiten
- erkennt und nutzt die Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung und der Selbstpflege
- reflektiert den besonderen Status der Intensivstation
Gesellschaft
- reflektiert, dass die Gesellschaft Intensivmedizin mit dem Streben des Patienten häufig gleichsetzt
- reflektiert die Bedeutung von Krankheit und Hilflosigkeit in unserer Gesellschaft
- reflektiert die Bedeutung von Atmen in unserer Gesellschaft
- reflektiert die Bedeutung von Kommunikationsstörungen in unserer Gesellschaft
2.2 Pflegen als Planungsprozess
Problemlösung
- Pflegeprozess nach Nancy Rooper
- Erfassung der Probleme und Ressourcen mit dem Patienten
- Planung erreichbarer Ziele gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Patienten
- Evaluation unter Einbeziehung des Patienten und seiner Angehörigen
Organisationsbedingungen
- Bezugspflege
- Kooperation und Kommunikation zwischen allen Berufsgruppen ( Teamarbeit )
- Besuchszeiten im Interesse der Patienten und im Rahmen des Möglichen gestalten
- Auszubildende werden je nach Ausbildungsstand in die Pflege integriert ( Mentoren )
- bereitstellen einer festen Fachkraft als Bezugsperson ( Dienstplan ), sowie erstellen von Einarbeitungsmappen für neue Mitarbeiter
- bereitstellen von Informationsmaterial für Angehörige
- Patient auf den Tagesablauf Einfluss nehmen lassen, bezogen auf die Pflegetätigkeiten
- Betreuung und Wartung der medizinischen Geräte durch die medizintechnische Abteilung
- Dienstplangestaltung mit ausreichend fachlich kompetentem Personal
Beziehungsaufbau
- Gesprächsangebot richtet sich nach den Bedürfnissen des Patienten und seinen Angehörigen
- nonverbale Signale aufnehmen und darauf eingehen
- Fragen entwickeln auf die der Patient mit „Ja „ oder „ Nein“ antworten kann
- regelmäßige Bezugsperson ermöglicht Vertrauensaufbau
- Kompetenz im Umgang mit technischen Geräten gibt Sicherheit
- Kompetenz ermöglicht Ruhe in Akutsituationen
- eigene Gefühle mitteilen
Qualitätssicherung
- regelmäßige Überprüfung der Pflegeplanung und Dokumentation im Team
- regelmäßige Fort – und Weiterbildung über pflegerische Tätigkeiten und den Umgang mit medizinischen Geräten
- umfassende, geplante und kompetente Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Auszubildenden
- Kommunikationsstörungen im Team nachgehen, da diese sonst dem Erreichen gemeinsamer Ziele im Wege stehen könnten
2.3 Handlungkompetenz
Unterstützen der Selbstpflegetätigkeiten
LA für eine sichere Umgebung sorgen :
- regelmäßige engmaschige Kontrolle und Dokumentation der Beatmungsparameter
- regelmäßige engmaschige Kontrolle und Dokumentation der Vitalparameter
- patientengerechte Einstellung der Alarmgrenzen am Monitor
- verhüten von Infektionen
- sichere Fixierung des Tubus ( Beißschutz )
- sichere Fixierung der ZVK´s
- Platzierung der Kabel beachten
- vermeiden von Einschnürungen oder Decubiti durch Tubusband oder Fixierung der Magensonde
- Fachkompetenz signalisieren
- Klingel in Reichweite des Patienten hängen
LA Kommunizieren
- Gesprächsbereitschaft signalisieren
- nonverbale Signale aufnehmen und darauf reagieren
- Zeit zur Kommunikation geben und nehmen ( Geduld )
- Alternativen z.B. Schreibtafel berücksichtigen
- Patient über Verhaltenserfordernisse und therapeutische Maßnahmen aufklären
- beratendes und helfendes Gespräch mit Patienten und Angehörigen führen
- Ruhe vermitteln durch verbale und nonverbale Kommunikation
- wahrnehmen und akzeptieren der Gefühle und Stimmungen des Patienten
- Fragen stellen, auf die der Patient mit „ja“ oder „nein“ antworten können
LA Atmen
- beobachten der Hautfarbe
- beobachten und erfassen der Atemsituation
- Vitalzeichenkontrolle und Dokumentation
- Hochlagerung des Oberkörpers
- Beatmungsschema nach AVO
- Inhalation durchführen laut AVO
- Atemgymnastik, Atemtherapie in Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten laut AVO
- Anleitung zum produktiven Abhusten
- für Ruhe sorgen
LA Essen und Trinken
- auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten
- parenterale Ernährung über ZVK nach Schema und AVO
LA Ausscheiden
- Flüssigkeitsbilanz
- Hilfe bei der Ausscheidung ( Intimsphäre wahren )
- Beurteilung und Dokumentation der Ausscheidungen
LA sich sauber halten und kleiden
- Übernahme und Unterstützung der gesamten Körperpflege
- Inspektion von Haut und Schleimhaut
- Mund- und Tubuspflege
- Nasenpflege ( Magensonde )
- Durchführung der Prophylaxen
LA sich bewegen
- Lagerungswünsche des Patienten berücksichtigen
- spezielle Lagerungstechniken zur Lockerung des Bronchialsekretes anwenden
- Atemerleichternde Lagerung
- stufenweise Mobilisation in Abhängigkeit von der Atemsituation
LA arbeiten und spielen
- Möglichkeiten schaffen zum Radio hören oder fernsehen
- Möglichkeiten zum lesen anbieten
LA sich als Mann oder Frau fühlen
- Intimsphäre wahren
- Berührungsängste der Angehörigen abbauen
LA Schlafen
- auf Ruhephasen des Patienten Rücksicht nehmen
- auf Schlafgewohnheiten eingehen
- Tag- Nacht Rhythmus einhalten
- für Ruhe sorgen
LA Sterben
- Angst vor der Lebensbedrohung relativieren
- Angst vor der Intensivstation ( Assoziation – Sterben ) durch Informationen relativieren
Begleiten in besonderen Lebenssituationen
- Geduld in der Kommunikation
- Empathie
- Ausnahmezustand des Patienten bedenken
- Einbeziehung der Angehörigen
- Zukunftsängste
Assistieren bei diagnostischen, therapeutischen und präventiven Maßnahmen
- Vitalzeichenkontrolle
- therapeutische Dienste konsultieren
- fachgerechte Dokumentation
- verabreichen von Medikamenten und Infusionen laut AVO
- Wirkung und Nebenwirkungen überprüfen
- überprüfen der Beatmungsparameter
Beraten in Anpassungsprozessen
- Beratung von Patienten und Angehörigen über Luftnot
- Beratung über das Wiedererlangen der Sprechfähigkeit nach entfernen des Tubus
- Beratung über Funktion und Sicherheit der Geräte
- Beratung über Hygienevorschriften im Intensivbereich
Fördern einer sinnstiftenden Lebensgestaltung
- individuelle Gewohnheiten berücksichtigen und im Rahmen des möglichen umsetzen
- Hygienevorschriften evtl. etwas erweitern im Bezug auf das Behalten von persönlichen Gegenständen am Bett
3 Fachdidaktische Fragestellungen ( 3. Ebene )
3.1 WER sind die Lernenden und Lehrenden
Lernende sind Krankenpflegeschüler/innen
- Alter 19 – 36 Jahre
- Pflegeerfahrung ist vorhanden
- Lernende befinden sich im 3. Ausbildungsjahr Lehrende sind Lehrer für Pflegeberufe
- mit Erfahrung im Umgang mit Intensivpatienten
- mit Erfahrung im Umgang mit medizinisch – technischen Geräten
Betroffene Patienten und Fachpflegekräfte der Intensivstation werden als Experten hinzugezogen.
3.2 WAS sind die zentralen Probleme
Das zentrale Problem ist die Erfassung der elementaren Einschränkungen des oral intubierten und beatmeten Patienten im vitalen und kommunikativen Bereich.
Wie kann ich einen oral intubierten Patienten fachkompetent pflegen und genügend Zeit investieren ( im Rahmen der organisatorischen Bedingungen ), ihn bedürfnisorientiert zu betreuen, unter der Berücksichtigung der eigenen Grenzen?
Neu zu erlernende Handlung:
- Die Schüler lernen die Vor- und Nachbereitung, sowie die Durchführung des endotrachealen Absaugens in Anwesenheit einer ausgebildeten Krankenschwester
- Die Schüler lernen die Vor- und Nachbereitung, sowie die Durchführung der Mund-, Nasen- und Tubuspflege
- Die Schüler lernen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln mit den Patienten zu kommunizieren und unterstützen den Patienten in seiner momentanen Lebenssituation unter Berücksichtigung seiner individuellen Bedürfnisse und unter Berücksichtigung der eigenen Grenzen
Konkret
LA für eine sichere Umgebung sorgen
- Wie stelle ich Alarmgrenzen am Monitor patientengerecht ein?
- Wie kann ich die Gefahr von Infektionen maximal eingrenzen?
- Wie kann ich eine sichere Fixierung der lebensnotwendigen Zugänge erreichen?
- Wie kann ich Druckstellen und Einschnürungen vermeiden
- Wie verschaffe ich dem Patienten ein Gefühl von Sicherheit?
LA Kommunizieren
- Wie kann ich meine Gesprächsbereitschaft signalisieren
- Welche Mittel kann ich einsetzen, um mit dem Patienten, der nicht sprechen kann, zu kommunizieren?
- Wie kann ich nonverbale Signale des Patienten aufnehmen und darauf reagieren?
- Wie kann ich die Angehörigen mit dieser Art der Kommunikation vertraut machen?
- Wie kann ich verbal und nonverbal Ruhe vermitteln?
- Wie kann ich den Angehörigen in ihrer Angst und Hilflosigkeit helfen?
LA Atmen
- Mit welchen Kriterien kann ich die Atemsituation des Patienten erfassen und wie kann ich in Notfallsituationen richtig reagieren?
- Wie kann ich Paniksituationen vermeiden?
- Was ist bei der Vor- und Nachbereitung, sowie bei der Durchführung des endotrachealen Absaugens zu beachten?
- Was ist bei der Vor- und Nachbereitung, sowie bei der Durchführung der Mund-, Nasen- und Tubuspflege zu beachten?
- Wie ist ein Tubus sicher und richtig fixiert und platziert?
- Wie kann ich die Atmung des Patienten erleichtern und ihn zum produktiven Abhusten anregen?
- Welche Maßnahmen zur Atemtherapie gibt es?
LA Essen und Trinken
- Wie kann ich feststellen, ob der Patient mit genügend Flüssigkeit versorgt ist?
- Was muss ich beachten, wenn ein Patient parenteral ernährt wird?
LA Ausscheiden
- Wie kann ich eine korrekte Flüssigkeitsbilanz erstellen und dokumentieren?
LA sich sauber halten und kleiden
- Worauf muss ich achten, wenn ich den Patienten wasche?
- Wie kann ich bei der gesamten Körperpflege darauf achten, möglichst wenig Manipulationen am Tubus zu bewirken?
LA sich bewegen
- Wie kann ich die Lagerung des Patienten atemerleichternd und atemtherapeutisch durchführen?
LA Arbeiten und spielen
- Welche Möglichkeiten der Unterhaltung und Beschäftigung kann ich dem Patienten zur Verfügung stellen?
LA sich als Mann oder Frau fühlen
- Wie kann ich die Berührungsängste der Angehörigen abbauen?
LA Schlafen
- Wie kann ich trotz intensivmedizinischer Betreuung einen Tag/Nacht Rhythmus einhalten?
- Wie kann ich Patienten die Angst nehmen einzuschlafen?
- Wie kann ich organisatorisch darauf Einfluss nehmen, dem Ruhebedürfnis des Patienten gerecht zu werden?
LA Sterben
- Mit welchen Informationen muss ich Patient und Angehörige versorgen, damit „Tod und Sterben „ nicht gleichgesetzt wird mit Intensivstation ?
3.3 WANN ? Zeitpunkt- Stufe- Phase
- im 3. Ausbildungsjahr
- Unterrichtsinhalte über Aufrechterhaltung der Vitalfunktion ( Atmung ) sowie spezielle Krankenbeobachtung gingen direkt voraus, ebenso Unterrichtsinhalte im Fach Psychologie über Kommunikationsstörungen.
3.4 WOZU ?
Die Lernenden können Probleme und Bedürfnisse des Patienten erkennen und sie in ihrer Dringlichkeit beurteilen und daraus Maßnahmen individuell für den Patienten ableiten, unter Berücksichtigung der eigenen Grenzen und des eigenen Handlungsvermögens.
Sie können die erforderlichen Maßnahmen, wie orales oder endotracheales Absaugen und die Mundpflege im gesamten Umfang beschreiben und im Beisein einer ausgebildeten Pflegekraft durchführen.
Sie können Angehörige und Patienten anleiten die Kommunikation mit Hilfsmitteln zu praktizieren.
3.5 WIEVIEL ? Auswahl- Gewichtung- Umfang
- soviel, dass die Lernenden die Situation von oral intubierten Patienten umfassend erkennen und einschätzen können
- soviel, dass Lernenden die individuellen Bedürfnisse des Patienten umfassend erkennen und zuordnen können und adäquate Maßnahmen mit Hilfe von ausgebildeten Pflegekräften planen und durchführen können.
- soviel, dass die Lernenden eine vertrauensvolle Beziehung zum Patienten und seinen Angehörigen aufbauen können und sie in dieser Situation beraten und begleiten können.
- soviel, dass die Lernenden die Grenzen ihres eigenen Handlungsvermögens und die Grenzen ihrer eigen psychischen Belastbarkeit einschätzen können.
- soviel, dass die Lernenden wissen, welche Komplikationen bei intubierten und beatmeten Patienten und beim Absaugen auftreten können.
- soviel, dass die Lernenden die chronologischen Abläufe des oralen, nasalen und endotrachealen Absaugens beschreiben und diese unter Anleitung fachgerecht durchführen können.
- soviel, dass die Lernenden Patienten und Angehörige zu der besonderen Art der Kommunikation mit sprechunfähigen Patienten aufklären und anleiten können.
- soviel, dass die Lernenden die Materialien für Mundpflege zusammenstellen, den
Arbeitsablauf selbstständig durchführen und dabei die Sicherheit des Patienten gewährleisten können.
3.6 WIE ? Methoden – Medien - Organisationsformen
Problemorientiert
- Erfassen der Problematik an einem Fallbeispiel ( Filmvorführung ) und anschließend
- Erarbeiten der dargestellten Probleme und Zielformulierung in Partnerarbeit danach
- Auswertung im Plenum
Prozessorientiert
- Lehrervortrag zum Thema : Komplikationen bei der Beatmung und beim Absaugen
- erneutes Aufgreifen des Fallbeispiels
- sammeln von themenbezogenen Gefühlsbegriffen im „Brain- storming „ –Verfahren im Plenum
- einfinden zum Rollenspiel zur nonverbalen Kommunikation
Produktorientiert
Sicherung der Handlungskompetenz durch
- Erstellen einer Checkliste für den chronologischen Ablauf des endotrachealen Absaugens
- Erstellen einer Liste für die zur Mundpflege notwendigen Materialien in Gruppenarbeit.
- Anschließende Auswertung im Plenum
Praxisorientiert
- Besuch einer Intensivstation, Besichtigung von Beatmungsgeräten und Monitoren
- Demonstration endotrachealen Absaugens mit anschließender Übung an der Puppe
- Kreative Zusammenstellung und Herstellung von Kommunikationshilfsmitteln.
Überprüfung der Anwendbarkeit : Lernende aus dem 2. Ausbildungsjahr werden angeleitet diese Hilfsmittel im Pflegealltag einzusetzen.
4 Literaturverzeichnis
- Arne Schäffler, Nicole Menche, Ulrike Bazlen, Tillmann Kommerell - Pflege Heute Urban & Fischer München Jena 2000
- Reinhard Larsen - Anästhesie und Intensivmedizin für Schwestern und Pfleger , 2. überarbeitete Auflage 1987, Springer –Verlag Berlin, Heidelberg, New York, London, Tokyo
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Leseprobe?
Die Leseprobe behandelt die Pflege eines oral intubierten Patienten auf einer Intensivstation. Es werden verschiedene Aspekte wie die Pflegesituation aus der Sicht verschiedener Beteiligter, pflegerische Zielsetzungen und fachdidaktische Fragestellungen beleuchtet.
Welche Aspekte der Pflegesituation werden betrachtet?
Die Pflegesituation wird aus der Perspektive der Pflegenden, der Patienten, der Angehörigen, des Arztes und der verschiedenen Dienste betrachtet. Es geht darum, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Herausforderungen der jeweiligen Akteure zu verstehen.
Welche pflegerischen Zielsetzungen werden thematisiert?
Die pflegerischen Zielsetzungen umfassen Pflegen als Haltungskompetenz (Biographie, Beruf, Institution, Gesellschaft), Pflegen als Planungsprozess (Problemlösung, Organisationsbedingungen, Beziehungsaufbau, Qualitätssicherung) und Handlungskompetenz (Unterstützen der Selbstpflegetätigkeiten, Begleiten in besonderen Lebenssituationen, Assistieren bei Maßnahmen, Beraten, Fördern einer sinnstiftenden Lebensgestaltung).
Was beinhaltet "Pflegen als Haltungskompetenz"?
Pflegen als Haltungskompetenz bezieht sich auf die Reflexion eigener Erfahrungen und Werte, um die Individualität des Patienten zu akzeptieren und eine patientenzentrierte Pflege zu gewährleisten. Es umfasst Aspekte wie Biographie, Beruf, Institution und Gesellschaft.
Was bedeutet "Pflegen als Planungsprozess"?
Pflegen als Planungsprozess beinhaltet die Anwendung des Pflegeprozesses nach Nancy Roper, die Berücksichtigung der Organisationsbedingungen (z.B. Bezugspflege, Teamarbeit), den Beziehungsaufbau zu Patient und Angehörigen und die Qualitätssicherung der Pflege.
Welche Selbstpflegetätigkeiten werden im Rahmen der Handlungskompetenz unterstützt?
Die Selbstpflegetätigkeiten, die unterstützt werden, umfassen die Lebensaktivitäten (LA) nach Roper, Logan und Tierney: für eine sichere Umgebung sorgen, kommunizieren, atmen, essen und trinken, ausscheiden, sich sauber halten und kleiden, sich bewegen, arbeiten und spielen, sich als Mann oder Frau fühlen, schlafen und sterben.
Welche fachdidaktischen Fragestellungen werden behandelt?
Die fachdidaktischen Fragestellungen umfassen die Identifizierung der Lernenden und Lehrenden, die zentralen Probleme (z.B. Erfassung der Einschränkungen des Patienten, Kommunikationsprobleme), den Zeitpunkt des Lernens, die Ziele des Lernens (z.B. Erkennen von Bedürfnissen, Durchführung von Maßnahmen), den Umfang des Lernens und die Methoden, Medien und Organisationsformen des Lernens.
Wer sind die Lernenden und Lehrenden in diesem Kontext?
Die Lernenden sind Krankenpflegeschüler/innen im 3. Ausbildungsjahr. Die Lehrenden sind Lehrer für Pflegeberufe mit Erfahrung in der Intensivpflege. Zusätzlich werden betroffene Patienten und Fachpflegekräfte der Intensivstation als Experten hinzugezogen.
Was sind die zentralen Probleme, die die Lernenden bewältigen sollen?
Die zentralen Probleme umfassen die Erfassung der elementaren Einschränkungen des oral intubierten Patienten, die fachkompetente Pflege und bedürfnisorientierte Betreuung unter Berücksichtigung der eigenen Grenzen, die Durchführung des endotrachealen Absaugens und die Kommunikation mit dem Patienten.
Welche Methoden werden für den Unterricht vorgeschlagen?
Es werden problemorientierte (Fallbeispielanalyse), prozessorientierte (Lehrervortrag, Brainstorming, Rollenspiel) und produktorientierte (Erstellung von Checklisten) Methoden vorgeschlagen, um die Handlungskompetenz zu sichern. Auch der Praxisbezug durch Stationsbesuche und Übungen am Modell wird betont.
Welche Literatur wird als Referenz angegeben?
Es werden folgende Werke als Referenz genannt: "Pflege Heute" von Schäffler, Menche, Bazlen und Kommerell, "Anästhesie und Intensivmedizin für Schwestern und Pfleger" von Reinhard Larsen und das "Hessisches Curriculum Krankenpflege" des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe.
- Quote paper
- Andrea Oellerich (Author), 2001, Pflege einer oral intubierten Patientin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100961