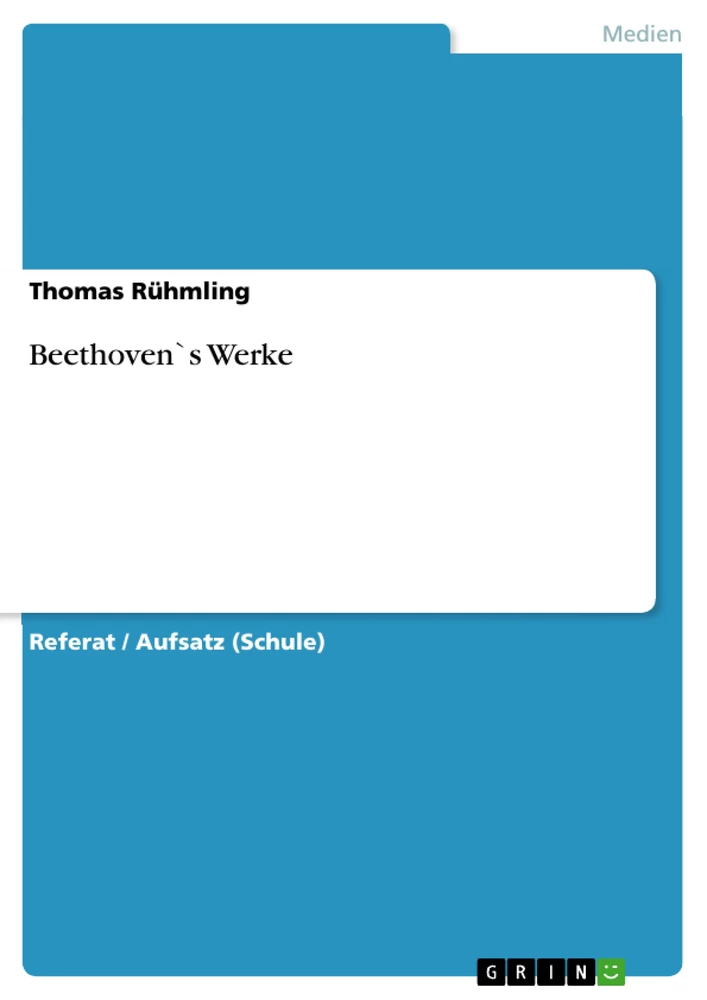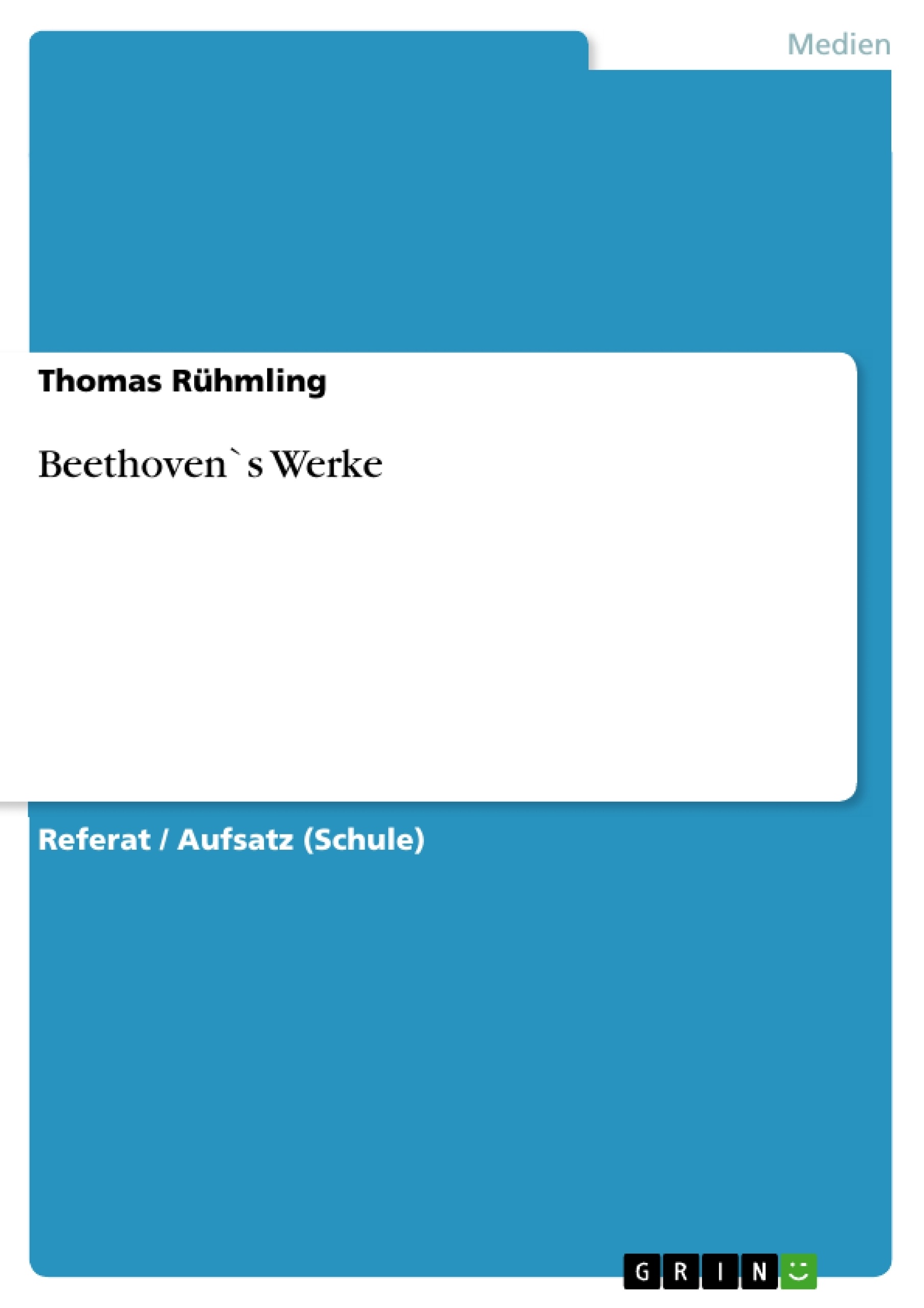Ludwig van Beethoven
Die Werke
In der Zeit seines Schaffens als Komponist, welche 1783 mit zwei Präludien durch alle 12 Tonarten für Klavier begann und mit seinem Tod in völliger Taubheit endete, schrieb Ludwig van Beethoven 138 Opera, wovon einige jedoch unterteilt sind. Es ergibt sich also eine Anzahl von 183 Kompositionen in einem Zeitraum von 43 Jahren, darunter 9 vollendete Sinfonien und eine unvollendete. Diesen Werken, die für Beethoven die Möglichkeit darstellten, sich zu entfalten, wollen wir uns zuerst widmen:
Die Sinfonien
(Thomas Rühmling)
Seine erste Sinfonie (op.21 C-Dur) schrieb Beethoven 1799, am Ende der Französischen Revolution, nachdem er sich bereits in mehreren Sonaten und Kammermusikwerken mit der großen Form auseinandergesetzt hatte. Dabei spielten sowohl Mozarts Klangästhetik, Haydns Themendialektik als auch Einflüsse aus der französischen Musik eine große Rolle, vor allem aber die Botschaft der Französischen Revolution und die Aufklärung des Sturm und Drang. Dies führte dazu, dass Beethovens erste Sinfonie eine Ausgereiftheit hat wie kaum ein Werk seiner Zeitgenossen.
Beethoven widmete diese Sinfonie dem Baron van Swieten, einem Musikkenner, der auch die Texte zu Haydns Oratorien Die Schöpfung und Die Jahreszeiten verfasste.
Obwohl sehr anspruchsvoll, erreicht die Sinfonie noch nicht die Harmonie, wie sie in der dritten Sinfonie verwirklicht ist, doch der Weg dorthin wird hier und auch in der zweiten Sinfonie schon eingeschlagen.
Was damals zwar als ungewöhnlich angesehen wurde ist der Einsatz vieler Bläser (2 Fl., 2 Ob., 2 Kl., 2 Fag., 2 Hrn., 2 Trp.) im Vergleich zu wenig Streichern, was aber schon bei Mozart vorkam. Wirklich neu ist die unsymmetrische Verschiebung bekannter Satztypen und die harmonische Verschleierung bzw. Irreführung, die sich nur an unterschiedlichen Satzanfängen entlarven lässt.
Der erste Satz dieser Sinfonie wird oft wegen seiner Ähnlichkeit mit Mozarts Jupitersinfonie (KV 551) in Verbindung gebracht, der zweite Satz ist fugenartig gestaltet, und der dritte, als Menuett überschriebene Satz ähnelt eher einem Scherzo. Der vierte Satz, Adagio, nimmt das Thema des ersten Satzes wieder auf und verändert es, indem Töne angefügt werden und rhythmisch variiert wird, und endet mit dem ersten Hauptthema.
Beethoven hat also in seiner 1. Sinfonie durch motivische Querverbindungen schon jene zyklische Einheit angestrebt, die er in den acht folgenden Sinfonien, in den Sonaten und Quartetten modellartig weiterentwickelte.
Die zweite Sinfonie (op.36 D-Dur) vollendete Beethoven im April 1803 , im Jahr des Reichsdeputationshauptschlusses, sie entstand parallel zu seinem Heiligenstädter Testament, was zu analytischen Kurzschlüssen führen kann, denn sie Sinfonie lässt nichts von einem Dem-Schicksal-in-den-Rachen-greifen spüren. Sie ist etwa um die Hälfte Länger als die erste Sinfonie und scheint in Einzelheiten von Werken Mozarts und Haydns abgekupfert zu sein. Die Besetzung ist ähnlich der ersten Sinfonie, was jedoch darüber hinaus geht ist eine eher opernhafte Dramatik: Unisono-Gänge der Streicher, chromatisch geführte Steigungen und frappante Tonartwechsel. All dies weist auf Beethovens Oper Fidelio hin, an der er seit 1803 arbeitete.
Neben diesen Neuerungen ist noch als besonders zu vermerken, dass der vierte Satz eine fast 250-taktige Coda hat, die sogar noch eine eigene Durchführung umschließt.
Schon Anderthalb Jahre später, im August 1804, hatte Beethoven seine dritte Sinfonie „Eroika“ (op.55 Es-Dur) uraufgeführt, im Jahr der Kaiserkrönung Napoleons. Er erntete von Publikum und Kritik Ablehnung, denn zu sehr unterschieden sich Länge (fast 1h) und Komplexität des Werkes von seinen vorigen Werken, es wurde als zu grell und bizarr, aber auch als sittenverderbend beschimpft. Beethoven wollte hier jedoch keine Rücksicht auf die Aufnahmefähigkeit des Publikums nehmen, das die Musik als bequemes Konsumgut sah, sondern ein anspruchsvolles Werk schaffen. Er überforderte ohne Rücksicht das Können und den spieltechnischen Standard seiner Musiker.
Den eigentlich schlichten Ausgangspunkt für dieses Werk bildet das Hauptthema der Ouvertüre aus Mozarts Jugendoper Bastien und Bastienne, doch Beethoven zerstört die schlichte Einfachheit und Behäbigkeit des Werkes, um sie in über 700 Takten sinfonisch zu entfalten. Trotz dieser Hektik hat dieser erste Satz eine fast pathetische Ruhe. Der zweite Satz ist ein durch Barocke Mittel sinfonisierter Marsch, eine musikalische Undenkbarkeit damals, während der dritte Satz ein klassisches Scherzo ist, deshalb auch damals den meisten Zuspruch fand.
Das Finale der Eroika ist oft unterschätzt worden, da es weder einen heiteren Schluss wie so oft bei Haydn, noch ein heroisches Ende wie bei Mozarts Jupitersinfonie, sondern nur einen Variationssatz mit einem Thema gibt.
1806 komponierte Beethoven seine vierte Sinfonie (op.60 B-Dur), die im Vergleich zu der dritten eher kurz ausgefallen ist (½h). Sie ist heute die am wenigsten bekannte seiner Sinfonien, obwohl Beethoven sie sehr schätzte und auch die Presse sie hoch werteten, ihre edle Simplizität fand gefallen. Für Schumann war sie die romantischste der Beethovenschen Sinfonien, und auch für Mendelssohn war sie ein Schlüsselwerk. Der Beethoven-Forscher Harry Goldschmidt sieht den Grund für diese Romantik in Beethovens Liebe zu Josephine Brunsvick, auffallend ist auf jeden Fall der Gegenpolcharakter zu den umliegenden heroischen Werken durch die Helligkeit der Melodien.
In seiner fünften Sinfonie (op.67 c-Moll), komponiert bis 1808, verwendete Beethoven erstmals damals außergewöhnliche Instrumente wie eine Piccoloflöte und 3 Posaunen. Die Skizzen für diese Sinfonie reichen bis ins Jahr 1803 zurück, und wie bei der Eroika stellt Beethoven hier noch höhere Ansprüche - sowohl an die Hörer als auch an die Musiker. Um diesem Werk die lapidare Wucht zu nehmen entstanden Mythen, doch noch immer ist dieses Werk unerreicht.
Der erste Satz vereinigt die Komplexität des Details mit einer Deutlichkeit der Großform, wie man sie sonst selten findet. Er beginnt mit einem Hauptmotiv, dass durch Fermatensetzung klar aus dem Fluss herausgehoben wird und über den ganzen Satz hinaus variiert wird, während das Seitenthema fast unverändert bleibt.
Im zweiten Satz lässt Beethoven den Kontrast zwischen Haupt- und Seitenthema voll wirken. Der dritte Satz erhielt erst bei der Partiturreinschrift seine endgültige Form, seit dem schließt er mit einer schattenhaften Überleitung zum Finale ab.
Wie sonst nur in seiner neunten Sinfonie zielt Beethoven hier im vierten Satz auf das Finale hin, hier findet man in dem Wechsel von Moll im dritten zu Dur im Vierten und pianissimo bei der Überleitung zu Fortissimo zum Finale ein perfektes Beispiel für die Durch-Nacht- zum-Licht -Apotheose.
Ebenfalls im Jahre 1808 komponierte Beethoven seine sechste Sinfonie „Pastorale“ (op.68 F-Dur), die auch zusammen mit der Fünften uraufgeführt wurde. Die beiden werden zwar oft als Zwillingsschwestern bezeichnet, haben aber einen völlig unterschiedlichen Charakter. Die fünfte Sinfonie stellt, so Beethoven, das Individuum in den Mittelpunkt, die sechste jedoch stellt den Menschen im Zusammenhang mit der Natur dar.
Ähnlichkeiten sind aber trotzdem zu finden, denn in diesen beiden Sinfonien hat Beethoven zum einigen Mal den Finalsatz aus dem dritten herauskomponiert, wobei hier in der sechsten Sinfonie jedoch ein Gewittersatz als Zwischenteil steht. Obwohl sie der Natur gewidmet ist findet sich aber nur noch eine Anspielung auf die Natur, ein Vogelstimmenmotiv am Ende des zweiten Satzes.
Beethoven bezeichnete seine sechste Sinfonie als Sinfonia charakteristica, das heißt dass es sich dabei weder um Programmmusik im Sinne des 19. Jahrhunderts noch um absolut reine Musik handelt, was wiederum heißt dass Überschriften immer noch notwendig sind.
Bei der Pastorale ist jeder Satz klar einem Thema verpflichtet. Indem sich die fünf Sätze zu einem Gesamtwerk verbinden, in dem durch die verschiedenen Eindrücke vom ländlichen Leben hindurch eine innere Anschauung von der Natur vermittelt wird, erlangt das Werk die Bedeutung eines Sinnbildes für die innere Kohärenz zwischen Mensch und Natur.
Die sechste Sinfonie rückt also das, was die fünfte vergessen ließ, wieder ins Bewusstsein: das Individuum ist nicht allmächtig, sondern hat sein Maß und einen Bezugsrahmen in der göttlichen Natur.
Während Napoleons Russlandfeldzug 1811-1812 schrieb Beethoven seine siebte Sinfonie (op.92 A-Dur), die auch einen seiner größten Erfolge darstellt. Sie wurde damals zusammen mit seinem Schlachtgemälde Wellingtons Sieg bei Vittoria (op.91), in dem der Duke Wellington Napoleon ‚musikalisch’ besiegt, uraufgeführt. Die über 5.000 Zuhörer waren begeistert von der Sinfonie, aber auch von den anderen aufgeführten Werken bei dieser Wohltätigkeitsveranstaltung.
Seinen Stellenwert gewinnt dieses Werk durch seine Beantwortung der Frage nach Materialstand und -verarbeitung.
Die siebte Sinfonie wirkt geschlossen und sehr detailliert, Beethoven hat in ihr die Sonatenhauptsatzform voll ausgeschöpft. Das motivische Material ist in ihr aus einer Grundidee und deren Metamorphosen entstanden.
Besonders zu erwähnen sind hier der zweite Satz, das Allegretto, das einen vierfach gesteigerten Klagegesang darstellt, und der vierte Satz, ein Geschwindmarsch mit fanfarenartigem Auftakt und einem sehr abrupten Ende durch zwei Schlussakkorde.
Ebenfalls bereits 1812 komponierte Beethoven seine achte Sinfonie (op.93 F-Dur), dem Jahr in dem er Goethe traf und erfuhr, dass sein Bruder in einer unehelichen Beziehung lebte sowie dem Höhepunkt seiner Beziehung zu Therese Malfatti. Sie wurde jedoch erst 1814 uraufgeführt und gefiel dem Publikum weniger, obwohl sie Beethoven als „besser als seine vorigen Werke“ pries.
Die achte Sinfonie gilt als humoristisch, sie scheint eine Satire auf alle Traditionen zu sein. Dies zeigt sich zum Beispiel im dritten Satz, wo in Takt 38 die Holzbläser dem bedeutungsvollen Trompetensignal zu Hilfe kommen wollen, jedoch zu früh einsetzen und somit die schöne Regelmäßigkeit des Metrums durcheinanderbringen. Das ist nicht das einzige Mal, dass solche Durchkreuzungen vorkommen, ebenso verhält es sich mit Tempoverzögerungen im Marsch des ersten Satzes etc.
Das Finale ist eine Kombination aus Rondo und Sonatenhauptsatzform, das harte Rückungen, synkopische Verschiebungen, scharfe dynamische Kontraste und Instrumentalkombinationen zulässt, welche Beethoven in überlegener Manier nutzt, um einen Satzverlauf zu organisieren, in dem die Grenzen zwischen dunkler und heller Stimmung, zwischen grimmiger Verbohrtheit und heiterer Gelassenheit fließend werden, wo der Ernst eines Dramas mit der Gelassenheit eines Spiels sich zu decken scheint.
1824 vollendete Beethoven dann endlich seine neunte Sinfonie (op.125 d-Moll), deren Besetzung alles bisherige sprengte: Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Triangel, Becken, Trommeln, Streicher und ein vierstimmiger gemischter Chor. Sie ist mit 75 Minuten ebenso seine längste Sinfonie und wurde von Zeitgenossen nach ihrer Uraufführung als unerhört neu empfunden. Wenn man die Spekulationen betreffend dieser Sinfonie außer Acht lässt kann man sagen, dass sie einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur Programmmusik darstellte.
Beethoven wollte in ihr zuerst einen rein instrumentalen Schluss verwirklichen, verwarf diese Idee aber zugunsten des Chorfinales wieder, da er Schillers Ode an die Freude schon ab 1793 in einem Stück verwirklichen wollte. Es ist ebenso kein Zufall, dass Solostimmen und Chor erst am Ende hinzutreten, wenn die Freudenmelodie bereits die Instrumentengruppen durchlaufen haben, sondern somit ein phänomenales Finale darstellen.
Ungewöhnlich ist dieses Stück aber nicht erst im Finale, zum Beispiel ist der zweite Satz, nicht wie sonst üblich der dritte, das Scherzo, und im idyllischen dritten Satz durchbrechen mehrmals Fanfaren die ruhige, harmonische Stimmung durch dunkles d-Moll.
Die neunte Sinfonie blieb Beethovens letztes vollendetes sinfonisches Werk, seine zehnte Sinfonie (Es-Dur) blieb unvollendet. Man weiß nur sehr wenig über dieses Werk, Skizzen, Fragmente und Dokumente sind unvollständig. In seinen Konversationsheften steht irgendwo eine kleine Notiz, die Beethovens Pläne für den Rest seines Lebens beschreibt: „Ich werde künftig nach der Art meines Großmeisters Händel jährlich nur ein Oratorium und ein Concert für irgend ein Streich- oder Blasinstrument schreiben, vorausgesetzt, dass ich meine zehnte Sinfonie und mein Requiem beendet habe.“ Das wenige, was man aus Briefen weiß, lässt sich so zusammenfassen: Die Einleitung der Sinfonie war ein sanfter Satz in Es-Dur, und ein gewaltiges Allegro in c-Moll.
Mehr ist über die Sinfonie nicht bekannt, von daher mag sich um die Zahl 9 ein Geheimnis gebildet haben. Bruckner, Dvorák, Mahler, Beethoven - sie alle kamen in ihrem Schaffen über neun vollständige Sinfonien nicht hinaus.
Die Sonaten
(David Lam)
Der junge Beethoven wurde zunächst als Klaviervirtuose bekannt, wobei man vor allem sein Talent zu improvisieren bewunderte. So führte dann auch Beethovens Weg als Komponist über das Tasteninstrument, das in seinem Schaffen eine zentrale Stellung einnimmt. Beethovens 32 Klaviersonaten, darunter besonders die Sonate Pathétique, gehören heute zu den meistgespielten Werken der klassischen Klaviermusik.
Bei der Sonate Pathétique handelt es sich um eine Komposition für das Klavier, als Thema verwendet Beethoven einen Marsch, eine Gattung also, wie sie sich in seinen späteren Werken noch öfter zeigen wird, wie oben erwähnt in der dritten, fünften, siebten und neunten Sinfonie oder der Klaviersonate op. 26.
Dieses erste Variationswerk steht am Anfang einer Serie von Meisterwerken, denn gerade in der Variationskunst blieb Beethoven, der seine Musik bis in die kleinste Zelle organisierte, unerreicht.
Schließlich wäre auch noch die Tonart c-moll zu bemerken, die dem Komponisten eine besondere Inspirationsquelle war. Es ist die Tonart berühmter Werke, wie der fünften Sinfonie, der letzten Klaviersonate, des dritten Klavierkonzerts, der Egmont-Ouvertüre oder eben der Sonate Pathétique.
Die Sonate Pathétique (Op.13) erschien 1799 und war dem Fürsten Karl Linchnowsky gewidmet, zu dem er ein besonders gutes Verhältnis hatte.
Mit der Grande Sonate pathétique, wie der Komponist selbst sein Werk nannte, legte Beethoven ein erstes sehr persönliches, von seinen Vorbildern unabhängiges Werk vor und emanzipierte sich als Komponist.
Mit einem schweren, lauten C-Moll-Akkord beginnt das Werk, Beethoven schlägt sozusagen mit der Faust auf den Tisch, schafft aber schon im ersten Takt einen starken Kontrast, indem er Klangfarbe und Dynamik ändert. Dieses erste Motiv steht wie eine Überschrift über der ganzen dreisätzigen Sonate, die einen bis dahin unbekannten Kontrastreichtum zeigt. Aber Beethoven bricht nicht mit der Tradition, sondern füllt bereits vorhandene formale Strukturen mit neuem Inhalt. Die so zerrissen wirkende Einleitung hat elf Takte und betrachtet man den ersten Takt des folgenden Allegro-Teils als Schlusstakt - harmonisch gesehen ist er das ja auch - ist diese langsame Einleitung völlig klassisch in drei mal vier Takte unterteilt. Auch die klassische Sonatensatzform, die Beethoven vorsichtig erweitert und von der er sich später ganz lösen wird, ist das Ordnungsprinzip des ersten Satzes: Das Hauptthema erklingt kraftvoll aufsteigend und synkopiert, ist dabei allerdings etwas "melodielos", besitzt aber dafür eine elektrisierende Energie. Dass Beethoven auch Melodien komponieren konnte, zeigte er ohnehin im zweiten Satz dieser Sonate. Das Seitenthema erscheint nicht in Es-Dur, wie es der Kenner erwarten würde, sondern in es-Moll und deutet in seiner motivischen Struktur bereits auf das Rondothema des letzten Satzes hin. Der Seitensatz geht in den Schlusssatz über, der sich sehr virtuos entfaltet, mit dem Hauptthema in Es-Dur schließt und harmonisch zum folgenden Teil überleitet. Nach der Exposition erklingen vier Takte mit dem Motiv der Einleitung, das auch in der sich anschließenden Durchführung Verwendung findet.
Beethoven arbeitet nun mit dem aufstrebenden ersten Thema und der dazugehörenden Begleitung, die aus einer Wechselfigur von gebrochenen Oktaven besteht und die nun erstmals auch in der Oberstimme erklingt. Eine acht Takte umspannende absteigende Achtelkette leitet in die Reprise über, in der Beethoven das Hauptthema erweitert und das Seitenthema in f-Moll beginnt, aber ziemlich schnell in die Grundtonart c-Moll moduliert und so dem klassischen Regelwerk gerecht wird. Kurz vor Schluss nimmt der Komponist noch einmal das Tempo aus dem Stück, verweist ein weiteres Mal auf die langsame Einleitung und schließt mit dem bewegten Hauptmotiv, gefolgt von einer stark akzentuierten Kadenz in c- Moll.
Von den drei Sätzen der Pathétique ist der zweite wohl der populärste.
Die achttaktige Melodie erklingt zunächst in Tenorlage und wird dann eine Oktave höher wiederholt (A). Es folgt ein erster kontrastierender Abschnitt (B), den man als instrumentales Zwischenspiel im einem Gesang verstehen könnte und der nach zwölf Takten wieder zur Melodie (A) zurückführt. Leise und in as-Moll beginnt der nächste Formteil (C) mit einem neuen Motiv in der Oberstimme. Die kurzen Pausen zwischen den einzelnen Phrasen füllt die Bass-Stimme mit einer klar artikulierten, abwärts gerichteten Tonfolge. Nach einem dynamischen Höhepunkt und harmonischen Ausweichungen findet der Satz zum Thema (A) zurück und schließt mit einer achttaktigen Schlussgruppe, in der die Oberstimme mit ihrem punktierten und chromatisch aufsteigenden Motiv sehr dezent an die Einleitung des Kopfsatzes erinnert. Das Formschema A-B-A-C-A entspricht dem des dritten Satzes, des Rondos. Das Rondothema ist eingängig und in seiner Form klassisch gebaut, die Konzeption des ganzen Satzes folgt aber nicht nur der Rondoform, sondern zeigt ebenso Anleihen an der Sonatensatzform. Neben dem Rondothema in c-Moll exponiert Beethoven ein zweites, weniger bewegtes Thema in Es-Dur, das gegen Ende des Satzes noch einmal in der Grundtonart wiederholt wird und dann zum letzten Einsatz des Rondothemas überleitet. Man kann in diesem Rondo die großen Formteile des Sonatenhauptsatzes ausmachen, wie die Exposition mit den beiden Themen und einem Zwischensatz, die Durchführung, die hier in
As-Dur beginnt und an den langsamen Satz anzuknüpfen scheint, dann aber in pianistische Akkordbrechungen übergeht und wie in der Durchführung des ersten Satzes mit einem Orgelpunkt auf der Dominante schließt. Die Reprise bringt dem Hörer noch einmal das erste und zweite Thema sowie den Zwischensatz. Dort, wo man im Sonatenhauptsatz das Ende vermuten würde, erhebt sich noch ein letztes Mal das Rondothema und geht in den virtuosen Schlusssatz über, der mit dem für diese Sonate so typischen Kontrast endet: Nach zwei schwachen Akkorden im pianissimo schließt Beethoven die Sonate mit einem schnellen und kurzen, ja lakonisch wirkenden Lauf in der rechten Hand, der von zwei donnernden Akkorden (fortissimo) im Bass gestützt wird.
Die Sonate Pathétique ist ein Meisterwerk an Ausgewogenheit und eine Gradwanderung zwischen der musikalischen Tradition der Klassik und Beethovens Innovationsdrang. Auf der Suche nach neuen Formen und Aussagen schuf der Komponist im Laufe seines Lebens weitere großartige Werke, von denen hier einige seiner berühmtesten Klaviersonaten genannt seien: die As-Dur-Sonate op. 26, die Mondscheinsonate op. 27/2, die Waldsteinsonate op. 53, die Appassionata op. 57, die Sonate "Les adieux" op. 81a, die Hammerklaviersonate op. 106 und die letzte seiner 32 Klaviersonaten: die C-Moll-Sonate op. 111.
Die Sonate Nr. 20 in cis-Moll (op. 27/II, 1801) von Ludwig van Beethoven (1770 Bonn - 1827 Wien) erhielt den Namen, unter dem sie berühmt wurde (Mondscheinsonate) von dem Musikschriftsteller Ludwig Rellstab, der sich an eine Bootsfahrt bei Mondschein auf dem Vierwaldstättersee erinnert fühlte. Diese einige formale Eigenheiten aufweisende Sonate (so fehlt gleichsam der erste Satz, d. i. ein Allegro in Sonatensatzform) hat Beethoven für seine Schülerin Giulietta Guicciardi komponiert. Aufgrund der sehr gefühlvollen Stimmung der Sonate glauben manche Forscher, in Giulietta die berühmte unsterbliche Geliebte gefunden zu haben. Historisch wichtig ist, dass die spieltechnischen Anforderungen in Beethovens Sonaten derart hoch sind, dass nur mehr wenige Dilettanten diesen gerecht werden können. Es kommt zur Ausbildung von Spezialisten und somit zum Beginn des Virtuosentums des 19. Jahrhunderts.
Die Opern
(Tristan Schiele)
Abschließend wollen wir noch Beethovens Opern betrachten. Er schrieb deren zwei, namentlich Fidelio und Leonore, und Fidelio werden wir nun genauer betrachten.
Die Oper in zwei Aufzügen Fidelio in ist untertitelt mit „Die eheliche Treue“ und wurde am 20. November 1805 uraufgeführt. Sie wurde im Auftrag des Theaters an der Wien komponiert und hat ihren Text u.a. von Stephan von Breuning. Sie spielt in Spanien nahe Sevilla im 18 Jahrhundert, ist also von Beethoven aus gesehen aktuell.
Handlung:
1. Akt: Fidelio spielt sich in einer geschichtlichen Periode von politischer Unterdrückung ab. Der edle, kühne Freiheitskämpfer Florestan sitzt auf Befehl seines erbarmungslosen Feindes Pizarro, des Gouverneurs des Staatsgefängnisses, in einem dunklen Kerker in Haft. Dort verhungert er langsam. In der Zwischenzeit hat seine Frau Leonore, die nicht weiß, wo er ist, die Nachricht von seinem Tod erreicht. In letzter Verzweiflung entschließt sie sich, Pizarros Gefängnis aufzusuchen, ihren Mann ausfindig zu machen und ihn zu befreien. Zur Ausführung ihres Planes verkleidet sie sich als Jüngling und nimmt eine Stelle als Helfer des Kerkermeisters Rocco an. Die Lage wird noch schwieriger, als sich Roccos Tochter Marzelline in den hübschen Jüngling verliebt und somit die Eifersucht von Jaquino, Roccos Pförtner, erregt, der das Mädchen heiraten will. Die seltsam romantische Verirrung von Gefühlen wird mit wundervoller Feinfühligkeit in dem kanonartigen Quartett ("Mir ist so wunderbar!") herausgebracht. Florestans erbitterter Feind Pizarro hat erfahren, dass der Minister plant, dem Gefängnis einen Besuch abzustatten ("Ha, welch' ein Augenblick"). Pizarro ist entschlossen, Florestan noch vor der Ankunft des Ministers umzubringen und befiehlt Rocco, ein Grab zu schaufeln. Als Rocco jedoch vor dem Mord zurückschreckt, beschließt Pizarro, die Tat selbst zu begehen. Leonore belauscht die Verschwörung, und als die beiden Männer abtreten, kommt sie aus ihrem Versteck hervor und ergießt ihre Empörung ("Abscheulicher! wo eilst du hin"). Ihrer Bitte folgend, erlaubt Rocco den Gefangenen in den Gefängnishof zu treten, um wenigstens einen Augenblick die frische Luft und die Sonne genießen zu können. Als die Männer staunend ans Tageslicht treten, sind ihre Augen geblendet, und als Ausdruck ihres Verlangens nach Freiheit und ihrer vereitelten Freuden stimmen sie in den herrlichen Chor ("O welche Lust!") ein. Erwartungsvoll lässt Leonore ihre Augen über die Gesichter wandern, kann aber Florestan nicht unter ihnen finden. Trotzdem erwacht in Leonore neue Hoffnung, als sie erfährt, dass sie Rocco in den Kerker hinab begleiten soll.
2.Akt: In der kahlen Tiefe von Pizarros Gefängnis sieht man den einsamen, an die Wand geketteten Florestan. Bald stimmt er eine schmerzerfüllte Arie, "In des Lebens Frühlingstagen", wohin erinnert er sich an die Tage seiner Jugend, an den Frühling und die Freiheit, denn nur wegen seiner Freiheitsliebe ist er völlig unschuldig zu dieser endlosen Qual verurteilt worden. In seinem Wahn erscheint ihm eine Vision von Leonore, die er voller Ekstase anruft. Nun treten Rocco und Leonore auf. Nur schwer erkennt Leonore diesen gebrochenen und heruntergekommenen Gefangenen als ihren Mann. Sie schweigt jedoch und hilft Rocco, das Grab zu graben. Als Pizarro endlich erscheint, um den hilflosen Gefangenen zu erstechen, wirft sich Leonore schützend dazwischen und ruft trotzig "Töt' erst sein Weib!". Benommen vor Freude ruft Florestan aus "Mein Weib, Leonore!". In einem Anflug wilden Zorns versucht Pizarro, beide niederzuschlagen, aber Leonore ist auf alles vorbereitet. Sie zieht eine Pistole hervor und zielt auf ihn. Plötzlich kündigt der Ruf von Trompeten die Ankunft des mit Bangen erwarteten Ministers an. Endlich vereint und außer Gefahr fallen sich Florestan und Leonore in einem dröhnenden Ausbruch von Glück ("O namenlose Freude") in die Arme. Alle Mitgefangenen Florestans wurden vom Minister befreit, und Leonore nimmt Florestan eigenhändig die Ketten ab. Marzelline sieht ihre Gefühlsverirrung ein und willigt ein, den Pförtner Jaquino zu heiraten. Pizarro wird festgenommen und von Don Fernandos Männern abgeführt. Nun singt der Chor einen letzten Tribut zu Ehren der aufopferungsvollen Ehefrau, deren Treue ihren Ehemann vor dem sicheren Tod bewahrte.
Streicherwerke
(Florian Waldmann)
Beethoven schrieb außerdem mehrere Streichquartette, 16 an der Zahl. Sie dauerten alle zwischen 25 und 35 Minuten und bestanden meist aus 4 Sätzen. Zu den Streichquartetten gehört auch die "Große Fuge", die als Abschluss des 13. Quartetts gedacht war, sich aber als eigenes Quartett durchsetzte.
Das Streichquartett Nr. 7 war auch etwas ganz besonderes. Es wurde im Palast des Fürsten Rasumowsky durch das Schuppanzigh-Quartett uraufgeführt und wurde deshalb auch nach dem Namen des Fürsten, dem es gewidmet war, benannt. Rasumowsky war ein Freund Beethovens. Es dauert ca. 39 Minuten und besteht aus 4 Sätzen. Ebenfalls wie das 7. Quartett wurde auch das 9. im Palast uraufgeführt, durch das selbe Streichquartett und für den selben Fürsten.
Nummer 11 war Nikolaus Zmeskall von Domanovecz gewidmet, der ebenfalls ein enger Vertrauter Beethovens war.
Sonstige Werke
Beethoven schrieb nebenbei noch einige Ouvertüren und Messen.
Die Coriolan-Ouvertüre wurde als Einleitung zu H.J. von Collins’ Trauerspiel komponiert. .
Die Fidelio-Ouvertüre wurde als Ouvertüre zur gleichnamigen Oper komponiert. Beethovens Schlachtgemälde Wellingtons Sieg bei Vittoria wurde als Ouvertüre zur Oper „Elisabetta, Regina d’Ingleterra“ geklaut.
Beethoven schrieb einige Messen, eine davon war die Missa solemnis, die ca. 80 Minuten dauert und in 5 Teile gegliedert war.
Quellenverweise:
http://www.Hausarbeiten.de
http://www.musikarchiv-online.de/klassik/komp/beethoven/
http://www-pinot.informatik.uni-kl.de/~hillenbr/klassika/Komponisten/Beetho.../#Werke .
http://www-pinot.informatik.uni-kl.de/~hillenbr/klassika/Komponisten/Beethoven/#Opern
Häufig gestellte Fragen zu Ludwig van Beethoven: Die Werke
Welche Arten von Werken hat Ludwig van Beethoven geschaffen?
Ludwig van Beethoven hat hauptsächlich Sinfonien, Sonaten und Opern geschaffen, aber auch Streichquartette, Ouvertüren und Messen.
Wie viele Sinfonien hat Beethoven vollendet?
Beethoven hat 9 Sinfonien vollendet und eine unvollendete hinterlassen.
Was sind die Merkmale von Beethovens erster Sinfonie?
Beethovens erste Sinfonie (op. 21 C-Dur) ist von Mozarts Klangästhetik, Haydns Themendialektik und Einflüssen aus der französischen Musik geprägt. Sie zeichnet sich durch eine Ausgereiftheit und den Einsatz vieler Bläser aus.
Worin unterscheiden sich Beethovens dritte und vierte Sinfonie?
Die dritte Sinfonie ("Eroika", op. 55 Es-Dur) war zu ihrer Zeit ungewöhnlich lang und komplex und wurde zunächst abgelehnt. Die vierte Sinfonie (op. 60 B-Dur) ist kürzer, simpler und wurde für ihre edle Simplizität geschätzt. Sie gilt als romantischste der Beethovenschen Sinfonien.
Was ist das Besondere an Beethovens fünfter Sinfonie?
In seiner fünften Sinfonie (op. 67 c-Moll) verwendete Beethoven erstmals Instrumente wie Piccoloflöte und 3 Posaunen. Sie zeichnet sich durch eine lapidare Wucht und die perfekte Darstellung der Durch-Nacht-zum-Licht-Apotheose aus.
Worin besteht der Unterschied zwischen Beethovens fünfter und sechster Sinfonie?
Die fünfte Sinfonie stellt das Individuum in den Mittelpunkt, während die sechste Sinfonie ("Pastorale", op. 68 F-Dur) den Menschen im Zusammenhang mit der Natur darstellt.
Was ist das Besondere an Beethovens siebter Sinfonie?
Die siebte Sinfonie (op. 92 A-Dur) zeichnet sich durch ihre Geschlossenheit, Detailreichtum und die vollkommene Ausschöpfung der Sonatenhauptsatzform aus. Besonders hervorzuheben ist das Allegretto und der vierte Satz.
Wie unterscheidet sich Beethovens achte Sinfonie von seinen anderen Sinfonien?
Die achte Sinfonie (op. 93 F-Dur) gilt als humoristisch und als Satire auf alle Traditionen.
Was ist das Besondere an Beethovens neunter Sinfonie?
Beethovens neunte Sinfonie (op. 125 d-Moll) sprengte mit ihrer Besetzung (u.a. Chor) und ihrer Länge (75 Minuten) alles bisher Dagewesene. Sie gilt als Meilenstein auf dem Weg zur Programmmusik.
Was ist über Beethovens zehnte Sinfonie bekannt?
Beethovens zehnte Sinfonie (Es-Dur) blieb unvollendet. Es existieren nur Skizzen, Fragmente und unvollständige Dokumente. Bekannt ist, dass die Einleitung ein sanfter Satz in Es-Dur und ein gewaltiges Allegro in c-Moll war.
Was ist die Sonate Pathétique und was macht sie aus?
Die Sonate Pathétique (Op.13) ist eine Klaviersonate und war dem Fürsten Karl Linchnowsky gewidmet. Sie zeichnet sich durch einen hohen Kontrastreichtum und eine Verwendung der Tonart c-Moll aus. Sie emanzipierte Beethoven als Komponisten.
Was ist die Mondscheinsonate?
Die Sonate Nr. 20 in cis-Moll (op. 27/II, 1801), bekannt als Mondscheinsonate, wurde von Ludwig van Beethoven komponiert. Sie zeichnet sich durch eine gefühlvolle Stimmung aus. Historisch wichtig ist, dass die spieltechnischen Anforderungen in Beethovens Sonaten derart hoch sind, dass nur mehr wenige Dilettanten diesen gerecht werden können. Es kommt zur Ausbildung von Spezialisten und somit zum Beginn des Virtuosentums des 19. Jahrhunderts.
Welche Opern hat Beethoven geschrieben?
Beethoven hat zwei Opern geschrieben: Fidelio und Leonore, wobei Fidelio die bekanntere ist.
Worin geht es in der Oper Fidelio?
Die Oper Fidelio handelt von Leonore, die sich als Mann verkleidet, um ihren zu Unrecht inhaftierten Ehemann Florestan zu befreien.
Welche Streicherwerke hat Beethoven verfasst?
Beethoven hat 16 Streichquartette verfasst, die zwischen 25 und 35 Minuten dauerten und meist aus 4 Sätzen bestanden. Das Streichquartett Nr. 7 war auch etwas ganz besonderes.
Welche sonstigen Werke sind bekannt?
Beethoven hat außerdem einige Ouvertüren und Messen verfasst. Zu seinen Ouvertüren zählt die Coriolan-Ouvertüre und die Fidelio-Ouvertüre. Zu seinen Messen zählt die Missa solemnis.
- Arbeit zitieren
- Thomas Rühmling (Autor:in), 2001, Beethoven`s Werke, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100935