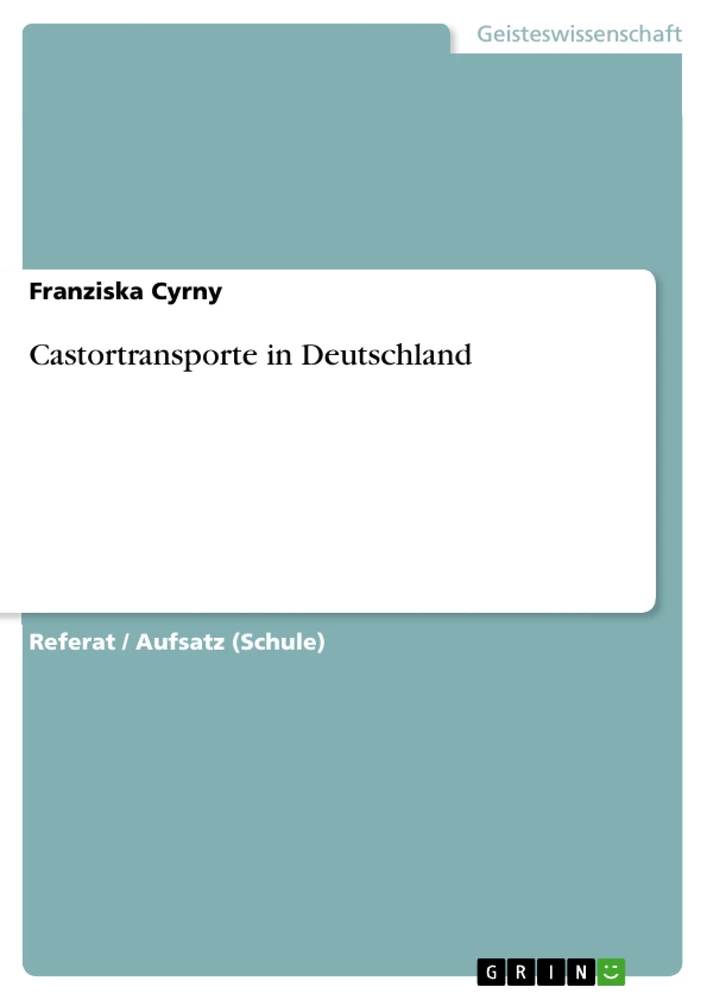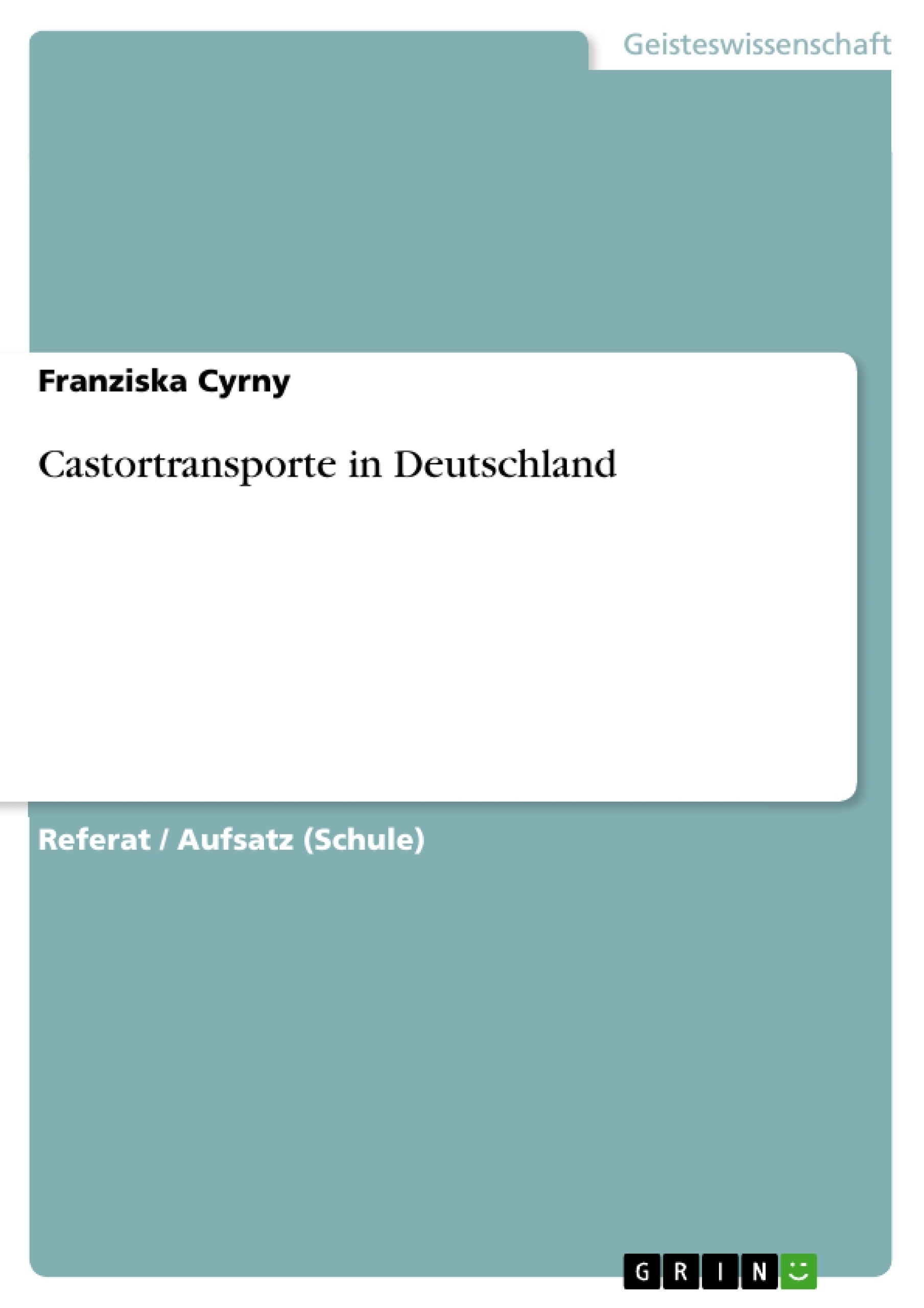CASTOR-Transporte
Der Transport von Brennelementen aus Kernkraftwerken und von hochradioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung von Brennelementen führte aufgrund von Diskussionen um die Wirkung der auftretenden Neutronenstrahlung sowie der Kontaminationen der Behälter und Transportwaggons zu erheblicher Verunsicherung der Bevölkerung und des Begleitpersonals der Transporte.
Bereits im Jahr 1995 hat die Strahlenschutzkommission (SSK) zu einem Beitrag von Prof. Dr. H. Kuni, Marburg, Gefährdung der Gesundheit durch Strahlung des Castors, Stellung genommen. In einer weiteren Stellungnahme (von 1996) beschäftigte sie sich mit der Frage der Begrenzung der Strahlenexposition von Polizeieinsatzkräften bis zum 18. Lebensjahr und von Polizeibeamtinnen. Die weiterhin bestehende Verunsicherung der Bevölkerung und der Polizeieinsatzkräfte veranlaßte die SSK im Jahr 1997, im Rahmen einer Risikobetrachtung (Zur Strahlung bei CASTOR-Transporten) die beim CASTOR-Transport auftretende Strahlendosis und die Gefährlichkeit der Neutronenstrahlung zu bewerten.
In den Jahren 1997 und 1998 wurden bei Transporten abgebrannter Brennelemente aus deutschen Kernkraftwerken zur französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague Grenzwerte der Oberflächenkontamination an den Behältern und Waggons überschritten. Die SSK-Stellungnahme Bewertung der Kontamination beim Transport abgebrannter Brennelemente geht auf die Frage der möglichen Gesundheitsgefährdung bzw. des Krebsrisikos durch diese Kontaminationen ein.
Den Polizeieinsatzkräften, die bei der CASTOR-Begleitung eingesetzt waren, wurde von der Klinik und poliklinik für Nuklearmedizin der Universität zu Köln angeboten, sich im Ganzkörperzähler auf eine mögliche Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Körper (Inkorporation) untersuchen lassen zu können. Es wurden 24 Personen, die sich freiwillig meldeten, untersucht. Die Meßergebnisse und deren Bewertung werden einem Bericht von Dr. W. Eschner und Prof. Dr. H. Schicha erläutert.
26.01.00 Bundesamt genehmigt 5 CASTOR-Transporte nach Ahaus Mittwoch, 26. Januar 2000, 10:14 Uhr
Wieder Atomtransporte genehmigt Berlin (Reuters) - Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat nach einem mehr als eineinhalbjährigen Stopp erstmals wieder innerdeutsche Atom-Transporte genehmigt. BfS-Präsident Wolfgang König teilte am Mittwoch vor Journalisten in Berlin mit, sein Amt habe fünf Castor-Transporte mit bestrahlten Brennelementen aus den Atomkraftwerken Biblis, Neckarwestheim und Philippsburg in das westfälische Zwischenlager Ahaus genehmigt. Durch zusätzliche Auflagen gegenüber früheren Genehmigungen sei gewährleistet, dass Grenzwerte für radioaktive Verunreinigungen eingehalten würden.
Voraussichtlich frühestens ab August könne der erste Transport verbrauchter Brennelemente in das Zwischenlager nach Ahaus rollen.
Die Betreiber der Kraftwerke müssten entsprechend einer Forderung der Länderinnenminister den konkreten Transporttermin sechs Monate vorher bei den Polizeibehörden anmelden. Die frühere Umweltministerin Angela Merkel hatte im Mai 1998 wegen zu hoher Strahlenwerte an den Transportbehältern alle Transporte bis auf weiteres gestoppt.
"Castor"-Transporte ungebremst
Landgericht Darmstadt lehnt einstweilige Verfügung ab Von Wolfgang Fleckenstein DARMSTADT, 19. September. Mit der Begründung, "Castor" -Transporte seien durch vorliegende Genehmigungen grundsätzlich erlaubt, hat die erste Zivilkammer des Landgerichts Darmstadt einen Antrag der Stadtverwaltung zurückgewiesen. Diese hatte der Deutschen Bahn AG per einstweiliger Verfügung verbieten lassen wollen, die gefährliche Fracht durch Darmstädter Gemarkung zu leiten. Den Angaben des Landgerichtssprechers Ulrich Schröder vom Freitag zufolge ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig.
Wie Schröder mitteilte, kam der Darmstädter Bürgermeister Horst Knechtel auch mit seinem Argument der Gleichbehandlung nicht durch. Er stütze sich dabei auf die Zusage der Bahn an die Stadt Frankfurt, Transporte von deren Gemarkung wegzuverlegen. Der Bürgermeister sieht daher eine zusätzliche Belastung auf Darmstadt zukommen. In seiner Begründung stellt das Gericht fest, eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes liege nicht vor. Sähe man das anders, wären ,,Castor"-Transporte unmöglich, weil dann jede an der Strecke liegende Gemeinde ihre Benachteiligung geltend machen könnte. Nicht verletzt ist nach Ansicht der Zivilrichter auch das Recht der Stadt Darmstadt auf kommunale Selbstbestimmung. Sie könne vom Hessischen Innenministerium bessere Information verlangen. Die Bahn sei nicht verpflichtet, die Stadt über die Route und den Zeitpunkt des Transports zu unterrichten. Bürgermeister Knechtel hatte moniert, daß beim jüngsten "Castor"-Transport durch Darmstadt weder Polizei noch Feuerwehr oder örtlicher Katastrophenschutz von der Bahn AG unterrichtet worden seien.(AZ:10373/97)
Castor-Transporte rollen wieder
Im Herbst sollen die Castor-Transporte wieder durch die Republik rollen. Vollgeladen mit radioaktivem Atommüll. Diesmal genehmigt von einem Grünen-Umweltminister.
Und wieder sollen unzählige Polizisten den Transport sichern. Und dabei im wahrsten Sinne des Wortes „ihre Haut zu Markt tragen". Denn noch immer sind letzte Zweifel nicht ausgeräumt, dass nicht doch eine Gefährdung von den Behältern ausgeht.
Man braucht kein Hellseher zu sein, um schon heute vorhersagen zu können, dass die Polizei im Herbst vor dem Kollaps stehen wird. Denn zum gleichen Zeitpunkt müssen circa 5.000 Polizisten für die EXPO in Hannover abgestellt werden. Für die Castor-Transporte werden erfahrungsgemäß alleine schon 30.000 Beamte benötigt.
Nach dem Unfall von Apach und vor Castor3:
Atomtransporte sind nicht sicher !
Neue Nahrung im Kampf gegen die Atomtransporte lieferte die Entgleisung eines Transports in Apach/Lothringen am 4. Februar. Erstmalig verunglückte einer der besonders strahlengefährlichen Transporte mit abgebrannten Brennelementen auf dem Weg in die Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield (Schottland). Für den Transportbehältertyp von Apach gelten die gleichen Sicherheitsvorschriften wie für die Castorbehälter.
Der in Apach entgleiste Waggon war mit 24 hochradioaktiven Brennstäben aus dem AKW Lingen/Emsland beladen. Der Zug mit insgesamt drei Behältern transportierte 180 Tonnen Strahlenmaterial. Das es nicht zu einer Katastrphe kam lag möglicherweise nur an der niedrigen Fahrgeschwindigkeit von 28 km/h, bedingt durch das Passieren der deutsch-französischen Grenze. Die Sicherheitsstandarts sehen eine Schutzgarantie für eine Fahrgeschwindigkeit von 45 km/h vor. Weniger als die übliche Transportgeschwindigkeit der Züge.
Am selben Tag ereignete sich am Bestimmungsort in Sellafield ebenfalls eine "Haverie". Sechst britische Atomarbeiter wurden durch radioaktiven Staub verstrahlt als ein Reaktor heruntergefahren werden sollte. Die Arbeiter strahlen zwar, aber das Lachen dürfte ihnen vergangen sein.
In Krümmel (Geesthacht bei Hamburg) löste die Polizei einen Tag zuvor (Montag) eine Protestdemonstration gegen den Abtransport abgebrannter Brennelemente auf. Vor zwei Wochen war auch in Krümmel einer der Transporter, glücklicherweise unbeladen, wegen vereister Schienen entgleist.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über CASTOR-Transporte?
Der Text behandelt die Problematik und die öffentliche Besorgnis bezüglich des Transports von Brennelementen aus Kernkraftwerken und hochradioaktiven Abfällen, insbesondere im Zusammenhang mit CASTOR-Behältern. Er thematisiert die Diskussionen um Neutronenstrahlung, Kontaminationen, Grenzwertüberschreitungen und die Rolle der Polizei bei der Sicherung dieser Transporte.
Welche Rolle spielt die Strahlenschutzkommission (SSK) in Bezug auf CASTOR-Transporte?
Die SSK hat sich mehrfach mit den Risiken und Gefahren von CASTOR-Transporten auseinandergesetzt. Sie hat Stellungnahmen zu Themen wie die Strahlenexposition von Polizeikräften, die Gefährlichkeit der Neutronenstrahlung und die Bewertung von Kontaminationen abgegeben. Die SSK hat im Jahr 1997 im Rahmen einer Risikobetrachtung (Zur Strahlung bei CASTOR-Transporten) die beim CASTOR-Transport auftretende Strahlendosis und die Gefährlichkeit der Neutronenstrahlung zu bewerten.
Was waren die Gründe für die vorübergehende Aussetzung von CASTOR-Transporten im Jahr 1998?
Ehemalige Umweltministerin Angela Merkel hatte im Mai 1998 aufgrund zu hoher Strahlenwerte an den Transportbehältern alle Transporte bis auf weiteres gestoppt.
Warum wurden die CASTOR-Transporte wieder aufgenommen?
Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) genehmigte die Transporte nach einem Stopp von mehr als eineinhalb Jahren wieder, nachdem zusätzliche Auflagen eingeführt wurden, um die Einhaltung der Grenzwerte für radioaktive Verunreinigungen zu gewährleisten.
Welche Bedenken werden bezüglich des Einsatzes von Polizeikräften bei CASTOR-Transporten geäußert?
Es wird befürchtet, dass die zahlreichen Polizeikräfte, die zur Sicherung der Transporte benötigt werden, gleichzeitig für andere Großereignisse wie die EXPO in Hannover fehlen könnten. Zudem werden Bedenken hinsichtlich der möglichen Gefährdung der Polizeibeamten durch die Strahlung der Behälter geäußert.
Welche Ereignisse haben die Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Atomtransporten verstärkt?
Die Entgleisung eines Transports in Apach/Lothringen sowie ein Vorfall in Sellafield, bei dem Atomarbeiter verstrahlt wurden, haben die Sicherheitsbedenken verstärkt. Auch die Entgleisung eines unbeladenen Transporters in Krümmel wird erwähnt.
Was wird über die Proteste gegen CASTOR-Transporte gesagt?
Der Text erwähnt, dass Bürgerinitiativen gegen die Transporte protestieren und eigene Manöverpläne haben. Es wird auch erwähnt, dass die Polizei eine Protestdemonstration in Krümmel aufgelöst hat.
Welche Rolle spielt das Landgericht Darmstadt in Bezug auf CASTOR-Transporte?
Das Landgericht Darmstadt wies einen Antrag der Stadtverwaltung zurück, die Deutsche Bahn AG per einstweiliger Verfügung zu verbieten, die gefährliche Fracht durch Darmstädter Gemarkung zu leiten.
Welche Konsequenzen ergaben sich aus den Kontaminationen bei Transporten in den Jahren 1997 und 1998?
Es wurde die SSK-Stellungnahme Bewertung der Kontamination beim Transport abgebrannter Brennelemente herausgegeben, welche auf die Frage der möglichen Gesundheitsgefährdung bzw. des Krebsrisikos durch diese Kontaminationen eingeht. Den Polizeieinsatzkräften, die bei der CASTOR-Begleitung eingesetzt waren, wurde von der Klinik und poliklinik für Nuklearmedizin der Universität zu Köln angeboten, sich im Ganzkörperzähler auf eine mögliche Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Körper (Inkorporation) untersuchen lassen zu können.
- Arbeit zitieren
- Franziska Cyrny (Autor:in), 2000, Castortransporte in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100901