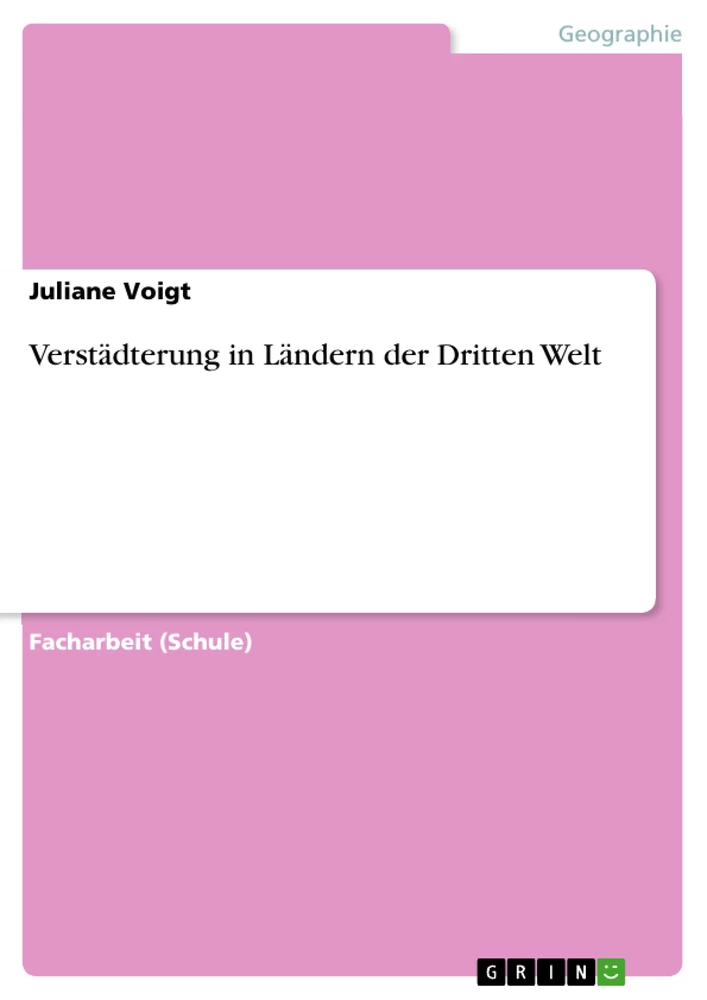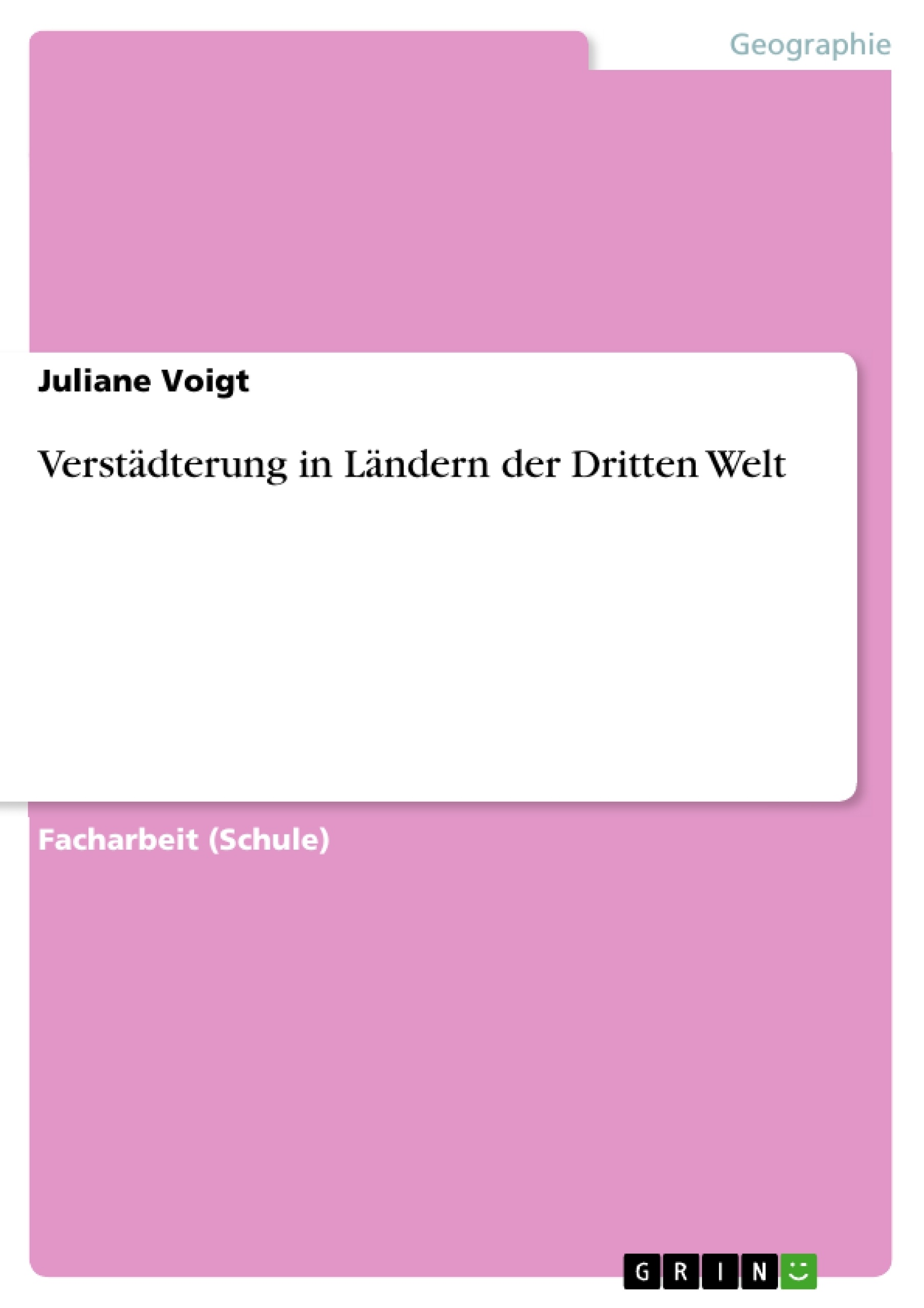Verstädterung in der Dritten Welt
1. Begriffserläuterung
- Verstädterung = Urbanisierung
- bezeichnet einen demograph. Zustand: den prozentualen Anteil der städt. an der Gesamtbev. -> wird durch den Verstädterungsgrad angegeben
- unterschiedl. historische Entwicklungen und kultur-soziale Situationen wirken differenzieren auf den Verstädterungsgrad -> schwankt erheblich
- Verstädterung kann auch als dempgraph. Prozess aufgefasst werden -> charakterisiert die Dynamik des Verstädterungsprozesses, d.h. die Wachstumsgeschwindigkeit der Stadtbev.; lässt sich mit der Verstädterungsrate erfassen; erlaubt einen unmittelbaren Vergleich mit den jeweiligen Wachstumsraten
2. Verstädterung
- Verstädterungsprozess begann in der Dritten Welt später
- nimmt gegenwärtig bedrohlich Ausmaße an -> Tempo der Verstädterung besorgniserregend
- zw. 1965-1990: urbane Bev. stieg von 657 Mio. auf 1824 Mio. (Zunahme um 170%)
- in den IL: Zunahme um 38%
- nach Prognosen der UN: Wachstum der Städte in der Dritten Welt wird sich noch beschleunigen -> Zuwachs von 60Mio./Jahr
- Asien: 970 Mio. Städter: die fünf bevölkerungsreichsten Länder (Indonesien, Indien, China, Bangladesch, Pakistan) = 40% der Weltbevölkerung - dabei stehen diese Länder am Beginn des Urbanisierungsprozesses - bei gleichbleibender Wachstumsrate wird sich die Zahl in knapp 15 Jahren auf 2 Mrd. verdoppeln (= zweimal so viele Stadtbewohner wie die ges. heutige Bev. der USA, GUS und aller europ. Staaten zusammen!)
- in den 50er und 60er Jahren galt das Städtewachstum als Motor und Gradmesser der Modernisierung
- entgegen den Erwartungen: Bev.-Zunahme in den Ballungszentren überholte bald ihr wirtschaftliches Wachstum -> Massenarbeitslosigkeit, Armut und riesige Elendsviertel wurden prägend
- auf Verheißung der Modernisierungstheoretiker konnte man die Miss-Stände noch als Übergangsphänomen erklären
- sozio-ökomom. und ökologische Fehlentwicklungen haben nun aber bes. in den Metropolen unglaubliche Formen und Ausmaße angenommen -> „existenzgefährdende Krankheit“ der Dritten Welt
- südl. Städte: keine Katalysatoren des Fortschritts sondern Modernisierungsghettos - Gegensätze von Reichtumsinseln und Meeren der Armut
3. Metropolisierung
- beängstigend: explosives Wachstum der Metropolen in der Dritten Welt
- in fast allen EL: Konzentrationsprozess in den Millionenstädten
- Hauptstädte: oft 20% der Gesamtbev., über 50% der Stadtbev. des Landes und mehr als das 4-fache der Einwohnerzahl der nächstgrößeren Stadt
- besorgniserregend: das Tempo des Wachstums
-> Gesamtbev. des EL stieg zw. 1940 und 1990 um das 2,2fache/Jahr, in den Städten (über 20.000EW) um das 5,4fache und in den Millionenstädten um das 15fache(!)
- eigentliche Bev.-Explosion findet somit in den Metropolen statt -> gerechtfertigt von Metropolisierung statt Verstädterung zu sprechen
- im Hinblick auf Entwicklungsperspektiven sind v.a. zwei Folgen der Metropolisierung von Bedeutung:
1. - noch stärkere Konzentration der polit., kulturellen, gesellschaftl. und wirtschaftl. Aktivitäten in den Metropolen
-> entwicklungshemmende regionale Disparitäten vergrößern sich zunehmend
2. - Ausbreitung der Elendsviertel u. Marginalisierung ihrer Bewohner
- Marginalisierung: große Gruppen sind nicht oder kaum an wirtschaftl., polit. und gesellschaftl. Entscheidungen beteiligt
-> wachsende soz. Spannungen -> Bedrohung der polit. Stabilität dieser Länder
- explosionsartige Wachstum -> jegliche Versuche einer geordneten Stadtplanung zum Scheitern verurteilt
- Probleme: Bereitstellung von Arbeitsplätzen, Schulen, Krankenhäusern,
Wohnungen und anderen Infrastruktureinrichtungen; oder ökolog. Probleme, die die Bev.-Dichte in Ballungszentren mit sich bringt
- Zahlen: jeden tag müssten Unterkünfte, Versorgungseinrichtungen und Arbeitsplätze für 140.000 Menschen neu geschaffen werden - bereits 300 Mio. Arbeitslose und 700 Mio. in absoluter der relativer Armut
- Metropolisierung nimmt deshalb schnell zu, weil neben dem raschen
Wachstum der Mio.-Städte immer mehr Großstädte in die Kategorie Metropole aufrücken -> hoher Metropolisierungsgrad
- entscheidendes metropolitanes Kriterium -> überproportional hohe Konz.
eines Teils der jeweiligen Landbev. in einer oder wenigen Metropolen <-> bedeutsames räumliches Strukturelement in diesen Ländern
- sehr deutlich: nur eine primate city oder primate region mit jeweiligem Konz-Grad der jeweiligen Landesbev.: 1995: Montevideo=43,2% oder Seoul=26,7%
- entgegengesetztes Beispiel: Indien:
- 2000: 8 Metropolen und darunter zwei Megastädte (Calcutta, Bombay) - zusammen 73,3 Mio. Einwohner = 7% der ind. Bev.
- Verstädterungsgrad erst 34,2% -> trotz Vielzahl von Metropolen, Großstädten (über 100.000EW), Mittel- und Kleinstädten - überwiegender Teil der Bev. Indiens lebt im ländl. Raum
- bei gleichbleibenden Migrationsverhalten -> erhebliches zahlen- wie größenmäßiges Metropolen- und Megastädtewachstum
4. Ursachen der Verstädterung und Metropolisierung
=> Landflucht:
- Verstädterung und Metropolisierung untrennbar mit dem Begriff Landflucht verbunden
- Landflucht = Bev.-Bewegung aus dem ländl. Raum
- ländl.-urbane Mobilität wirkt verändernd auf die Struktur und Funktion
ländl. und städt. Räume -> Ausdruck der strukturellen Probleme von
Entwicklungsgesellschaften, die sich im soz., polit. und wirtschaftlichen Bereich in unterschiedl. stark ausgeprägten Umbruchsituationen befinden
- spätestens seit Erreichen der Unabhängigkeit der EL: Versuch: durch intensive Industrialisierung schnellstmöglich die Entwicklung der heutigen Industrienationen nachzuvollziehen
- Weiträumigkeit + überwiegend geringe infrastrukturelle Erschließung -> überwiegende Konz. der ind. Standorte auf nur wenige wirtschaftl. Wachstumspole
- rege wirtschaftl. Tätigkeit in den Metropolen der EL - noch heute
vergleichsweise geringen Ausstrahlungseffekt im Sinne von
Strukturveränderungen und Modernisierung auf die übrigen Wirtschaftsräume der Länder
- besonders: Kapitalakkumulation (Bindung zentraler Funktionen auf wenige
Wachstumsinseln) -> hat Abstand der sozio-ökonom. Entwicklung im Zuge der Entwicklungsbemühungen eher vergrößert statt vermindert
- Industrialisierung, räuml. Mobilität und Städtewachstum eng miteinander verbundene Elemente des Entwicklungsprozesses in EL
- 40-50% es Städtewachstums auf Grund von Zuwanderungen
- Zahlen variieren regional jedoch sehr stark:
-> China und Länder des mittleren Ostens: natürl. Wachstum Hauptursache für Städtewachstum
-> Lateinamerika: Anteil der Zuwanderer am städt. Bev.-Wachstum über 50%
- in allen Ländern: Überlagerung versch. Wachstumsströme und -richtungen -> vorherrschend auf die Hauptstädte bzw. auf die in Küstennähe gelegenen Ballungsräume gerichtet
=> Push- und Pullfaktoren
- Gründe der ländl.-urbanen Wanderung sind vielfältig und regional sehr unterschiedlich
- Pullfaktoren: als „Magnetwirkung“ bezeichnete Anziehungskraft der Städte gemeint - resultierend aus den Erwartungen der Migranten:
- bessere Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten
- Annehmlichkeiten des städt. Lebens
- bessere Bildungsmöglichkeiten
- leistungsfähiges Sozial- und Gesundheitswesen
- eigene Erfahrungen mit dem städt. Leben als Auslöser der Wanderung spielen eine untergeordnete Rolle
- stärker: Informationen durch Massenkommunikationsmittel -> Aufbau einer Vorstellung einer vermeintlich besseren Lebenssituation in der Stadt
- auch ehemalige Dorfbewohner, die entgültig oder besuchsweise aus dem städt. Milieu zurückkehren, unterstützen mit ihren Darstellungen die Abwanderungsbereitschaft (vornehml. junger und aktiver Teil der Bev.)
- zusätzl.: verbesserte Verkehrserschließung auch der ländl. Regionen -> Distanzen werden geringer
- Pushfaktoren: sind in den Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in den peripheren agraren Regionen zu suchen:
- Bev.-Druck infolge hohen natürlichen Wachstums
- ökolog. grenzen und Hemmnisse der agraren Nutzung
- unzureichende Ernährungsgrundlage
- unzureichende Besitzgröße in der Landwirtschaft
- Unterdrückung durch Großgrundbesitzer und Ausbeutung durch Zwischenhändler
- fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft
- Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung
- geringe Alternativen bei der Berufswahl
- mangelnde Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen
- des weiteren: es werden vier umfassende Erklärungsansätze für das Zusammenwirken von Push- und Pullfaktoren unterschieden
1. modernisierungstheoretische Interpretation der Verstädterung
- Städtewachstum: wichtiges und unabdingbares Moment des natürlichen Übergangs von einer traditionellen Agrargesellschaft zur modernen Industriegesellschaft
- idealtyp. Ablauf der Modernisierung: von der Landwirtschaft aufgrund der Produktivität freigesetzten Arbeitskräfte werden fortlaufend vom städt.- ind. Sektor der Städte absorbiert
- Kritiker halten diese Deutung für ungeeignet - Ausmaß und Eigenart des tatsächlichen Ablaufs der Urbanisierung der EL zu erklären
- Prozess zeigt, gemessen an den Industrieländern, abweichende Züge
- trotz wachsender Arbeitslosigkeit hält die Zuwanderung an -> Hyper-
Urbanisierung (überholtes Anwachsen des Anteils der städt. Bev. insgesamt + extreme Konz. der Urbanisierung auf einige weinige Metropolen
2. human-ökologischer Erklärungsansatz
- endogene Erklärungen, dass die Modernisierung der Agrargesellschaften vom industriestaatl. Vorbild abweicht
- hygienisch-medizinischer Fortschritt erhöht die Bev.-Dichte auf dem Land wesentlich rascher als im Europa des 19.Jh.
- Eindringen moderner Landwirtschaftstechniken: steigerte vorhandene
Landkonz. + gleichzeitig Freisetzen von Arbeitskräften in Richtung Stadt
- Größe der Bev.-masse, die aufgrund der Defekte der ländl. Strukturen zur räumlichen Umverteilung ‚ansteht’, überschreitet notwendigerweise die Aufnahmefähigkeit der städt. Industrien
3. These von der stadtlastigen Politik in den Entwicklungsländern
- geht nicht von ‚hausgemachten’ Entwicklungstendenzen in den Agrargebieten aus
- Städtewachstum = Folge systematischer Politik der regierung zugunsten der Städte + zu Lasten der Landbev.
- wichtigster Indikator: ungleiche Stadt-Land-Verteilung der Investitionen
- wichtige Bereiche stadtlastiger Entwicklung: Steuer- und Agrarpreispolitik
- viele Regierunge drücken die Agrarpreise zu Lasten der Bauern -> Erwirtschaftung von mehr Devisen oder Niedrighalten der Nahrungsmittelpreise in den Städten -> Ausschaltung von sozialen Protesten und Revolution der städt. Massen im Vorfeld
4. dependenztheoretische Erklärung der Urbanisierung
- Dependenztheoretiker leugnen nicht den Einfluss des ‚urban-bias’ - aber: interne Kausalfaktoren reichen als Erklärung des Städtewachstums der EL nicht aus
- sehen Weltmarktkräfte am Werk, die auf die gesellschaftlichen Prozesse in den EL einen dominierenden Einfluss ausüben - u.a. Steuerung des Vorgangs der Hyper-Urbanisierung
- wichtigste Ursachen:
- aus der Kolonialzeit ererbte Konz. von Bildungs-, Gesundheits- und Verwaltungseinrichtungen
- Bevorzugung der größeren Städte bei der Standortwahl internationaler Konzerne
- kapitalintensive Auslandsinvestitionen im Agrarsektor, die zur Freisetzung von Arbeitskräften führen
- Abhängigkeit von einigen wenigen Exportprodukten
- Erklärungsansätze sind sehr verschieden
- eine Einseitigkeit gemeinsam: Überbetonung der Land-Stadt-Wanderung als Ursache des Städtewachstums
- neuere Untersuchungen: 50-60% des globalen Wachstums ist auf das natürliche Wachstum der städt. Bev. selbst zurückzuführen
5. Auswirkungen der Metropolisierung
- zunehmende soz. Segregation
- Verslumung (Verlust des Stadtbildes)
- steigende Kriminalität
- Druck auf Sozial- und Bildungssystem wächst
- Druck auf Wohnsituation
- unzureichende Infrastruktur
- Arbeitslosigkeit
- Verwaltungsprobleme
- Umweltzerstörung (Müll)
- regionale Disparitäten (Zentralisierung)
- Veränderung der Altersstruktur (Vergreisung auf dem Land)
Slumbildung - Ergebnis der Wanderungsvorgänge: städt. Elendsviertel
der EL wachsen zu zukünftigen Katastrophengeb. heran.
- Zahl der Slumbev. übersteigt teilweise bereits die eigentliche Stadtbev.
- Elendsviertel in EL lassen sich nur bedingt mit Slums in den IL vergleichen
- unter den städt. Elendsvierteln der EL erhebliche Unterschiede - Definition von slums kaum möglich
- aber auch charakt. gemeinsame Merkmale:
- mangelnde Bausubstanz
- hohe Wohndichte
- unzureichende Wohninfrastruktur
- unzureichende öffentl. Infrastruktur
- geringes Einkommen bis Arbeitslosigkeit bei den Bewohnern
- zu unterscheiden: innerstädt. Elendssiedlungen
(Slums)und randstädt. (squatter settlements) ->
dominierenden Einfluss auf die Siedlungsausprägung -> erhalten eigene, regional gebundene Bezeichnungen
Arbeitslosigkeit und Kampf ums
Überleben
Umweltzerstörung und
Gesundheitsschäden
- grundlegend für die wachsende Misere der städt. Massen: Mangel an ausreichenden Verdienstmöglichkeiten
- vorherr. Form kapitalintensiver Industrialisierung:
kann der wachsenden Erwerbsbev. auch bei guter Konjunktur nur eine begrenzte Zahl industr.
Arbeitsplätze anbieten -> bleibt weit hinter der Nachfrage zurück
- keine Beschäftigung im formellen Sektor -> Arbeit im informellen Sektor
- 50-60% der Stadtbewohner arbeiten in einer unübersehbaren Vielfalt von Kleinhandels- und
Dienstleitungstätigkeiten - geringer Ertrag -> erfordert mehrere Verdiener
- Dürftigkeit der Arbeits- und Prod.bedingungen - aber: Potential von Abermillionen einfallsreicher und
fleißiger Überlebenskünstler - Entwicklungspolitik ging daran aber achtlos vorbei
- Ausmaß der ökol. Schäden - Verstädterung = großflächige Umweltzerstörung und millionenfache
Gesundheitsschädigung
- Hauptursachen: Ind.-Emissionen, Verkehrsabgase, mangelnde Abfall- und Abwässerbeseitigung,
Landverbrauch und Entwaldung
- hyg. Mängel, Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung fordern in den Slums und Squatter-Siedlungen jedes
Jahr Tote
-> der informelle Sektor
- Def.: Der informelle Sektor ist ein Bereich wirtschaftlicher Tätigkeit
für die Masse der armen Bevölkerung in den Städten der EL, gekennzeichnet durch: arbeitsintensive Produktion zumeist mit Hilfe einfacher Technologien, Fehlen formaler Qualifikationen der Arbeitskräfte sowie sozial-, arbeits- und gewerblicher Regelungen
- großer Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten im informellen Sektor ist wirtschaftlich effizient und gewinnbringend
- Bereitstellung der ganzen Skala an handwerklichen Fähigkeiten, Lieferung von Gütern und Dienstleistungen
- Potential: Absorbieren von Arbeitskräften, bietet zahlreichen Menschen Lebensunterhalt häufig auf sehr niedrigem Konsumniveau
- wesentliche Quelle für Güter und Dienstleistungen für Menschen, die ihre Bedürfnisse nicht durch den formellen Sektor befriedigen können
- informeller Sektor: genießt keine Privilegien - entbehrt häufig Grundlagen wie Wasser, Elektrizität und Kredit
- wird auch von Behörden schikaniert und behindert
- wenn: Sektor weiter anschwillt, Armut sich ausbreitet und
Überlebensstrategien immer aggressiver werden -> informeller Sektor könnte sich selbst zerstören
6.Strategien zur Bekämpfung des Städtewachstums
-> Eindämmung der Landflucht
- ohne Verbesserung der Situation der Landbev. - Abwanderung in die Städte kann kaum aufgehalten werden
- Agrarreformen zugunsten von Kleinbauern und Landlosen
- Anhebung der nationalen Agrarpreise
- verstärkte Lenkung finanzieller und anderer Ressourcen in die kleinbäuerliche Ökonomie
- Ausbau der Infrastruktur und Förderung land-städt. Zentren mit Markt- und Lagereinrichtungen sowie einem erweitertem Angebot an Dienstleistungen
- Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Produkte
- Diversifizierung der Palette agrarischer Exportprodukte und Befreiung von einseitiger Käufer-Abhängigkeit auf dem Weltmarkt
- Verringerung des Anbaus von Exportprodukten auf ein ökologisch vertretbares Maß
-> Dezentralisierung: Investitionen und neue Arbeitsplätze in der Provinz
- Betriebe der Klein- und Mittelindustrie: könnten auf mittlerem
technologischem Niveau eine ausreichende zahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen - auf ländl. Standortbedingungen angewiesen
- wenn nicht die Riesenstädte die ländlichen Migranten aufnehmen sollen, müssen kleine und mittlere Zentren gefördert werden
- allerdings: verschiedene Regionalisierungsstrategien zeigten bisher nur unbefriedigende Erfolge
- herrschende gesellschaftl. und gesamtpolit. Bedingungen -> Zukunftschancen d. EL müssen skeptisch beurteilt werden
-> Geburtenkontrolle
- Katalog von „Wachstumshemmern“: Hinweis auf die Notwendigkeit effizienter Familienplanung (Land- und Stadtbewohner)
- Senkung der Geburtenrate ein sehr komplexes Problem - hat nur wenig mit der Aufklärung unwissender Eltern zu tun - viel hingegen mit der Lösung sozio-ökonom. Existenzfragen von Unterschichtfamilien
- Geburtenkontrolle als kurzfristige Lösungsstrategie nicht mehr geeignet, da die bis Ende der 90er auf den Arbeitsmarkt drängenden Menschen bereits geboren sind
7. Strategien zur Lösung innerstädtischer Probleme
-> Schaffung industrieller Arbeitsplätze
- dringende Notwendigkeit Einkommenschancen der tausend Arbeitslosen zu
verbessern, aber: neue Arbeitsplätze locken auch neue Zuwanderer in die Städte
- notwendige Bedingung für die Schaffung einer größeren Arbeitsplatzanzahl: eine Wirtschaftspolitik, die arbeitsintensivere Produktionsformen unterstützt
- dominanter Typ exportorientierter High-Tech-Industrialisierung steht dem entgegen
-> Entwicklung des informellen Sektors
- informeller Sektor: existiert in einem Zustand rechtl. und
wirtschaftlicher Unsicherheit, zwischen prekärer Duldung und zeitweiliger Repression
- Förderungsvorschläge: geraten rasch in Kollision mit den Interessen der Eliten oder tragen unabsichtlich zur Stärkung der Starken und zur Schwächung der Schwachen bei
- Selbsthilfeprogramme für die schwächeren Gruppen im informellen Sektor zum Scheitern verurteilt
-> Erfahrungen des internationalen Arbeitsamtes: solche Versuche nur langfristig erfolgreich, wenn Regierungen die strukturellen Rahmenbedingungen für den informellen Sektor verbessern
-> Wohnmisere
- anschwellende Zahl der Zuwanderer: konnte weder von der Industrie noch vom staatlichen Wohnungsbau aufgefangen werden
- gegenüber den Slums und Squatter-Siedlungen zunächst die ‚Bulldozer-
Politik’: Zerstörung der Elendsquartiere und Vertreibung ihrer Einwohner
- Strategie scheiterte aufgrund der Zuwanderermassen und der wachsenden Arbeitslosigkeit
- Folgezeit: verschiedene Typen des Billigwohnbaus -> Erfahrungen -> Ableitung folgender ‚Prinzipien’ erfolgreicher Programme:
- Berücksichtigung des realen Einkommens und der Bedürfnis- Prioritäten der Zielgruppen
- Mobilisierung der vorhandenen Selbsthilfepotentiale der Unterschichten
- Verbesserung bestehender Siedlungen mittels einfacher Technologien
- außerdem: Bodenspekulation steht einer soz. Orientierung des Städtebaus im Weg
8. Slumsanierung
- drei Arten der Versuche von Slumsanierungen:
1. Low-cost-housing-Programme
- Bau mehrgeschossiger Wohnblocks mit primitiven Wohnräumen
- könne preiswert gemietet oder im Mietkauf erworben werden
2. Site-and-service-Programme
- Bereitstellung von erschlossenen Neusiedlungsflächen
- Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen am Stadtrand
- Vergabe der Grundstücke an Familien mit geringem Einkommen - erbauen die Wohnungen in Eigenleistung
3. Upgrading-Programme
- Verbesserung von Bausubstanz und Infrastruktur in den illegalen und halblegalen Siedlungen - durch Kombination von Staats- und Selbsthilfe
- diese Sanierungsstrategien: Problem der Landflucht noch nicht behoben
- EL: erkannt, dass Landflucht kann nur dort erfolgreich eingeschränkt werden, wo sie entsteht -> zunehmend mehr Wert auf ländl. Regionalentwicklung gelegt
- z.B. durch: Agrarreformen oder dezentralisierte industrielle Entwicklungsförderung
- verschieden Länder: zielt Gesamtentwicklung auch auf den Bereich der
kleineren und mittleren Orte - dort: Förderung der Wirtschaftskraft und Erweiterung des Arbeitsplatzangebotes -> Abbau der wirtschaftsräumlichen Entwicklungsunterschiede
- so: Abfangen bzw. Verminderung des Zustroms auf die Hauptstadt
- bleibt abzuwarten ob Maßnahmen dieser Art Wirkung zeigen
- gute Erfolgsaussichten dann, wenn ausgewählte Zentren bereit eine
dynamische Entwicklungsphase erreicht haben oder zumind. in potentiellen entwicklungsfähigen Wirtschaftsräumen liegen
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Verstädterung (Urbanisierung)?
Verstädterung bezeichnet einen demographischen Zustand, nämlich den prozentualen Anteil der städtischen an der Gesamtbevölkerung, welcher durch den Verstädterungsgrad angegeben wird. Unterschiedliche historische Entwicklungen und kultur-soziale Situationen beeinflussen den Verstädterungsgrad erheblich. Verstädterung kann auch als demographischer Prozess aufgefasst werden, der die Dynamik des Verstädterungsprozesses, also die Wachstumsgeschwindigkeit der Stadtbevölkerung, charakterisiert und sich mit der Verstädterungsrate erfassen lässt.
Wann begann der Verstädterungsprozess in der Dritten Welt und welche Ausmaße nimmt er an?
Der Verstädterungsprozess begann in der Dritten Welt später und nimmt gegenwärtig bedrohliche Ausmaße an. Das Tempo der Verstädterung ist besorgniserregend. Zwischen 1965 und 1990 stieg die urbane Bevölkerung von 657 Mio. auf 1824 Mio. (eine Zunahme um 170%). Nach Prognosen der UN wird sich das Wachstum der Städte in der Dritten Welt noch beschleunigen, mit einem Zuwachs von 60 Mio. pro Jahr.
Was ist Metropolisierung und warum ist sie besorgniserregend?
Metropolisierung beschreibt das explosive Wachstum der Metropolen in der Dritten Welt. In fast allen Entwicklungsländern findet ein Konzentrationsprozess in den Millionenstädten statt. Hauptstadt sind oft Heimat von 20% der Gesamtbevölkerung oder mehr und weisen ein Vielfaches der Einwohnerzahl der nächstgrößeren Stadt auf. Die rasante Wachstumsgeschwindigkeit der Metropolen ist besorgniserregend, da sie jegliche Versuche einer geordneten Stadtplanung zum Scheitern verurteilt und zu Problemen wie Arbeitslosigkeit, unzureichende Infrastruktur und ökologischen Problemen führt.
Was sind die Hauptursachen für Verstädterung und Metropolisierung in der Dritten Welt?
Die Hauptursache ist die Landflucht, also die Bevölkerungsbewegung aus dem ländlichen Raum in die Städte. Gründe dafür sind vielfältig, z.B. Pullfaktoren (Anziehungskraft der Städte durch bessere Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten) und Pushfaktoren (Bevölkerungsdruck, ökologische Grenzen, unzureichende Besitzgröße in der Landwirtschaft im ländlichen Raum). Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, darunter modernisierungstheoretische, human-ökologische, stadtlastige Politik und dependenztheoretische Interpretationen.
Was sind Push- und Pull-Faktoren im Kontext der Landflucht?
Pullfaktoren sind die Anziehungskräfte der Städte, wie z.B. bessere Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten, Annehmlichkeiten des städtischen Lebens, bessere Bildungsmöglichkeiten und ein leistungsfähiges Sozial- und Gesundheitswesen. Pushfaktoren sind die negativen Bedingungen im ländlichen Raum, wie z.B. Bevölkerungsdruck, ökologische Grenzen der agraren Nutzung, unzureichende Ernährungsgrundlage, fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten und mangelnde Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen.
Welche Auswirkungen hat die Metropolisierung?
Die Metropolisierung hat vielfältige negative Auswirkungen, darunter zunehmende soziale Segregation, Verslumung, steigende Kriminalität, Druck auf das Sozial- und Bildungssystem, unzureichende Infrastruktur, Arbeitslosigkeit, Verwaltungsprobleme, Umweltzerstörung, regionale Disparitäten und eine Veränderung der Altersstruktur (Vergreisung auf dem Land).
Was ist Slumbildung und wie unterscheidet sie sich von Slums in Industrieländern?
Slumbildung ist das Ergebnis der Wanderungsvorgänge und führt zur Entstehung städtischer Elendsviertel. Die Slums in Entwicklungsländern unterscheiden sich von denen in Industrieländern hinsichtlich ihrer Ursachen, Ausmaße und Lebensbedingungen. Sie zeichnen sich durch mangelnde Bausubstanz, hohe Wohndichte, unzureichende Wohn- und öffentliche Infrastruktur sowie geringes Einkommen oder Arbeitslosigkeit aus.
Was ist der informelle Sektor und welche Rolle spielt er in den Städten der Dritten Welt?
Der informelle Sektor ist ein Bereich wirtschaftlicher Tätigkeit für die Masse der armen Bevölkerung in den Städten der Entwicklungsländer. Er zeichnet sich durch arbeitsintensive Produktion mit einfachen Technologien, fehlende formale Qualifikationen der Arbeitskräfte sowie fehlende soziale, arbeits- und gewerbliche Regelungen aus. Er bietet Arbeitsplätze und Einkommen, ist aber oft von prekären Bedingungen und mangelnder Unterstützung geprägt.
Welche Strategien gibt es zur Bekämpfung des Städtewachstums?
Zu den Strategien gehören die Eindämmung der Landflucht durch Verbesserung der Situation der Landbevölkerung, Dezentralisierung von Investitionen und Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Provinz sowie Geburtenkontrolle. Die Verbesserung der Situation der Landbevölkerung umfasst Agrarreformen, Anhebung der nationalen Agrarpreise und Ausbau der Infrastruktur. Die Dezentralisierung soll kleinere und mittlere Zentren fördern.
Welche Strategien gibt es zur Lösung innerstädtischer Probleme?
Zu den Strategien gehören die Schaffung industrieller Arbeitsplätze, die Entwicklung des informellen Sektors und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnmisere. Die Entwicklung des informellen Sektors ist umstritten, aber Selbsthilfeprogramme sind langfristig erfolgreich, wenn Regierungen die strukturellen Rahmenbedingungen für den informellen Sektor verbessern.
Was sind Low-cost-housing-Programme, Site-and-service-Programme und Upgrading-Programme im Rahmen der Slumsanierung?
Low-cost-housing-Programme sind der Bau mehrgeschossiger Wohnblocks mit primitiven Wohnräumen, welche preiswert vermietet oder im Mietkauf erworben werden können. Site-and-service-Programme stellen erschlossene Neusiedlungsflächen mit Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen am Stadtrand bereit. Upgrading-Programme verbessern Bausubstanz und Infrastruktur in illegalen und halblegalen Siedlungen durch eine Kombination von Staats- und Selbsthilfe.
- Quote paper
- Juliane Voigt (Author), 2001, Verstädterung in Ländern der Dritten Welt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100891