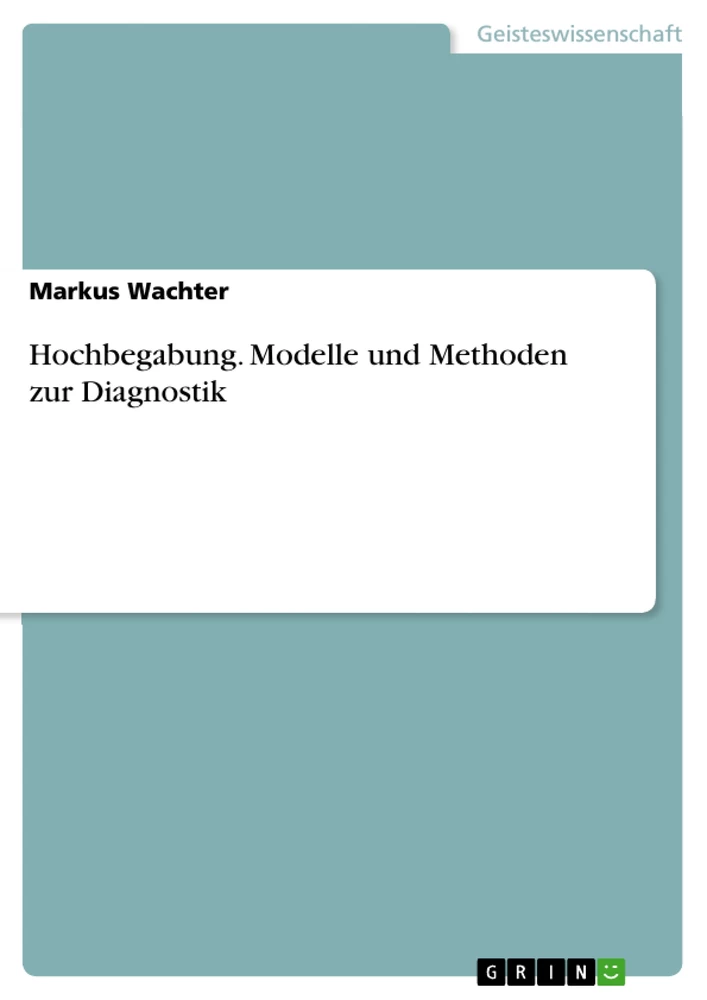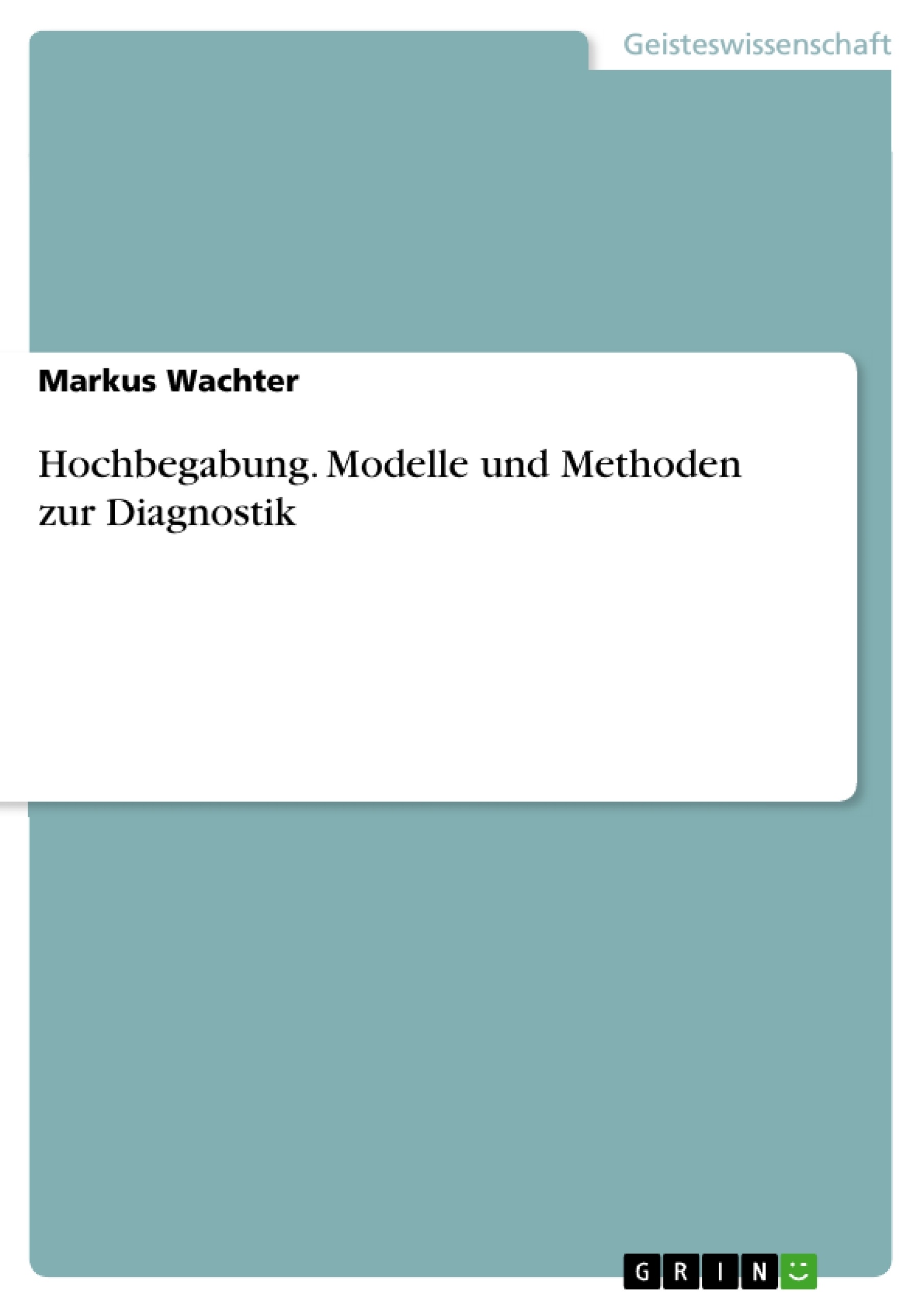Was bedeutet es wirklich, hochbegabt zu sein? Tauchen Sie ein in eine fesselnde Erkundung der Hochbegabung, die gängige Definitionen hinterfragt und die vielschichtige Natur außergewöhnlicher intellektueller Fähigkeiten enthüllt. Diese aufschlussreiche Analyse beleuchtet die verschiedenen Modelle der Hochbegabung, von der Leistungsorientierung bis zur Betrachtung als Disposition, und deckt auf, wie das Zusammenspiel von kognitiven Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmalen und Umweltfaktoren das Potenzial eines Individuums formt. Entdecken Sie die Schlüsselrolle der Intelligenzdiagnostik, einschließlich kritischer Betrachtungen von Intelligenztests wie dem HAWIK, und erfahren Sie, wie Beobachtungsmethoden, Lehrerurteile, Peernominationen und Elternurteile wertvolle ergänzende Einblicke bieten. Navigieren Sie durch die Vor- und Nachteile verschiedener diagnostischer Ansätze, von der Subjektivität menschlicher Urteile bis zum reichen Spektrum an Verhaltensweisen, die erfasst werden können. Diese umfassende Untersuchung plädiert für einen multimodalen und multimethodalen Ansatz, um die vielfältigen Erscheinungsformen der Hochbegabung zu erkennen und zu fördern. Erfahren Sie, wie soziale, musische, bildnerisch-darstellende und psychomotorische Begabungen neben der intellektuellen Hochbegabung eine entscheidende Rolle spielen. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Eltern, Pädagogen und alle, die das komplexe und faszinierende Gebiet der Hochbegabung verstehen möchten, um das Potenzial außergewöhnlicher Köpfe optimal zu entfalten. Es werden sowohl die Definitionen von Hochbegabung, von Ex-post-facto-Definitionen bis hin zu Kreativitätsdefinitionen, als auch die verschiedenen Hochbegabungsmodelle, die sich in Leistung und Disposition unterscheiden, erläutert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Diagnostik, wobei Intelligenztests und Beobachtungserfahrungen, einschließlich Lehrer-, Peergruppen- und Elternurteile, sowie Selbsteinschätzungen, eine zentrale Rolle spielen. Die Herausforderungen und Vorteile jedes Ansatzes werden kritisch beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis der Komplexität der Hochbegabungsdiagnostik zu gewährleisten. Die Bedeutung der frühzeitigen Erkennung und Förderung von Talenten wird hervorgehoben, um Kindern und Jugendlichen ein optimales Entwicklungsumfeld zu bieten.
Hochbegabung
1. DEFINITION VON HOCHBEGABUNG & HOCHBEGABUNGSMODELLE
1.1 DEFINITION
In der psychologischen Forschung existieren mehrere Definitionen von Hochbegabung, die wie folgt klassifiziert werden:
1. Ex-post-facto-Definitionen
- Wenn ein Erwachsener oder ein Kind etwas Außergewöhnliches geleistet hat, wird er als hochbegabt angesehen.
2. IQ-Definitionen
- Solche Personen, deren IQ den Wert von 130 Punkten übersteigt, gelten als hochbegabt.
3. Talentdefinitionen
- Individuen, die in einem spezifischen künstlerischen, kreativen oder akademischen Bereich hervorragende Leistungen erbringen, werden als hochbegabt definiert.
4. Prozentsatzdefinitionen
- Ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung wird als hochbegabt bezeichnet. Dabei können Noten, Schulleistungstests sowie Intelligenztestwerte mit einbezogen werden.
5. Kreativitätsdefinition
- Personen, welche besondere originelle und kreative Leistungen erbringen, gelten als hochbegabt.
Diese einzelnen definitorischen Erklärungen schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern gehen teilweise ineinander über.
Generell stimmt die Mehrheit der Intelligenzforscher darin überein, dass man unter intellektueller Hochbegabung einen allgemeinen Faktor versteht, den sogenannten „general factor“ (g-Faktor), der in jeder Intelligenzleistung wirksam wird. Dabei können mehrere spezifische Intelligenzfaktoren, „special factors“ (s-Faktoren), bei einzelnen kognitiven Anforderungen in unterschiedlichen Ausmaß verfügbar sein.
Nach Wechsler ist Intelligenz bzw. intellektuelle Hochbegabung „die zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umwelt wirkungsvoll auseinanderzusetzen“.
Als Beispiel einer bereichsunspezifischen Definition gilt nach Sternberg (1993) eine Person dann „als hochbegabt, wenn sie eine zuverlässig und gültig nachweisbare Leistung erbringt, die in Relation zu einer geeigneten Bezugsgruppe exzellent, selten, produktiv und wertvoll ist.“
1.2 MODELLE
Die Hochbegabungsmodelle lassen sich ebenfalls einordnen, und zwar in zwei Kategorien:
1. Hochbegabung als Leistung
- Hochbegabung ist als sichtbare, weit überdurchschnittliche Leistung beobachtbar. Sogenannte „underachiever“, das sind Personen, deren allgemeine Intelligenz stark ausgeprägt ist, die aber in der Schule nur schwache Leistungen erbringen, gehören nicht dazu.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Hochbegabung als Disposition
- Hochbegabung wird als bestimmte Veranlagung zu hohen intellektuellen (kreativen, sportlichen... ) Fähigkeiten definiert. Diese Anlagen kann man im intellektuellen Bereich mit Intelligenztests messen und wirken sich unabhängig vom Verhalten aus. „Underachiever“ zählen auch dazu.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Doch bilden sich herausragende Leistungen einer Person nach Stapf und Stapf (1983) nicht nur durch die Ausprägung einer hohen allgemeinen Intelligenz heraus. Auch das Zusammenwirken von Größen, wie erkenntnismäßige Fähigkeiten, die allgemeine Intelligenz, spezifische sowie nicht-kognitive Eigenarten und bestimmte vermittelnden Faktoren, zu denen z.B. besondere Sozialisationsbedingungen, Interessen, Motivationen etc. als auch biographischer Zufälle zählen, spielt eine wichtige Rolle für das Erbringen von außergewöhnlichen Leistungen. Diese vermittelnden Faktoren können sich sowohl als förderlich als auch als hemmend erweisen. So besteht heutzutage die Annahme eines Zusammenwirkens von Anlage- und Umweltfaktoren bei der Entwicklung von besonderen Begabungen. Die Frage nach der Interaktion bzw. der Wechselwirkung dieser beiden Größen und deren Einfluß auf die Entwicklung ist also für die Feststellung von intellektueller Hochbegabung sehr wichtig geworden.
Neben diese intellektuellen Begabung, die zumeist im Vordergrund der Betrachtung von Intelligenzforschung und -förderung steht, gibt es noch vier weitere Begabungsfelder:
1. Soziale Begabung (= interpersonale Kompetenz)
2. Musische Begabung (= Musikalität)
3. Bildnerisch-darstellende Begabung
4. Psychomotorische (praktische) Begabung
2. DIAGNOSTIK VON HOCHBEGABUNG
2.1 INTELLIGENZTEST
Für die (frühe) Identifikation einer Hochbegabung eines Kindes spielt die Durchführung von psychologischen Intelligenztests trotz der kritischen Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Defiziten dieser Tests eine große Rolle.
Die meisten dieser Testverfahren beruhen auf faktorenanalytischen Modellen, wie auch z.B. der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder (HAWIK), der auf dem Zwei-Faktoren- Modell von Spearman (1927) basiert. Der HAWIK gliedert sich in einen Verbal- und einen Handlungsteil. Diese beiden werden wiederum in insgesamt elf Untertest eingeteilt, deren Aufgaben nach einem steigenden Schwierigkeitsgrad angeordnet sind. Die Durchführung erfolgt in Einzeltestung der Kinder von 6 bis 16 Jahren und dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Zur Auswertung der Testergebnisse erfolgt eine getrennte Berechnung des Verbal- IQ, des Handlungs-IQ, sowie eines Gesamt-IQ. Ein Kritikpunkt des HAWIK ist die unsaubere Trennung von Intelligenzleistung und Schulwissens innerhalb des Verbaltests.
Gegen die Intelligenzdiagnostik spricht, dass die Testverfahren meist nicht den geforderten Testgütekriterien genügen. Zudem können musische, kreative oder z.B. sportliche Begabungen durch diese Verfahren nicht oder nur ungenügend festgestellt werden. Sie bleiben also außen vor, ebenso wie die motivationalen Variablen. Auch prüfen diese Tests nur einen bestimmten Ausschnitt intellektueller Fähigkeiten, den die Testentwickler ihrem Test zugrunde legen und decken so nicht die ganze Bandbreite von „intelligenten Erscheinungen“ ab.
Für die Durchführung von Intelligenztests zur Feststellung von Hochbegabung sprechen die messmethodischen Gründe. Das Testverfahren beschreibt die intellektuelle Fähigkeit einer Person in Zahlenwerte, welche mit den Zahlenergebnissen anderer Probanden verglichen werden können. Um so leichter lässt sich erkennen, ob und wie ausgeprägt ein Individuum überdurchschnittlich intelligent ist.
So ist der Testkennwert von Intelligenztestung, welchem die Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität zugrunde liegen, heutzutage das nützlichste Meßinstrument für eine intellektuelle Begabung. Am erfolgreichsten geschieht die Feststellung von Hochbegabung „im Rahmen einer fachpsychologischen Untersuchung durch Diplompsychologen/innen, die in der Intelligenzdiagnostik mit Kindern gut ausgebildet und erfahren sind und Kenntnisse über hoch begabte Kinder besitzen“.
2.2 BEOBACHTUNGSERFAHRUNGEN
Zur kompletten Diagnostik eines hochbegabten Kindes sollte man als Ergänzung der oben genannten Testverfahren die weit verbreitete Methode von Personenurteilen hinzuziehen. Diese Beurteilung kann auf verschiedenen Ebenen durchgeführt werden. So beobachten entweder Eltern, Lehrer oder Gleichaltrige das Verhalten eines Kindes an den Orten, an denen sie mit der zu beurteilenden Person zusammen kommen. Auch kann eine Selbstbeobachtung und Selbsteinschätzung der/des Hochbegabten im Vergleich mit anderen erfolgen.
Es gibt zwei verschiedene Arten, die Beobachtungsverfahren umzusetzen:
1. Anhand von Ratings
Bewertung aller Kinder einer Gruppe. Danach werden diese Werte in einer sogenannten Ratingskala eingeordnet.
⃗ Jedes Kind wird bezüglich seiner Hochbegabung bzw. „Nicht-Hochbegabung“ eingeschätzt.
2. Anhand von Nominationen
Nennung eines Kindes, das als möglicherweise hochbegabt beurteilt wird. Meist finden diese Auswahlverfahren innerhalb einer Gruppe (z.B. Schulklasse) statt.
⃗ Dieses Verfahren wird häufiger angewendet, da es ebenso effektiv wie die oben erwähnten Ratings ist, aber sich zudem als einfacher und schneller erwiesen hat.
- LEHRERURTEIL
Um außergewöhnliches Leistungspotential von Kindern zu diagnostizieren, liegt es am Nahesten, dies durch Beobachtungen zum Verhalten von Schüler im Unterricht seitens der
Lehrer zu bewerkstelligen. Diese Lehrerurteile sollten aber nur eine Ergänzung zu standardisierten Tests darstellen, da sie zwar zum einen von den Testergebnissen abweichen und so Zusatzinformationen bieten, zum anderen aber nicht den professionellen Ansprüchen genügen. Die Lehrkräfte sind nämlich aufgrund mangelnden Beurteilungstrainings nicht spezifisch genug ausgebildet, um Hochbegabung zu erkennen. Zudem binden sie sich zu sehr an die Notengebung, wodurch Kinder, welche eine der Begabung erwartungswidrige Schulleistung erbringen, die so genannten „underachiever“, nicht ihren eigentlichen Talenten entsprechend berücksichtigt werden und nicht als hochbegabt anerkannt werden. Auch fehlt den Lehrern teilweise ganz einfach die Objektivität. Dem abhelfen sollen jedoch Lehrerchecklisten, welche extra entwickelt wurden, um als Hilfestellung zu dienen und die Urteilsfähigkeit der Lehrkräfte zu verbessern. In diese Lehrerchecklisten werden bestimmte Verhaltensweisen der Schüler eingetragen, die dann in Ratingskalen nach Häufigkeit oder Ausmaß beurteilt werden.
Für das Einsetzen von Lehrerurteilen als Ergänzung zur Hochbegabtendiagnostik spricht u.a. die aufgrund langjähriger Berufserfahrung gewonnene Verfügung des ständigen Vergleiches mit Mitschülern bzw. mit anderen Klassenstufen. Zudem haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, auffällige Kinder über ein bis zwei Schuljahre hinweg intensiv zu beobachten, weshalb kurzfristige Leistungsschwankungen bei der Beurteilung nicht weiter ins Gewicht fallen.
- PEERNOMINATION
Unter Peernomination versteht man die Einschätzung hochbegabter Kinder durch Gleichaltrige. Diese Art der Hochbegabtendiagnostik ist jedoch nicht für jüngere Jahrgänge empfehlenswert, da insbesondere Grundschüler unter zehn Jahren dazu tendieren, Begabungen zu überschätzen und in diesem Zusammenhang bei ihrer Beurteilung auch äußere Faktoren, wie z.B. das Aussehen oder die Redegewandtheit mit einfließen lassen. Vorteile dieser Nennung von Hochbegabung ist, dass Gleichaltrige eine andere Sichtweise bzw. einen anderen Einblick als Erwachsene haben, um so ihre Mitschüler entsprechend ihrer Leistungen und ihrer Interessen zu beurteilen. Deshalb können sie auch Begabungsbereiche, die sie direkt tangieren, wie z.B. Führungsqualitäten etc., besser einschätzen. Zudem ist neben der Tatsache, dass Peernomination wie andere Beobachtungsverfahren bei der Durchführung einfach und ökonomisch ist, noch wichtig, dass es viele Beurteiler gibt, also das Ergebnis sich nicht als zu subjektiv gestaltet.
- ELTERNURTEIL
Elternurteile spielen zur Diagnose von Hochbegabung besonders im Vorschulalter eine wichtige Rolle. Denn Eltern haben „die beste Möglichkeit, die individuelle Entwicklungsgeschwindigkeit und die Kapazitäten ihres Kindes zu beobachten und einzuschätzen.“
Gegen diese Art der Nennung Hochbegabter spricht jedoch der fehlende Vergleich mit Gleichaltrigen sowie die positive Voreingenommenheit der beiden Elternteile gegenüber ihrem Kind.
- SELBSTRATING & -NOMINATION
Das Kind beobachtet sich selbst und vergleicht sich mit anderen, so dass es seine Begabung in irgendeiner Form erlebt.
Voraussetzung dieser zuletzt erwähnten Beobachtungsmöglichkeit von außergewöhnlicher Begabung ist, dass die sich Selbsteinschätzenden zu einer objektiven Beurteilung ihrer eigenen Leistungen fähig sind.
Jedoch zeigen Studien, welche die Übereinstimmung zwischen eigener Einschätzung und Ergebnissen aus Intelligenztests messen, auf, dass sich dieses Nominationsverfahren unabhängig vom Alter problematisch gestaltet. Trotzdem ist Selbstbeurteilung bei der Bewertung von Kreativität und Motivation von Vorteil, da in diesen Bereichen der Begabung ausreichende Meßinstrumente noch fehlen.
Diese verschiedenen Formen der Hochbegabtendiagnostik weisen also eine Reihe von Problemen auf: Die Urteile von Menschen unterliegen oft keiner objektiven Einschätzung bzw. Sicht, so nehmen Sympathien und Antipathien z. B. bei Lehrern oder Mitschülern einen großen Platz ein. Auch das Bezugssystem, aufgrund dessen Beurteilungen erfolgen, stellt sich als problematisch dar, da oft die Möglichkeit zum Vergleich mit anderen hochbegabten Kindern fehlt. Ein anderes Nachteil besteht darin, dass keine allgemein gültige Definition von Hochbegabung existiert, an der sich die Beobachter bei ihrer Bewertung halten könnten. Zudem kommt es aufgrund fehlender vorgegebener standardisierter Beobachtungsvorgaben zu einer Gesamteinschätzung des Beurteilers, aus der nicht mehr zu ersehen ist, aufgrund welcher Situation und welcher Einflüsse die Bewertung entstanden ist.
Jedoch sprechen auch eine Vielzahl von Vorteilen für diese Beobachtungsverfahren. So ist die Beurteilung durch Menschen ökonomisch, flächendeckend und entbehrt zusätzlicher Fachkräfte, da Eltern oder Lehrkräfte ohnehin viel Zeit mit dem Kind verbringen. Auch ist diese Beobachtung reichhaltiger, da mehr Verhaltensweisen und Begabungsbereiche, wie z.B.
Motivation oder Kreativität, erfasst werden als bei standardisierten Testverfahren üblich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Hochbegabung laut dem Text?
Der Text beschreibt verschiedene Definitionen von Hochbegabung, darunter Ex-post-facto-Definitionen (außergewöhnliche Leistung), IQ-Definitionen (IQ über 130), Talentdefinitionen (hervorragende Leistungen in spezifischen Bereichen), Prozentsatzdefinitionen (bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung), und Kreativitätsdefinitionen (originelle und kreative Leistungen).
Welche Modelle von Hochbegabung werden im Text unterschieden?
Der Text unterscheidet zwei Kategorien von Hochbegabungsmodellen: Hochbegabung als Leistung (sichtbare, überdurchschnittliche Leistung) und Hochbegabung als Disposition (Veranlagung zu hohen Fähigkeiten, unabhängig von Verhalten).
Welche Faktoren tragen laut dem Text zur Entwicklung herausragender Leistungen bei?
Laut Stapf und Stapf (1983) tragen nicht nur hohe allgemeine Intelligenz, sondern auch das Zusammenspiel von kognitiven Fähigkeiten, spezifischen und nicht-kognitiven Eigenarten, Sozialisationsbedingungen, Interessen, Motivationen und biographischen Zufällen zur Entwicklung herausragender Leistungen bei. Anlage- und Umweltfaktoren spielen eine wichtige Rolle.
Welche anderen Begabungsfelder werden neben der intellektuellen Begabung genannt?
Neben der intellektuellen Begabung werden soziale Begabung (interpersonale Kompetenz), musische Begabung (Musikalität), bildnerisch-darstellende Begabung und psychomotorische (praktische) Begabung genannt.
Welche Rolle spielt der Intelligenztest bei der Diagnose von Hochbegabung?
Intelligenztests spielen eine große Rolle bei der Identifikation von Hochbegabung, trotz Kritik. Sie ermöglichen die Messung intellektueller Fähigkeiten und den Vergleich mit anderen Probanden. Ein Beispiel ist der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder (HAWIK).
Welche Kritik gibt es an der Intelligenzdiagnostik?
Kritisiert wird, dass Testverfahren oft nicht den geforderten Testgütekriterien genügen und musische, kreative oder sportliche Begabungen nicht oder nur ungenügend festgestellt werden können. Zudem prüfen sie nur einen bestimmten Ausschnitt intellektueller Fähigkeiten.
Welche Beobachtungserfahrungen werden zur Diagnostik von Hochbegabung herangezogen?
Als Ergänzung zu Intelligenztests werden Personenurteile durch Eltern, Lehrer oder Gleichaltrige herangezogen. Es gibt Ratings (Bewertung aller Kinder) und Nominationen (Nennung möglicherweise hochbegabter Kinder).
Welche Rolle spielen Lehrerurteile bei der Hochbegabtendiagnostik?
Lehrerurteile können eine Ergänzung zu standardisierten Tests darstellen, da sie Informationen zum Verhalten von Schülern im Unterricht liefern. Sie sollten aber nicht allein ausschlaggebend sein, da Lehrer nicht spezifisch genug ausgebildet sind, um Hochbegabung zu erkennen.
Was ist Peernomination und welche Vorteile bietet sie?
Peernomination ist die Einschätzung hochbegabter Kinder durch Gleichaltrige. Vorteile sind, dass Gleichaltrige eine andere Sichtweise haben und Begabungsbereiche besser einschätzen können.
Welche Bedeutung haben Elternurteile bei der Diagnose von Hochbegabung?
Elternurteile spielen besonders im Vorschulalter eine wichtige Rolle, da Eltern die individuelle Entwicklungsgeschwindigkeit und die Kapazitäten ihres Kindes am besten beobachten und einschätzen können.
Welche Probleme gibt es bei den verschiedenen Formen der Hochbegabtendiagnostik?
Probleme sind u.a. subjektive Einschätzungen, fehlendes Bezugssystem, fehlende allgemein gültige Definition von Hochbegabung und fehlende standardisierte Beobachtungsvorgaben.
Welche Vorteile bieten die Beobachtungsverfahren bei der Hochbegabtendiagnostik?
Vorteile sind Ökonomie, Flächendeckung, fehlende zusätzliche Fachkräfte, Reichhaltigkeit und die Erfassung von mehr Verhaltensweisen und Begabungsbereichen.
Welche Schlussfolgerung wird hinsichtlich der Diagnostik von Hochbegabung gezogen?
Es wird die Schlussfolgerung gezogen, dass ein einziges Testverfahren nicht die vielfältigen Erscheinungsbilder von Hochbegabung ermitteln kann. Eine multimodale und multimethodale Diagnostik wird als optimale Lösung dargestellt.
- Quote paper
- Markus Wachter (Author), 2001, Hochbegabung. Modelle und Methoden zur Diagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100887