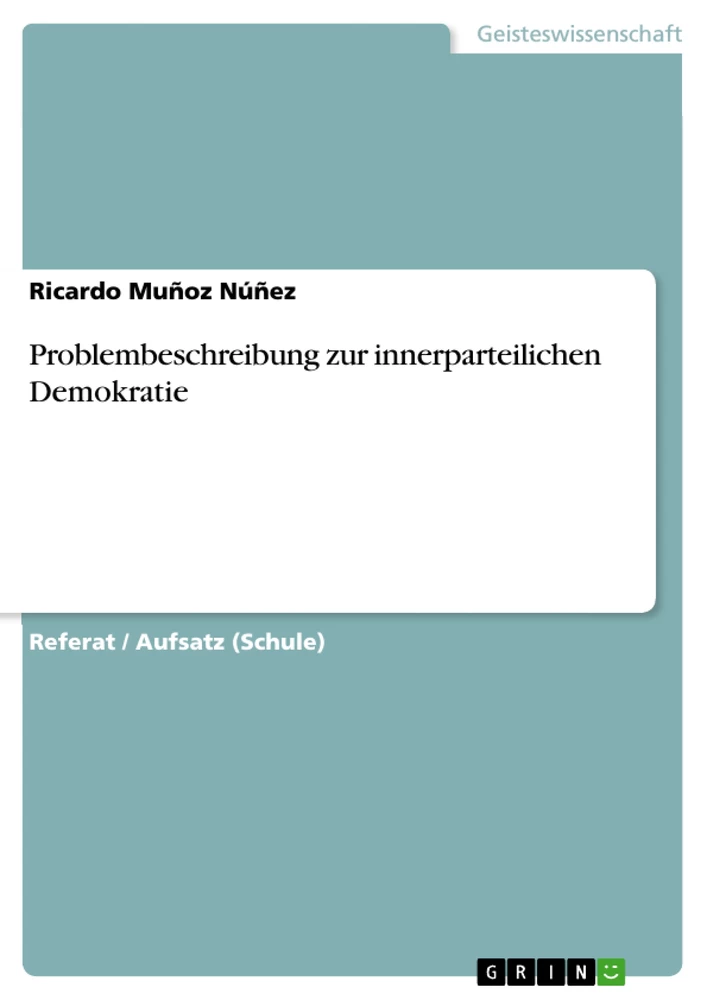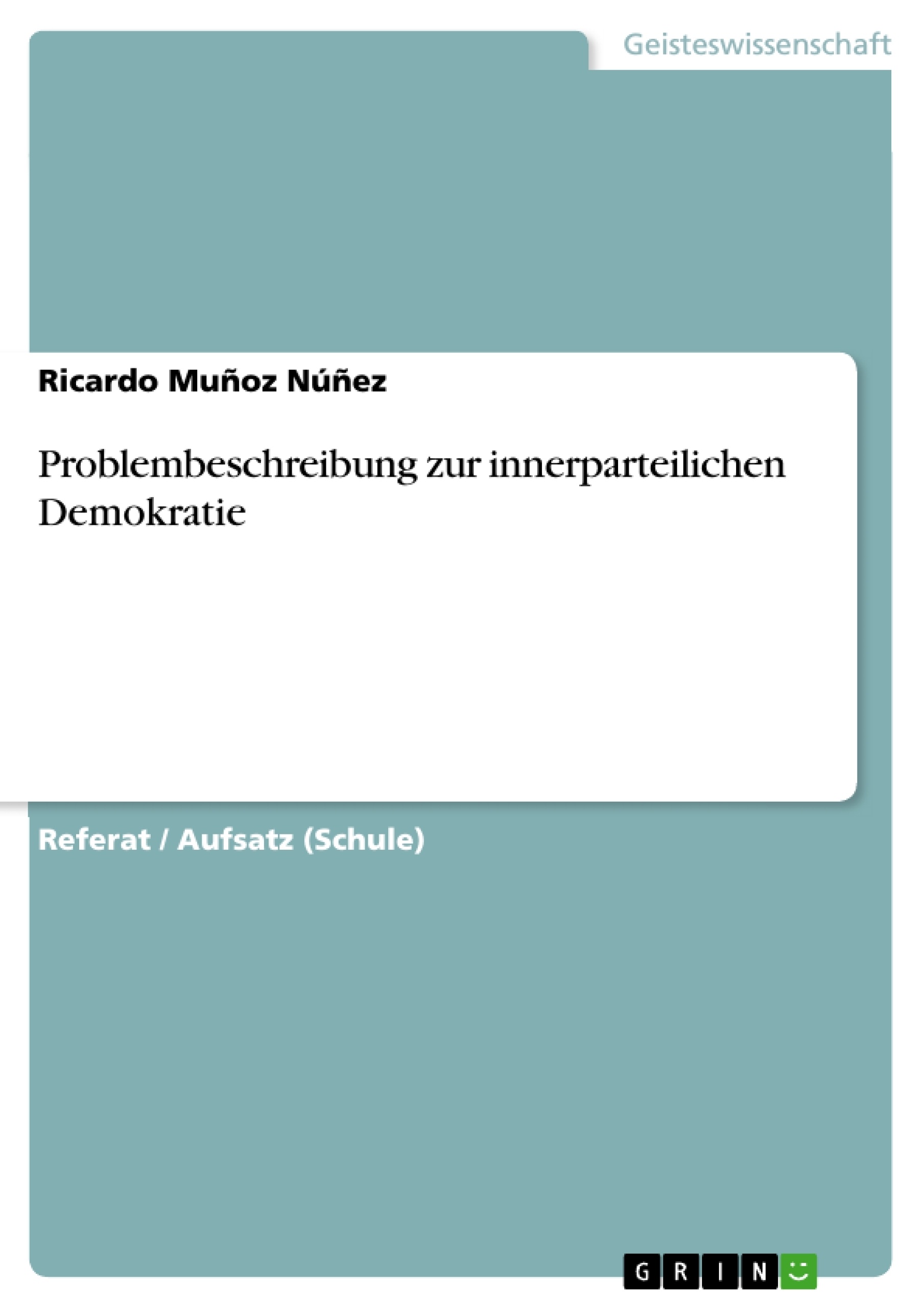Problembeschreibung zur innerparteilichen Demokratie von Ricardo Muñoz Núñez
Wenn man von innerparteilicher Demokratie spricht, dann spricht man von Organisationsstrukturen, die Mitgliedern die Chance zu einer demokratischen Mitwirkung ermöglichen. Jedes Mitglied hat das volle Recht auf Meinungsäußerung sowie auf Chancengleichheit.
Eine Hamburger Landtagswahl, datiert aus dem Jahre 1991, wurde aufgrund „gravierender demokratischer Mängel“ im Jahre 1993 vom Hamburger Verfassungsgericht für ungültig erklärt, weil es laut Gerichtsbeschluß weder auf der Mitgliederversammlung noch auf der anschließenden Vertreterversammlung der CDU überhaupt ein echtes Wahlverfahren für die Kandidaten gegeben habe. Damit wurde gegen die demokratischen Bestimmungen verstoßen, indem man die Kandidaten ohne jegliche Wahl einfach gesetzt hat. Sogar bis hin zur Gestaltung der Stimmzettel habe es keinen Raum für andere Vorschläge bzw.
Minderheitenpositionen gegeben. Anhand dieses Vorfalles, lässt sich eigentlich sehr gut erklären, wie es sein sollte. Und zwar sollte eine Partei nach dem Pyramiden-Prinzip aufgebaut sein. Die Basis besteht aus den vielen Ortsverbänden, die sich jährlich zu einer Mitgliederversammlung treffen, um aktuelle Probleme inner- und außerhalb der Partei zu diskutieren und um Kreisdelegierte zu wählen, die sie im Kreisverband vertreten. Der Kreisverband ist die zweite Instanz der Parteienstruktur. Dort treffen die, von der Mitgliederversammlung gewählten, Kreisdelegierten eines Landkreises zusammen, um die Delegierten des Landesparteitages zu wählen. Der Landesverband ist die dritte Institution, und stellt auch gleichzeitig die Vertreter, die in der vierten Institution, dem Bundesparteitag, der alle zwei Jahre einberufen wird, vertreten sind. Kreis-, Landes- und Bundesverband sind jeweils nach demselben Muster aufgebaut, und zwar besteht jeder Verband aus folgenden 4 Organen: einem Gericht, einem Vorstand, einem Allgemeinen Parteiausschuss und einer Delegierten-Versammlung. Alle vier werden jeweils demokratisch gewählt. Dabei steht jedem Mitglied das Recht zu, gewählt zu werden und wählen zu dürfen. Jeder hat das Recht auf geheime Wahlen und Abstimmungen. Natürlich wird auch hier nach dem Mehrheitswahlrecht votiert. Nach den demokratischen Grundzügen des Staates Deutschland zu folge, ist es nicht verwunderlich, wieso eine Partei auf demokratischen Füßen stehen muss. Nach diesem theoretischen Muster zu folge, müsste man von einer Vertretung des Volkswillen ausgehen, denn nach dem Mehrheitsprinzip, werden die gewählt, die dem Volkswillen am ehesten entsprechen. Dieses ist jedoch nicht so. Laut Michels (Soziologe) würden aus gewählten Vertretern spontane Führer entstehen, die sich in mehreren Etappen zu einen Führertum entwickeln und dies zum Beruf machen. Er nennt das Führertum „eine notwendige Erscheinung jeder Form gesellschaftlichen Lebens“, die dazu führe, dass Volksinteressen in den Hintergrund gestellt würden und die Macht für andere Zwecke mißbraucht würde. Michels bezieht diese Aspekte auf jede Partei, somit stelle jede Partei eine mächtige, auf demokratischen Füßen ruhende Oligarchie dar. Michels Definition eines Proletariers, sieht diesen fast schon als einen durch Gehirnwäsche überzeugten Bürger, der durch kulturell Überlegenere und Sprachgewandte seine Entscheidungen trifft und nicht mehr nach prinzipiellen Grundzügen urteilt. Somit kann von einer Vertretbarkeit der Volksinteressen keine Rede sein. Um eben solchen Strukturen Einhalt zu gebieten gibt es auch Ansätze zur strukturellen Erneuerung der politischen Führung.
- Hierbei sollen bei Wahlen Einschränkungen gemacht werden, um niemanden einen Wahlkandidaten aufzuzwingen, indem man keine Blockwahlen zulässt.
- Auch an der Besoldung sollen Einschränkungen vorgenommen werden, so daß der Verdienst nicht alleiniges Ziel sein kann um den Beruf Politiker anzustreben.
- Für Kandidaten gelten bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen. Somit wird das Anwärterfeld auf ein Minimum reduziert, der es nur denjenigen erlaubt wichtige Ämter zu bekleiden, die sich auch schon beruflich mindestens 10 Jahre lang bewährt haben.
- Die Konzentration von Ämtern, damit ist Arbeitsteilung gemeint, soll bewirken, dass Politiker neben ordnungspolitischen Aufgaben keine anderen kopfzerbrechenden Tätigkeiten ausüben sollen. Dies führe zu mehr Ausgelassenheit der Politiker.
- Auch die wirtschaftliche Abhängigkeit soll so weit wie möglich reduziert werden um eigene Standpunkte offenbaren zu können, ohne die Wirtschaft direkt einzubinden.
- Auch die Zahl der Abgeordneten sei drastisch zu senken.
Ob diese Punkte eine Verbesserung oder gar eine Abschaffung der oligarchischen Tendenzen herbeiführen sei zu bedenken, doch kann man sagen, dass durch einige Punkte die demokratischen Grundzüge gestärkt werden, so z.B. Einschränkung bei Wahlen, dass man nicht mehr Blockkwahlen zulässt, dieses führt zu einer besseren Verteilung der Ämter auf verschieden prädestinierte bestimmten Kandidaten zu besetzen. Im Anbetracht der Tatsachen sehe ich den Punkt der bestimmten Kriterien für Kandidaten eher als Rückschritt, denn dadurch wird eine Konzentration von eben den kulturell Überlegeneren und Sprachgewandteren in ihrer Konsistenz bzw. Beständigkeit gestärkt.
Ich persönlich halte Michels Ehernes Gesetz für etwas überspannt. Er sieht den Menschen als eine Art Kind, der leicht zu überreden sei, doch heutzutage kann man davon ausgehen, dass die Willensbildung nicht mehr so beschränkt ist wie zur Zeit von Michels (1876-1936), denn zur Willensbildung kommen heutzutage verschiedene Medien zum tragen: Internet, Fernsehen, Rundfunk, Computer,... - um nur die größten zu nennen. Daher sehe ich heutzutage die Wahlen nicht mehr als „manipuliert“ an, durch diejenigen, die kulturell überlegener und sprachgewandter sind, sondern als Widerspiegelung der Volksinteressen. Wobei an diesem Punkt erwähnt werden muss, dass dies nicht immer der Fall ist - Doppel Pass!!!
Häufig gestellte Fragen zu Ricardo Muñoz Núñez's "Problembeschreibung zur innerparteilichen Demokratie"
Was versteht man unter innerparteilicher Demokratie?
Unter innerparteilicher Demokratie versteht man Organisationsstrukturen innerhalb einer Partei, die den Mitgliedern die Möglichkeit zur demokratischen Mitwirkung geben. Jedes Mitglied soll das Recht auf freie Meinungsäußerung und Chancengleichheit haben.
Was war der Anlass für die Auseinandersetzung mit dem Thema innerparteiliche Demokratie im Text?
Der Text bezieht sich auf eine Hamburger Landtagswahl von 1991, die 1993 vom Hamburger Verfassungsgericht aufgrund von "gravierenden demokratischen Mängeln" für ungültig erklärt wurde. Es gab laut Gerichtsbeschluss kein echtes Wahlverfahren für die Kandidaten der CDU.
Wie sollte eine Partei idealerweise aufgebaut sein?
Der Text beschreibt einen pyramidenförmigen Aufbau: Ortsverbände (Basis), Kreisverband, Landesverband und Bundesparteitag. Jeder Verband besteht aus einem Gericht, einem Vorstand, einem Allgemeinen Parteiausschuss und einer Delegierten-Versammlung, die alle demokratisch gewählt werden.
Was kritisiert Michels (Soziologe)?
Michels kritisiert, dass aus gewählten Vertretern spontane Führer entstehen, die sich zu einem Führertum entwickeln und dies zum Beruf machen. Er bezeichnet dies als "eiserne Gesetz der Oligarchie" und sieht darin die Gefahr, dass Volksinteressen in den Hintergrund gestellt und die Macht für andere Zwecke missbraucht wird.
Welche strukturellen Erneuerungen der politischen Führung werden vorgeschlagen?
Der Text nennt folgende Vorschläge: Einschränkungen bei Wahlen (keine Blockwahlen), Einschränkungen bei der Besoldung, Kriterien für Kandidaten (z.B. Berufserfahrung), Konzentration von Ämtern (Arbeitsteilung), Reduzierung wirtschaftlicher Abhängigkeit und Reduzierung der Anzahl der Abgeordneten.
Wie bewertet der Autor die vorgeschlagenen strukturellen Erneuerungen?
Der Autor sieht in einigen Punkten eine Stärkung der demokratischen Grundzüge (z.B. Einschränkung bei Wahlen), kritisiert aber andere (z.B. Kriterien für Kandidaten) als potenziellen Rückschritt.
Wie steht der Autor zu Michels' Theorie?
Der Autor hält Michels' "Ehernes Gesetz der Oligarchie" für überspannt, da er davon ausgeht, dass die Willensbildung der Bürger heutzutage durch verschiedene Medien stärker beeinflusst wird und somit nicht mehr so leicht manipulierbar ist.
Welche Schlussfolgerung zieht der Autor?
Der Autor schließt, dass sowohl Parteien als auch Wähler zu einer "neuen Position" finden und einen einheitlichen Kurs verfolgen müssen, um die Interessen der Wähler zu wahren. Wenn die Parteien dies nicht erfüllen, muss der Wähler seinen "Kurs" ändern und sich nicht an seine Stammpartei klammern.
- Quote paper
- Ricardo Muñoz Núñez (Author), 2000, Problembeschreibung zur innerparteilichen Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100870