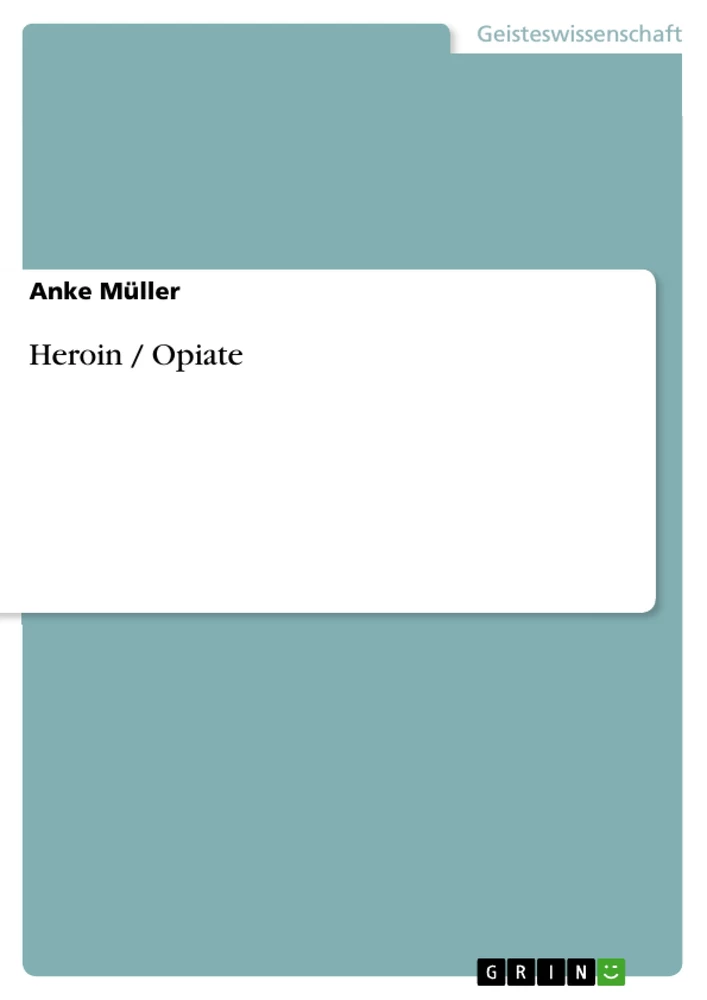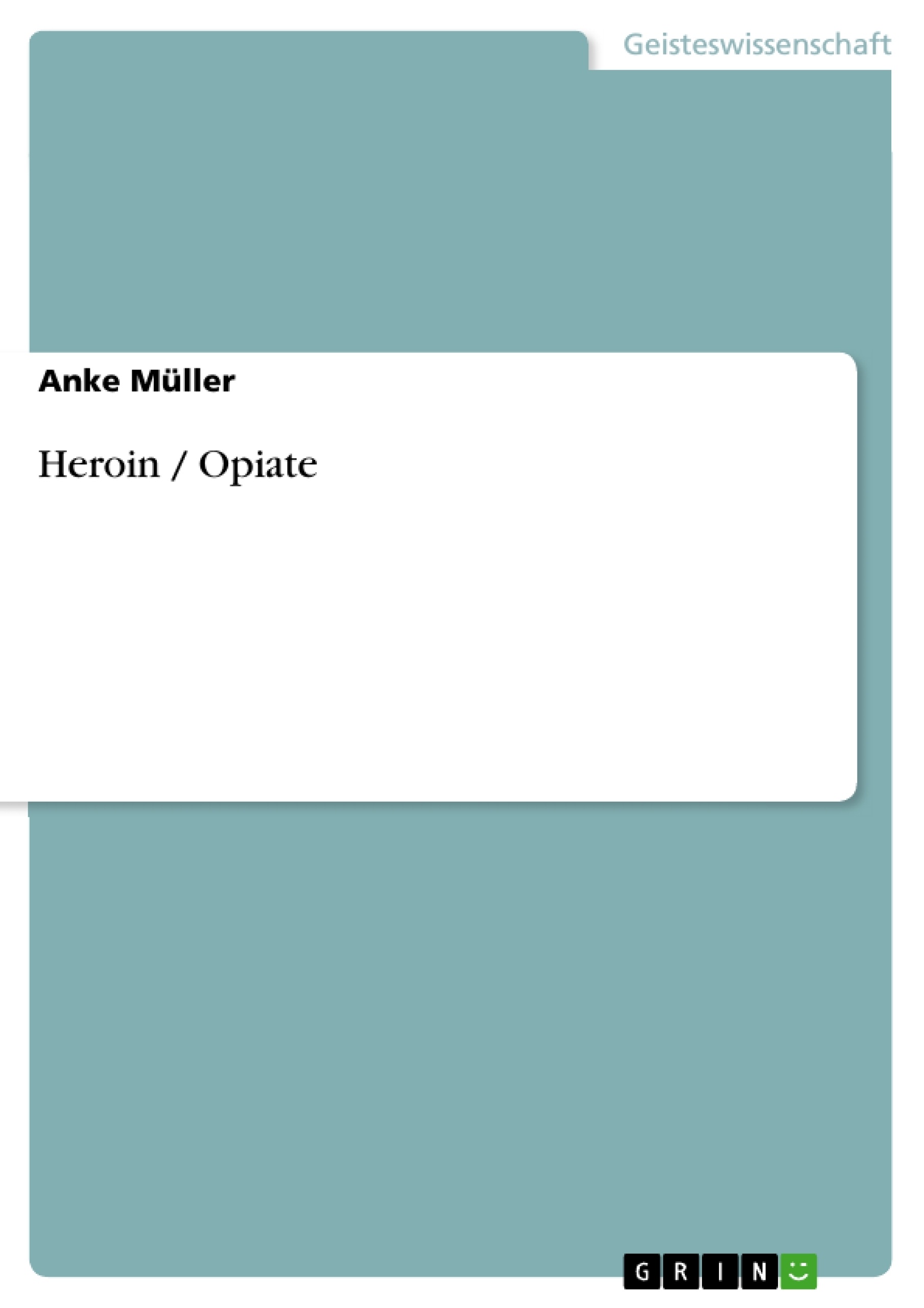Stellen Sie sich vor, Sie verlieren sich in einem Strudel aus Euphorie und Betäubung, nur um in der grausamen Realität der Abhängigkeit zu erwachen. Diese tiefgründige Analyse entlarvt die heimtückische Macht des Heroins, beginnend bei seiner historischen Herkunft aus dem Schlafmohn bis hin zu den verheerenden Auswirkungen auf Körper und Geist. Erfahren Sie mehr über die komplexen chemischen Prozesse, die im Gehirn ablaufen und das Suchtverhalten antreiben, während gleichzeitig die verheerenden Risiken und Folgen des Heroinkonsums schonungslos aufgedeckt werden. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Betroffene, Angehörige und Fachleute, der fundierte Informationen über die verschiedenen Therapieansätze bietet, von ambulanten Beratungsstellen bis hin zu stationären Entzugskliniken. Ein besonderer Fokus liegt auf der Methadon-Substitutionstherapie, ihren Zielen, Indikationen und Behandlungsmethoden, um den Weg aus der Sucht zu ebnen. Doch Vorsicht: Der Weg zur Heilung ist steinig und von Rückfällen geprägt. Lassen Sie sich von den Therapieergebnissen und den vielfältigen Unterstützungsangeboten inspirieren, die neue Hoffnung schenken. Die detaillierte Darstellung psychopathologischer Symptome bei Heroinabhängigen ermöglicht ein tieferes Verständnis der komplexen Zusammenhänge und unterstützt eine gezielte Behandlung. Die umfassende Auseinandersetzung mit den Ursachen, Auswirkungen und Behandlungsmöglichkeiten der Heroinabhängigkeit macht dieses Buch zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Kampf gegen die Sucht. Tauchen Sie ein in die Welt der Drogenabhängigkeit, um die Mechanismen zu verstehen, die Menschen in ihren Bann ziehen, und entdecken Sie die Wege, die aus dieser dunklen Spirale herausführen. Ein aufrüttelnder Appell zur Prävention und ein Hoffnungsschimmer für alle, die sich nach einem Leben ohne Drogen sehnen – fundiert, informativ und mit dem Ziel, Leben zu retten und Perspektiven zu eröffnen. Die Sucht ist eine Krankheit, aber Heilung ist möglich. Entdecken Sie die Wahrheit hinter der Fassade des Rausches und finden Sie den Mut, den ersten Schritt in ein neues Leben zu wagen.
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
1.1. Allgemeines
2. Hauptteil
2.1.Herkunft und Geschichte
2.2. Chemische Details
2.3. Wirkung
2.4. Risiken
2.5. Maßnahmen
3. Behandlung der Drogenabhängigkeit
3.1. Erfassung psychopathologischer Symptome bei Heroinabhängigen
3.2. Therapeutisches Angebot
3.3. Ambulante Therapieeinrichtungen
3.4. Stationäre Therapieeinrichtungen
3.5. Therapieergebnisse
4. Methadon
4.1. Zielsetzung
4.2. Indikation
4.3. Behandlungsmethoden
4.4. Dosierung
4.5. Abbruch der Methadonbehandlung
4.6. Ferien und Methadon
4.7. Grundsätze der Substitution
5. Schlussteil
6. Literaturverzeichniss
1. Einleitung
1.1 Allgemeines
Heroin ist ein Rauschgift, welches in kurzer Zeit zu schwerer Abhängigkeit führt. Die schnelle Gewöhnung an das Rauschgift bedingt, dass der Süchtige immer häufiger immer größere Mengen davon benötigt.
Heroin wirkt direkt auf das Gehirn, wo es die Schmerzempfindung unterdrückt und das Atemzentrum hemmt.
Heroin zerstört die Persönlichkeit des Abhängigen. Es macht passiv und antriebslos. Heroinsüchtige vernachlässigen zwischenmenschliche Beziehungen zu Familie und Freunden. Sie kapseln sich ab und beschränken sich immer mehr auf oberflächliche Kontakte im Drogenmilieu. Sie verlieren das Verantwortungsgefühl für sich und andere und können oft den Ansprüchen des Berufslebens oder der Schule nicht mehr genügen.
Heroin führt zum Tod durch Ersticken. Man spricht dann von Tod durch Überdosis. Wie hoch diese Überdosis im Einzelfall ist, kann aber im Voraus nicht genau berechnet werden. Todesfälle treten aber auch ohne Überdosierung auf, zum Beispiel durch ein Lungenödem (Wasserlunge) oder durch Unfall. Auch die Selbstmordrate ist erhöht.
Heroin schädigt das Erbgut und schwächt die körpereigenen Abwehrkräfte gegen Krankheiten.
Heroin führt bei schwangeren Frauen häufig zu Frühgeburten. Da das Neugeborene heroinabhängig auf die Welt kommt, macht es als erstes einen äußerst schmerzhaften, lebensgefährlichen Entzug durch. Die rauschgiftabhängigen Mütter sind nicht in der Lage, dem Kind die lebensnotwendige Zuwendung und Pflege zu geben.
All diese Schädigungen sind Folgen des Heroins selber, unabhängig von dessen Reinheitsgrad und unabhängig davon, ob es legal oder illegal ist. Selbstverständlich kann auch eine ärztlich kontrollierte Abgabe von Heroin diese Schäden nicht verhindern.
Rauschgifte verursachen Abhängigkeit, und es ist nicht vorauszusagen, wie schnell sie bei jedem einzelnen zustande kommt. Bedenkt man, dass gerade bei Heroin und Kokain jede einzelne Rauschgifteinnahme tödlich sein kann, ist es nicht nur verharmlosend, sondern geradezu unverantwortlich, von einer «zeitlich begrenzten Suchtphase» zu sprechen. Wenn die Möglichkeit eines «kontrollierten Umgangs» mit Drogen propagiert wird, kommt es zum Abbau natürlicher Hemmschwellen gegenüber dem Rauschgiftkonsum. Insbesondere gefährdete Jugendliche werden zur Illusion verführt, sie hätten ihren Drogenkonsum unter Kontrolle. In Wirklichkeit hat die Jugend genug damit zu tun, ihre Lebensaufgaben anzugehen und konstruktiv in der Gesellschaft tätig zu werden.
Die Behauptung, kontrolliert mit Rauschgift umgehen zu können, ist ein typisches Argument der Süchtigen selbst, wenn sie vertuschen wollen, dass sich ihr ganzes Sinnen und Trachten nur um die Rauschgifte dreht. Wird dieses Argument durch Behörden vertreten, macht sich der Staat zum Helfershelfer der Drogensucht und lässt die Jugendlichen ins Elend abgleiten.
Je länger der Drogenkonsum anhält, desto größer wird die Gefahr einer bleibenden körperlichen und seelischen Schädigung, auch wenn der Süchtige schließlich dank größtem Einsatz von Fachleuten sowie von Familie, Freunden und Bekannten doch noch von den Drogen wegkommt. In jedem Fall aber hat er viele wertvolle Lebensjahre unwiderruflich an die Drogen verloren.
Es gibt keine «Suchtphase». Ein Abhängiger hört dann mit Rauschgiften auf, wenn er durch inneren Leidensdruck oder durch verschiedenste Einflüsse von außen dazu veranlasst wird. Die Grundlage für solch positive Einflüsse ist eine gesamtgesellschaftliche Stellungnahme gegen Drogen.
Mit jeder Rauschgiftabgabe wird die Sucht der Rauschgiftabhängigen verfestigt.
Dadurch haben die Abhängigen kaum mehr Anlass, mit dem Rauschgiftkonsum aufzuhören. Wenn eine Gesellschaft ihre Ärzte beauftragt, Drogen abzugeben, signalisiert sie dem Süchtigen damit, dass sie das Abstinenzziel verlassen hat. Der Arzt, der Drogen abgibt, wird vom Süchtigen in erster Linie als Drogenlieferant betrachtet und nicht mehr als Helfer gegen die Sucht ernst genommen.
Drogen - auch vom Arzt abgegebene - sind eine chemische Zwangsjacke, aus der sich die Süchtigen nicht selbst befreien können. Durch die Drogen werden sie körperlich und seelisch geschwächt. Einer verantwortungsvollen Arbeit nachzugehen, zum Gemeinwohl beizutragen und Freundschaften zu pflegen ist ihnen über kurz oder lang nicht mehr möglich. Solange der Drogenkonsum andauert, gelingt die Wiedereingliederung in die Gesellschaft in der Regel nicht. Solche Drogensüchtige müssen zeitlebens von Sozialämtern, Krankenkassen und Invalidenversicherungen finanziell unterstützt werden.
Die Polytoxikomanie (Abhängigkeit von verschiedenen Drogen gleichzeitig) verbreitet sich durch jede Rauschgiftabgabe, weil die Süchtigen die staatlich oder ärztlich abgegebenen Rauschgifte als zusätzliches Angebot betrachten und weil die illegalen Händler auf andere Substanzen ausweichen. Bei der sehr kostspieligen Heroin- und Methadonabgabe hat sich gezeigt, dass ein Grossteil der Bezüger zusätzlich andere Rauschgifte zu sich nimmt und praktisch keiner vom Drogenkonsum loskommt.
Jede legale Drogenabgabe, auch durch den Arzt, wirkt drogenverharmlosend. Das bedeutet eine Gefahr für alle jungen Menschen, denn die Verharmlosung der Drogen schwächt die Widerstandskraft gegen Drogen.
Die Heroinabgabe führt nicht zu einer wirklichen Verminderung der Schäden, sondern schafft zusätzliche Probleme und vergrößert den Schaden, der durch Drogen angerichtet wird.
2. Hauptteil
2.1. Herkunft/Geschichte
Die Opiate sind Wirkstoffe des Schlafmohns (Papaver somniferum); ihre wichtigsten Vertreter sind Opium, Morphium, Heroin und Kodein.
Nur der "Papaver somniferum" enthält in seiner noch nicht reifen Kapselwand den begehrten Saft. Der in Europa einheimische Klatschmohn ist psychisch vollkommen wirkungslos.
In der Erntezeit (für das Opium, nicht die schwarzen Mohnsamen) wird die äußere Kapselwand behutsam mit einem mehrklingigen Spezialmesser angeritzt. Die austretende Mohnmilch verfärbt sich rasch braun und trocknet ein. Man schabt sie anderntags ab und sammelt sie in Gefäßen oder auf Mohnblättern. Pro Kapsel erhält man etwa 0,05 Gramm Rohopium.
Hauptlieferanten sind auf dem Balkan Bulgarien, Jugoslawien und die Türkei, im nahen und Mittleren Osten Persien, Libanon und Afghanistan; im Fernen Osten Indien, Pakistan, Vietnam und China sowie das "Goldene Dreieck" zwischen Burma, Laos und Thailand; in Mittelamerika vor allem Mexiko, in Südamerika Kolumbien.
Die erste Verarbeitungsstufe ist Rauchopium, welches in China auch Chandu genannt wird. Für die Medizin ist vor allem das Morphium von Bedeutung. Es wird in modernen Laboratorien aus dem Rohopium extrahiert.
2.2. Chemische Details
Im Rohopium sind 25 verschiedene Wirkstoffe (Alkaloide) enthalten, deren Quantität und Mischungsverhältnis je nach Herkunft schwankt. Der stärkste und zugleich wichtigste Bestandteil ist mit zehn bis zwölf Prozent das Morphin.
In seiner reinen Form wird es auch Morphium genannt, nach Morpheus, dem griechischen Gott des Schlafes. Andere Alkaloide sind Narkotin (5-6%), Kodein (0,15- 1%), Papaverin (0,1-0,4%) sowie Narcein, Thebain, Laudanosin, Xanthalin und Noscapin. Beim Opium handelt es sich um den getrockneten Milchsaft der Mohnkapsel. Heroin ("H" = "Eitsch", "Diamorphin") wird aus der Morphinbase hergestellt durch Erwärmen mit Essigsäureanhydrid oder Acetylchlorid. Das so gewonnene weiße, kristalline Pulver besitzt sechsfache Morphinwirkung.
Für die Medizin werden sogenannte synthetische Opiate hergestellt wie die Schmerzmittel Eukodal, Dilaudid, l-Polamidon (Levomethadon), und die Hustenmittel Codein, Acedicon und Dicodid.
Am stärksten greift Opium, also die Kombination aller Alkaloide, in die biochemischen Prozesse des Körpers ein, wenn es gespritzt wird; Rauchen und Essen folgt direkt danach.
Wesentlich stärker als das Opium wirkt Morphin (Morphium), das Friedrich Wilhelm Sertürner 1806 erstmals isolieren konnte. Als 1853 die Injektionsspritze erfunden wurde, haben Morphinisten sie direkt genutzt, um den Stoff schon in 15 Minuten im Gehirn spüren zu können.
Auf der Suche nach neuen, nicht süchtig machenden Substanzen, entdeckte man Diacetylmorphin, das durch Morphin und Essigsäure entsteht. Aufgrund der - im positiven Sinne - heroischen Wirkungen, die man dem Arzneimittel in der ersten Begeisterung zuschrieb, nannte man es Heroin.
1898 wurde es in den Elberfelder Farbenfabriken zum erstenmal hergestellt. Es sollte vor allem Morphinsüchtige von ihrer Abhängigkeit heilen.
Heroin ist das schlimmste Suchtmittel, das man bisher entdeckt hat.
Es ist also ein synthetisch hergestelltes Opiat (zentrales Schmerzmittel), das im Körper in Morphin umgewandelt wird. Aufgrund seiner guten Fettlöslichkeit kann es leicht die Blut-Hirn-Schranke passieren, was zu einem schnellen Konzentrationsanstieg im Gehirn und dem dafür typischen "Kick" führt.
Das Suchtpotential ist hoch; das anfänglich erreichte Glücksgefühl weicht der körperlichen Abhängigkeit, die eine ständige Zufuhr von Heroin nötig macht, da sonst schwere Entzugserscheinungen auftreten. Obwohl Heroin auch geraucht oder geschnupft werden kann, erfolgt die Zufuhr meist als intravenöse Injektion.
Bei Überdosierung führt es durch Beeinträchtigung des Atemzentrums zu starker Atemlähmung bis hin zum Atemstillstand.
Das Heroin untersteht dem Betäubungsmittelgesetz und darf nicht verschrieben werden. Die Zahl der heroinsüchtigen Personen ist schwer zu schätzen.
2.3. Wirkung
Heroin ist die derzeitig am meisten eingenommene harte Droge, verliert aber in den letzten Jahren immer mehr an Boden gegenüber dem Kokain. In der letzten Zeit kamen unter den Namen Speedballs oder auch Cocktail eine Kombination von Heroin und Kokain in den Handel. Diese Droge lässt bei den Anwendern die Aggression sehr stark steigen.
Heroin wirkt schmerzstillend und euphorisiere nd.
Negative Empfindungen, wie Schmerzen, Leeregefühle und Angst werden schon kurz nach der Einnahme unterdrückt und durch ein Glücksgefühl (Flash) überdeckt.
Die euphorisierende Wirkung des Heroin nimmt aber schon nach kurzer Anwendungszeit ab.
Von nun ab ist die physische Abhängigkeit der Antrieb zur Sucht. Die psychische und physische Abhängigkeit ist schnell nach einem regelmäßigen Konsum vorhanden.
- Beeinflusst das zentrale Nervensystem
- Stark euphorisierend
- Stark betäubende und beruhigende Wirkung.
- Steigert das Selbstbewusstsein
- Wohlige Dösigkeit („nodding“) mit dem (unrealistischen) Gefühl des Einklangs mit der Welt und des Verblassens aller Probleme
- Negative Nachschwankung (Depression, Unruhe)
Die Dauer der Heroinwirkung beträgt etwa 4-6 Stunden, so dass bei Abhängigkeit mehrfach am Tag gespritzt werden muss (zum Vergleich die Halbwertszeit von l- Polamidon über 24 Stunden).
2.4. Risiken
Heroin verursacht eine sich fast sofort einstellende stärkste körperliche und seelische Abhängigkeit.
- Häufiger Tod durch Überdosierung und giftige Beimengungen
- Bewusstlosigkeit, Atemlähmung, Infektionsgefahr (Geschwüre, Hepatitis, AIDS) durch nichtsterile Spritzen, Leberschäden, Magen-Darmstörungen.
- Unfallgefahr durch Bewusstseinstrübung und Koordinationsstörungen
- Gefahren sind auch Beschaffungskriminalität und Prostitution
- Dosissteigerung durch Toleranzentwicklung
- Abkehr von der realen Welt (Leben in der „Szene“)
- Persönlichkeitsabbau, egozentriert, reizbar, aggressiv, Verlust jeglichen Interesses, Verwahrlosung, Wahnideen, Gehirnschäden, Abmagerung, Verödung der Venen, körperlicher Verfall
Man geht davon aus, dass bereits 80 % der Abhängigen an einer Hepatitis C leiden. Dazu kommen:
- Vernachlässigung elementarer Selbstfürsorge und Hygiene in der Lebensführung (Essen, Waschen, Bekleidung, Körperpflege) infolge ständigen Beschaffungs- und Verfolgungsdrucks
- Zunehmender Mischkonsum von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, in Zeiten, in denen das für Heroin benötigte Geld nicht aufgebracht werden kann und Entzugssymptome überbrückt werden müssen
- Hohe psychische Belastungen durch Verfolgungsangst, Beschaffungsdruck und Prostitution unter ungeschützten und erniedrigenden Bedingungen (Schätzungen zufolge geht ein Großteil der Drogenkonsumenten zumindest teilweise der Prostitution nach
- Hohe Obdachlosigkeit und häufig wechselnden, kurzfristigen Unterkünften bei Bekannten aus der Drogenszene oder Freiern
- Soziale Isolation und Vereinsamung, da Kontakte zur Familie, zu Freunden und Bekannten außerhalb der Drogenszene meist nachlassen und schließlich abreißen und Szenekontakte stark durch Zwänge und Bedingungen der Drogenbeschaffung bestimmt sind
- Mangelndes Selbstvertrauen in die Möglichkeiten zur grundlegenden Verbesserung der Lebenssituation, nachdem wiederholte Entzüge und Therapieversuche nicht aus der Abhängigkeit geführt haben.
2.5. Maßnahmen
Im Vordergrund steht die Sicherung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen. Bei allen Patienten ist der Blutzucker zu bestimmen.
Die sogenannte klassische Drogenkarriere beginnt zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr
Drogenkonsumierende verlassen ihr Elternhaus 4,5 Jahre früher als ihre Altersgefährten Entzugsbeschwerden setzen bei abhängigem Heroinkonsum alle vier bis fünf Stunden ein.
Wir verzeichnen "einem geschätzten Zuwachs von jährlich fünf Prozent Abhängiger, was einer Verdopplung alle 20 Jahre entspräche (Ziegler)."
Am besten ist eine "Vorbeugung durch kontinuierliche Aufklärung, am günstigsten im persönlichen Gespräch in kleinen Gruppen. Die öffentliche Massenaufklärung erweist sich meist als Bumerang mit dem genau gegenteiligen Effekt, dass das Interesse an Drogen unnötig stimuliert wird." (Ziegler)
"Jüngere amerikanische Studien haben gezeigt, dass viele bisher beschuldigte Faktoren den tatsächlichen Drogenkonsum Jugendlicher nur in sehr geringem Maß beeinflussen - so die Verführung durch Altersgenossen und die Kenntnis der Drogen und ihrer Bezugsquellen (Hammond 1972). [...] Der entscheidende Einfluss geht von familiären Faktoren aus, die es nach Studien von Richard Blum (1972) mit hoher Wahrscheinlichkeit gestatten, vorauszusagen, ob ein Jugendlicher an einer Drogen hängen bleibt oder nicht. [...] Zu ihnen gehört etwa der elterliche Drogenkonsum (Alkohol, Zigaretten, Tabletten), die Einstellung zur Erziehung, das 'Urvertrauen' (Erikson 1965) sowie die Tatsache, ob ein Kind akzeptiert und in seiner Identitätsfindung unterstützt wird oder nicht (Ammon 1970)."
"Die Erfolge der Anti-Drogen-Erziehung sind keineswegs positiver als die der sogenannten 'Aufklärung' in den Massenmedien. Die ausgedehntesten Erfahrungen mit entsprechenden propagandistischen Bemühungen konnte man in den Vereinigten Staaten sammeln, wo seit 1960 Millionen ausgegeben wurden, um die Jugendlichen von einer Drogenkarriere abzubringen. Dieses Geld ist nicht nur nutzlos ausgegeben worden, sondern hat möglicherweise sogar zu einem paradoxen Resultat geführt: Der Drogenmissbrauch stieg stark an, seit in einer gigantischen Werbekampagne mit Fernsehspots, Postern und Zeitungsreklame versucht wurde, den Jugendlichen einzuhämmern, sie sollten die Finger vom Rauschgift lassen (Hammond)." Was passierte in den USA, als die Regierung durch die 'Operation Intercept' den Marihuana-Handel blockierte (der meist von kleinen pushern durchgeführt wurde)? Die Zahl der jugendlichen Herointoten in New York ist sprunghaft angestiegen.
3. Behandlung der Drogenabhängigkeit
Beim Entzug von Opiaten hat sich Doxepin (Aponal) bewährt.
Auch Haloperidol (Haldol) oder Clonidin (Paracefan) werden benutzt.
Entwicklung, Verlauf und die Beendigung einer Abhängigkeit von illegalen Drogen und anderen psychoaktiven Substanzen sind als langfristiger Krankheitsprozess zu verstehen.
Dieser Prozess verläuft dann günstig, wenn alle geeigneten therapeutischen Mittel eingesetzt werden, um Anzahl und Dauer der Substanzfreien Intervalle auszuweiten. Je früher der Drogenkonsum beginnt, desto schwerwiegender sind die Folgen und desto schwieriger wird die langfristige Abstinenz erreicht.
Die internationalen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-III-R geben diagnostische Leitlinien.
Ein wichtiger Aspekt des Krankheitsbildes bei Drogenabhängigen, ist das starke, gelegentlich übermächtige Verlangen zur Drogeneinnahme, auch unter riskanten Bedingungen.
Dieser Umstand kann die Motivation, eine Behandlung zu beginnen, planmäßig zu beenden und langfristig abstinent zu bleiben, entscheidend beeinflussen.
In der Regel kommt ein Abhängiger nicht aus „innerer Überzeugung“, sondern wenn die negativen Konsequenzen die positiven Wirkungen übertreffen. Körperliches Leiden, emotionale Belastung, sozialer Druck, Brutalität in der Drogenszene und rechtliche Folgen sind Auslöser für Überlegungen eine Therapie aufzunehmen.
Da diese Zwänge langfristig nicht konstant sind, kann auch die anfängliche Motivation zur Behandlung unbeständig sein.
Eine derartige Ambivalenz ist zentrales Merkmal des Konsumverhaltens.
3.1. Erfassung psychopathologischer Symptome bei Heroinabhängigen
- Bewusstseinsstörungen: Man unterscheidet zwischen qualitativen (z.B. Bewusstseinsverschiebung) und quantitativer (z.B. Koma) Veränderung des Bewusstseins.
- Orientierungsstörung: Man unterscheidet zwischen örtlicher, situativer, zeitlicher und persönlicher Desorientierung.
- Störungen der Aufmerksamkeit, Konzentration und der Auffassung: Test: Monatsnamen rückwärts aufsagen lassen
- Störungen von Merkfähigkeit und Gedächtnis
- Formale Denkstörungen: Häufig drogenbezogenes, eingeschränktes Sprechrepertoire z.B. Gebrauch von Neologismen (Wortneubildungen) und Danebenreden.
- Inhaltliche Denkstörungen: wahnhaftes Denken und halluzinatorische Symptomatiken liegen vor.
- Störung der Affektivität: Patient kann z.B. unter Depressionen oder innerer Unruhe leiden.
- Störungen des Antriebs und der Psychomotorik: Missverhältnis zwischen Ausdruck und Gefühlslage (Paramimik) kann bestehen.
- Suizidalität
3.2. Therapeutisches Angebot
Es stehen derzeit über 1200 ambulante und etwa 140 stationäre Einrichtungen mit über 4000 Betten zur Verfügung.
Pro Jahr werden etwa 30 000 oder etwa 30-40 % der geschätzten 100 000 bis 120 000 Drogenabhängigen in irgendeiner Form therapeutisch erreicht.
In den einzelnen Bundesländern gibt es regionale Unterschiede.
Es sind mehr Übergangseinrichtungen und therapeutisch orientierte Arbeitsplätze notwendig.
Regional unterschiedlich und zum Teil unzureichend sind die Möglichkeiten zur Entgiftung.
Ziel ist es zum einen durch sofortige Maßnahme das Gesundheitsrisiko des Abhängigen zu reduzieren, und zum anderen, ihn langfristig in einen therapeutischen Prozess einzubinden mit dem Ziel der Abstinenz.
3.3. Ambulante Therapieeinrichtungen
Aufgabe der Beratungsstellen ist die Nachsorge mit dem Ziel der Wiedereingliederung in das alltägliche Leben und der Vermeidung von Rückfällen.
In den letzten Jahren sind neue Aufgaben hinzugekommen:
Niederschwellige Angebote und ambulante Behandlung.
- Niederschwellige Angebote für Drogenabhängige, die zu einem Entzug nicht bereit sind, zur Vermeidung einer HIV Infektion und Betreuung HIV Infizierter.
- Ambulante Entwöhnungsbehandlung als Alternative zur „klassischen“ stationären Behandlung, z.B. für Personen mit kurzer Abhängigkeitsdauer, die stationäre Behandlungen nicht akzeptieren oder langjährige Drogenabhängige, die keine wollen.
In ambulanten Therapieeinrichtungen gibt es Krisenintervention, Übernachtungsmöglichkeiten und tägliche Kontakte...
3.4. Stationäre Therapieeinrichtungen
Entgiftung: Der körperliche Entzug sollte stationär erfolgen, HIV und Rückfallpräventionen nach Möglichkeit mit einer ambulanten Einrichtung.
Stationäre Behandlung dauert zwischen 3-12 Monaten (80 % Rückfallquote.) Nachsorge und ambulante Weiterbehandlung: Wohngruppen, Wohnheim
Zwei Phasen: Entgiftung (Detoxikation) und Entwöhnung
Entgiftung ist der physische Entzug, wird meist abrupt und stationär durchgeführt.
Entwöhnung ist der psychische Entzug, Ursachen der Abhängigkeit sollen aufgedeckt und bearbeitet werden. Nachreifung der Persönlichkeit, Verantwortungsübernahme, Selbstbehauptung und psychosoziale Anpassung an die Realität.
Entwöhnung sollte gleich nach Entgiftung kommen. Dauer zwischen 6 Wochen und 9 Monaten.
Körperliche Entzugszeichen treten nur bei Suchtmitteln mit Toleranzausbildung auf (Heroin, Opiate, Alk...). Im Vordergrund stehen überschießende Reaktionen des vegetativen Nervensystems (z.B. Unruhe, Schweißausbrüche, Gereiztheit, Frieren, Erbrechen...)
Seelische Entzugserscheinungen sind „Stoffhunger“ (Drang zur erneuten Einnahme) Es sind vor allem die seelischen Entzugserscheinungen, die zum Konsum treiben.
Dr. Ropp (1964) schildert eine solche Prozedur:
Etwa zwölf Stunden nach der letzten Dosis Morphium oder Heroin beginnt der Süchtige, unruhig zu werden. Ein Schwächegefühl überkommt ihn, er gähnt, erschaudert und schwitzt gleichzeitig, während ihm eine wässrige Flüssigkeit aus den Augen und durch die Nase rinnt, was ihm vorkommt, als 'liefe heißes Wasser' in den Mund empor. Für ein paar Stunden fällt er, sich ruhelos wälzend, in einen abnormen Schlaf, den die Süchtigen als 'Gierschlaf' bezeichnen. Beim Erwachen, 18 bis 24 Stunden nach Einnehmen der letzten Dosis, betritt er die tieferen Regionen seiner 'persönlichen Hölle'. Das Gähnen kann so heftig werden, dass er sich die Keifer verrenkt. Aus der Nase fließt ein dünner Schleim, die Augen tränen stark. Die Pupillen sind sehr erweitert, die Haare auf der Brust sträuben sich, die Haut selbst ist kalt. Sie wird zu einer extremen Gänsehaut, welche die Süchtigen Nordamerikas treffend als cold turkey (wörtlich kalter Truthahn - wegen der eigenartigen Oberfläche des Kammes dieser Tiere) bezeichnen; der Jargon-Ausdruck wird auch für die Entzeihung selbst gebraucht, wenn man sie abrupt und nicht durch allmähliche Reduzierung der Dosis durchgeführt wird.
Der Zustand des Kranken verschlimmert sich zusehends, denn seine Därme beginnen mit unerhörter Gewalt zu arbeiten. Die Magenwände zeihen sich ruckweise stark zusammen, und verursachen explosives Erbrechen, wobei oft auch Blut mit austritt. So gewaltig sind die Kontraktionen der Eingeweide, dass der Leib außen ganz geriffelt und knotig aussieht, als seien unter der Haut Schlangen in einen Kampf verwickelt. Die starken Leibschmerzen steigern sich rapid. Der Darm wird immerfort entleert, so dass es bis zu 60 wässrigen Stuhlgängen am Tag kommen kann.
36 Stunden nach seiner letzten Dosis ist der Süchtige völlig am Ende. In verzweifelten Versuchen, die Kälteschauer, die seinen Körper quälen, zu mildern, legt er sich sämtliche Decken über, die er finden kann. Der ganze Körper wird von Zuckungen geschüttelt, und seine Füße machen unfreiwillig tretende Bewegungen, für die die Süchtigen den makaberen, aber höchst anschaulichen Ausdruck kicking the habit (wörtlich: "Die Gewohnheit wegtreten") geprägt haben.
An Schlaf oder Ruhe ist während der Entziehung nicht zu denken. Schmerzhafte Krämpfe der gesamten Körpermuskulatur werfen den Sterbenskranken unaufhörlich umher. Nicht selten fängt er entsetzlich zu brüllen an. Am Ende dieses Stadiums passiert es nicht selten, dass er sich in seinem eigenen Erbrochenen und seinen eigenen Exkrementen wälzt und völlig vertiert wirkt.
... Es darf deshalb nicht verwundern, wenn selbst erfahrene Ärzte (geschweige denn befreundete Helfer) gelegentlich schwach werden, weil sie - nicht zu Unrecht - um das Leben ihres Patienten fürchten. Schon die kleinste Dosis Morphium oder Heroin schaltet die die scheußlichen Symptome aus. Es ist ein dramatisches Erlebnis zu beobachten, wie ein jammervoller, elender Mensch, sobald ihm etwas Morphin intravenös eingespritzt wurde, eine halbe Stunde später rasiert, sauber, lachend und scherzend vor einem steht.
Heutzutage wendet man diese radikale Kur - zumindest in Deutschland - kaum noch an. Vor allem wenn hohe Dosen gespritzt wurden, baut man die Dosis behutsam ab. Bleiben die Helfer standhaft, so klingen die Symptome nach einer Woche von alleine ab. Die Angst vor einer offiziellen Entziehung an einer normalen Klinik lohnt sich nicht - es ist weniger schrecklich, diese Prozedur in einer Klinik und von Fachkräften betreut (die vor allem nicht im entscheidenden Stadium schwach werden) über sich ergehen zu lassen. Allerdings sind, vor allem bei älteren Süchtigen, die Heilerfolge auch unter günstigen Voraussetzungen zur Zeit noch minimal. Nach Angaben der Berliner Psychotherapeutin Lilian Barth ist "die Erfolgsziffer gleich Null".
Man schätzt, dass 1997 rund 20.000 Opiatabhängige Methadon als Ersatzdroge nehmen und 30.000 als Substitut Kodein, das sich inzwischen ebenfalls etablieren konnte). Zwar befreit das Methadon nicht von der Sucht, aber der Rausch und der Katzenjammer werden wesentlich abgeschwächt. Somit können die Abhängigen beispielsweise einer geregelten Arbeit nachkommen und damit versuchen in das normale soziale Niveau zurückzustoßen.
3.5. Therapieergebnisse
Wichtig und prognostisch günstig ist die zeitliche Verlängerung substanzfreier Intervalle
Entgegen weitverbreiteter Meinung, dass nahezu alle Drogenabhängigen langfristig erfolglos behandelt werden, zeigen Katamnesestudien über etwa vier Jahre, dass etwa 20 - 30 % der Behandelten keine harten Drogen mehr nehmen.
Die Erfahrung zeigt, dass eine sehr kurze stationäre Behandlungszeit ein gleich hohes Risiko des Rückfalls wie ein Therapieabbruch aufweist.
Es existieren Behandlungskonzepte auf biologischen (Pharmakotherapie) und nicht biologischen (psychologisch, sozial) Ebenen..
Sie sind keine Konkurrenz, sondern ergänzen sich.
Nicht biologische Verfahren:
- Therapiegemeinschaften (z.B. Synanon)
- Sozialarbeit
- Selbsthilfegruppen
- Auch Justizstrafen
- Ziel ist die Abstinenzfähigkeit, sowie die medizinische, soziale und berufliche Rehabilitation.
- Der Erstkontakt erfolgt oft in sozialarbeiterischer Krisenintervention (Krisenhilfe, Streetworker)
- Von hier wird oft der Königsweg eingeleitet (Abstinenztherapie): stationäre Entgiftung, psychotherapeutische stationäre Entwöhnungstherapie (Langzeittherapie) und Nachsorge (Selbsthilfegruppen)
- Langfristig bleiben 10 - 50 % der Patienten abstinent.
Dole und Nyswander entwickelten in den 60er Jahren das Konzept der Substitutionsbehandlung:
Durch die Verordnung eines Opiates (in Deutschland Methadon) sollen Entzugssymptome , Craving und süchtiges Verhalten verhindert werden, um den Abhängigen die Möglichkeit der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation zu geben, als Basis für ein späteres abstinentes Leben.
Zur pharmakologischen Rückfallprophylaxe kann zum Ende einer erfolgreichen Abstinenzbehandlung der Opiatantagonist Naltrexon eingesetzt werden (hat sich aber nur bei bestimmten Gruppen, hochmotivierte höhere Berufsgruppen bewährt.)
4. Methadon
Methadon ist eine morphinähnliche Substanz und wirkt stark narkotisierend und schmerzlindernd.
Methadon ist von steigender Bedeutung in der Substitutionstherapie heroinabhängiger Patienten.
Es hat darüber hinaus ein hohes Mißbrauchpotential, da es morphinähnliche Drogenabhängigkeit hervorruft.
In der Deutschland wird l-Polamidon als therapeutische Ersatzdroge eingesetzt.
Methadon besitzt eine Morphin-Teilstruktur, d.h. wesentliche funktionelle Merkmale der Opiate sind in dieser Verbindung vereinigt.
Es ist ein starkes Analgetikum, welches auch oral verabreicht wird.
Es ist vier mal stärker als Morphin und wirkt doppelt so lange (20 h).
In Deutschland ist Levomethadon (linksdrehend, 30 mal stärker als rechtsdrehend) neben der Injektionslösung als Polamidon - Tropfen im Verkehr.
Methadon mit z.B. Rohypnol (Flunitrazepam) wird wie Heroin empfunden.
Nebenwirkungen: starkes Schwitzen, Übelkeit, Benommenheit, Mundtrockenheit... Vorteile: orale Verabreichung, Verhinderung der Entzugserscheinungen, kontrollierte Abgabe
Nachteile: Methadon ist auch ein Suchtstoff, es verhindert nicht den Drogenhunger (psychische Abhängigkeit) auf andere Substanzen, Methadonentzug ist schwieriger als Heroin (sedative Therapie mittels Neuroleptika)
4.1. Zielsetzung
Wiederherstellung bzw. Verbesserung der körperlichen und psychischen Gesundheit durch:
- Soziale Wiedereingliederung
- Erreichung der Drogenabstinenz (als Maximalziel anstreben) Schutz vor übertragbaren Krankheiten (z.B. HIV, Hepatitis)
4.2. Indikation
Die Indikation wird vom behandelnden Arzt mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung oder von einer Beratungsstelle in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt gestellt.
Vor jeder Indikationsstellung haben eine umfassende, differenzierte Anamnese sowie eine körperliche und psychosoziale Abklärung zu erfolgen. Es wird empfohlen, die Indikationsstellung nicht auf ein einziges Gespräch abzustellen.
Bei der Indikation müssen u.a. folgende Kriterien berücksichtigt werden:
- Gesicherte Opiatabhängigkeit
- Behandlungswunsch des Patienten (es besteht kein 'Recht auf Methadon')
- Die stationäre Therapie ist für den Patienten vorläufig keine erfolgversprechende Alternative oder aus Praktikabilitätsgründen nicht durchführbar (aber: die Abstinenz ist primär immer anzustreben)
- Kontraindikation
- Schwere Polytoxikomanie (gleichzeitig bestehende, ebenbürtige Abhängigkeit von anderen Suchtmitteln, z.B. Alkohol, Kokain, Barbiturate, Benzodiazepine, usw.)
- Floride Lebererkrankung mit deutlich eingeschränkter Leberfunktion
4.3. Behandlungsrichtlinien
Unter der Methadon-Behandlung ist die strukturierte, systematisch geplante und durchgeführte Behandlung eines Opiatabhängigen zu verstehen, wobei das Medikament Methadon nur ein Element innerhalb eines umfassenden Behandlungsangebotes darstellt.
Im Rahmen dieser Behandlung sind folgende Richtlinien zu beachten:
- Regelmässiger, persönlicher Kontakt mit dem Betreuer, anfänglich wöchentlich, später mindestens alle 4 Wochen
- Umfassende Gespräche, kleine Psychotherapie, psychosoziale Betreuung
- Bereitschaft des Arztes für eine langfristige Betreuung
- Methadon-Vertrag: es wird empfohlen, einen schriftlichen "Vertrag" zwischen Patient, Arzt und Behandlungsstelle abzuschließen. Dieser regelt die Frequenz der Behandlungstermine, Ort und Zeit der Methadon-Abgabe, die Sanktionen usw.
- Methadon-Abgabe:
Die Methadon-Einnahme erfolgt kontrolliert in einer Apotheke oder in der Arztpraxis in Form einer nichtinjizierbaren Trinklösung (z.B. aufgelöst in Orangensaft, ungeeignet ist Sirup!).
- Die Mitgabe des Methadons nach Hause ist nicht erlaubt, mit Ausnahme der Sonn -und Feiertage (Mitgabe der nichtinjizierbaren Trinklösung). Änderungen dieses Abgabemodus sind nach Rücksprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst unter gewissen Voraussetzungen möglich (frühestens nach 3 Monaten, guter Behandlungsverlauf, ausgewiesene berufliche Notwendigkeit). Der Apotheker richtet sich nach der Rezeptur (Betäubungsmittelrezept) und meldet der betreuenden Stelle Unregelmäßigkeiten.
4.4. Dosierung
- Initialdosis: 30 - max. 50 mg täglich
- Erhaltungsdosis ist nach ca.14Tagen erreicht und beträgt 40 - max. 100 mg täglich (subjektives Wohlbefinden, keine Entzugserscheinungen, normaler Schlafrhythmus)
- Dosisreduktion (nach vollständiger körperlicher, seelischer und sozialer Stabilisierung, meist nicht vor 1 - 2 Jahren) individuell.
- Urinproben
Es sollen regelmäßige, unangekündigte Urinproben auf Opiate, Kokain, Cannabis, Benzodiazepine, Amphetamine, Barbiturate durchgeführt werden, auch nach erfolgter Stabilisierung des Patienten (mindestens 3-monatlich). Urinproben können beim Hausarzt, in der Apotheke oder auf der Beratungsstelle durchgeführt werden.
4.5. Abbruch der Methadon-Behandlung
Bei wiederholter Verletzung des Behandlungsplanes entsprechend diesen Richtlinien bzw. wenn bei der Gesamtheurteilung der Situation keine positive Tendenz erkennbar ist, soll die Methadon-Behandlung ausgeschlichen und gestoppt werden.
4.6. Ferien und Methadon
Bei Ferien innerhalb einer Methadon-Behandlung sind gewisse Bedingungen zu beachten:
- guter Verlauf der Methadon-Behandlung
- Abgabemodus am Ferienort frühzeitig organisieren (Arzt Apotheke, Beratungsstelle)
- Bei Ferien im Ausland gesetzliche Regelungen beachten und Kontaktnahme mit der diplomatischen Vertretung des Reiselandes.
4.7. Grundsätze der Substitution
Sie ist ein Zwischenziel zur sozialen Stabilisierung, zur Verbesserung des Gesundheitszustandes und zur Entkriminalisierung.
Alleine stellt sie keine Behandlung der Drogenabhängigkeit dar.
Die sog. Harm reduction (Verabreichung von Ersatzdrogen), stellt keine therapeutische Maßnahme dar.
5. Schlussteil
Drogensucht ist eine erworbene psychische Erkrankung, das Verlangen nach der Droge wird zur zentralen Motivation des Verhaltens.
Süchtiges Verhalten ist auch nach längerer Abstinenz nicht vollständig reversibel, da es zu Veränderungen in spezifischen neuronalen Strukturen gekommen ist. Daher gibt es die Definition von „Point of no return“.
Aber es gibt auch Süchtige, die es schaffen ein drogenfreies Leben zu führen.
Zwei Substanzen, die bereits therapeutisch eingesetzt werden, sind Naltrexon (ein Opiatrezeptorantagonist) und Acamprosat (ein Homotaurinderivat).
Alle Substanzen mit Abhängigkeitspotential aktivieren das mesolimbische dopaminerge „reward“ System.
Von Komorbidität wird dann gesprochen, wenn ein Patient mehr als eine Krankheit oder Störung aufweist.
Sucht sollte als ein biographischer Teilprozess gesehen werden.
Manche Menschen entwickeln sich ohne Therapie wieder aus der Sucht heraus .
Das Problem liegt nicht in der psychodynamischen Störung, sondern im süchtigen Verhalten selbst.
Also Schlüsselreize , Kognitionen und Erwartungen, die die Drogeneinnahme erneut hervorrufen.
Bei der Behandlung von Drogenabhängigen stellt der Therapieabbruch ein erhebliches Problem dar.
Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der Gründe für Abbruchgedanken sagen, dass die Bereiche Depression, Zweifel am Sinn der Therapie sowie Partnerschaftsbeziehungen am wichtigsten sind.
Auf diese sollten in der Therapie besonders geachtet werden.
Es spielen also meist mehrere Gründe eine Rolle, wenn der Patient trotz Abbruchgedanken in der Therapie bleibt.
Hoffnung auf eine positive Zukunftsperspektive unterstützt vom Therapeuten und Mitklienten.
6. Literaturverzeichnis
- DHS. „Drogenabhängigkeit - Eine Information für Ärzte“, Köln 1999
- Jürgen Straub, Wilhelm Kempf, Hans Werbik. “Psychologie - eine Einführung“, DTV, München 1998
- K. Mann, G. Bruchkremer. „Sucht-Grundlagen-Diagnostik-Therapie“, Gustav Fischer Verlag, Ulm 1998
- Marcus Gastpar, Karl Mann, Hans Rommelspacher. „Lehrbuch der Suchterkrankungen“, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1999
Häufig gestellte Fragen
Was ist Heroin und wie wirkt es?
Heroin ist ein Rauschgift, das schnell zu schwerer Abhängigkeit führt. Es wirkt direkt auf das Gehirn, unterdrückt die Schmerzempfindung und hemmt das Atemzentrum. Es kann passiv und antriebslos machen und zwischenmenschliche Beziehungen beeinträchtigen.
Welche Risiken sind mit Heroinkonsum verbunden?
Heroin verursacht eine starke körperliche und seelische Abhängigkeit, kann zum Tod durch Überdosierung führen, das Erbgut schädigen, die körpereigenen Abwehrkräfte schwächen und bei schwangeren Frauen zu Frühgeburten führen. Weiterhin besteht die Gefahr von Infektionen, Leberschäden, Magen-Darm-Störungen, Beschaffungskriminalität und Persönlichkeitsabbau.
Welche Maßnahmen können gegen Heroinabhängigkeit ergriffen werden?
Vorbeugung durch Aufklärung, insbesondere im persönlichen Gespräch in kleinen Gruppen, ist wichtig. Familäre Faktoren, die Einstellung zur Erziehung, das 'Urvertrauen' sowie die Akzeptanz und Unterstützung bei der Identitätsfindung beeinflussen den Drogenkonsum Jugendlicher. Bei akuter Abhängigkeit stehen Entgiftung, Therapie und psychosoziale Betreuung zur Verfügung.
Welche therapeutischen Angebote gibt es für Heroinabhängige?
Es gibt ambulante und stationäre Therapieeinrichtungen. Ambulante Einrichtungen bieten Beratung, Nachsorge und niederschwellige Angebote. Stationäre Einrichtungen bieten Entgiftung und Entwöhnung. Das Ziel ist, das Gesundheitsrisiko zu reduzieren und langfristig Abstinenz zu erreichen.
Was ist Methadon und wozu dient es?
Methadon ist eine morphinähnliche Substanz, die in der Substitutionstherapie heroinabhängiger Patienten eingesetzt wird. Es wirkt narkotisierend und schmerzlindernd und soll Entzugserscheinungen, Craving und süchtiges Verhalten verhindern.
Welche Ziele werden mit der Methadon-Behandlung verfolgt?
Wiederherstellung bzw. Verbesserung der körperlichen und psychischen Gesundheit, soziale Wiedereingliederung und Erreichung der Drogenabstinenz (als Maximalziel anstreben). Schutz vor übertragbaren Krankheiten (z.B. HIV, Hepatitis).
Welche Grundsätze gelten bei der Substitutionstherapie mit Methadon?
Die Substitution ist ein Zwischenziel zur sozialen Stabilisierung, zur Verbesserung des Gesundheitszustandes und zur Entkriminalisierung. Sie stellt alleine keine Behandlung der Drogenabhängigkeit dar.
Was sind die Inhalte einer Entgiftung?
Die Entgiftung ist der physische Entzug, wird meist abrupt und stationär durchgeführt. Körperliche Entzugszeichen treten nur bei Suchtmitteln mit Toleranzausbildung auf (Heroin, Opiate, Alk...). Im Vordergrund stehen überschießende Reaktionen des vegetativen Nervensystems (z.B. Unruhe, Schweißausbrüche, Gereiztheit, Frieren, Erbrechen...).
Was ist die Entwöhnung?
Die Entwöhnung ist der psychische Entzug, Ursachen der Abhängigkeit sollen aufgedeckt und bearbeitet werden. Nachreifung der Persönlichkeit, Verantwortungsübernahme, Selbstbehauptung und psychosoziale Anpassung an die Realität.
Welche Ergebnisse werden in der Drogenabhängigkeitstherapie erzielt?
Entgegen weitverbreiteter Meinung zeigen Katamnesestudien, dass etwa 20 - 30 % der Behandelten keine harten Drogen mehr nehmen. Wichtig und prognostisch günstig ist die zeitliche Verlängerung substanzfreier Intervalle.
- Quote paper
- Anke Müller (Author), 2001, Heroin / Opiate, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100788