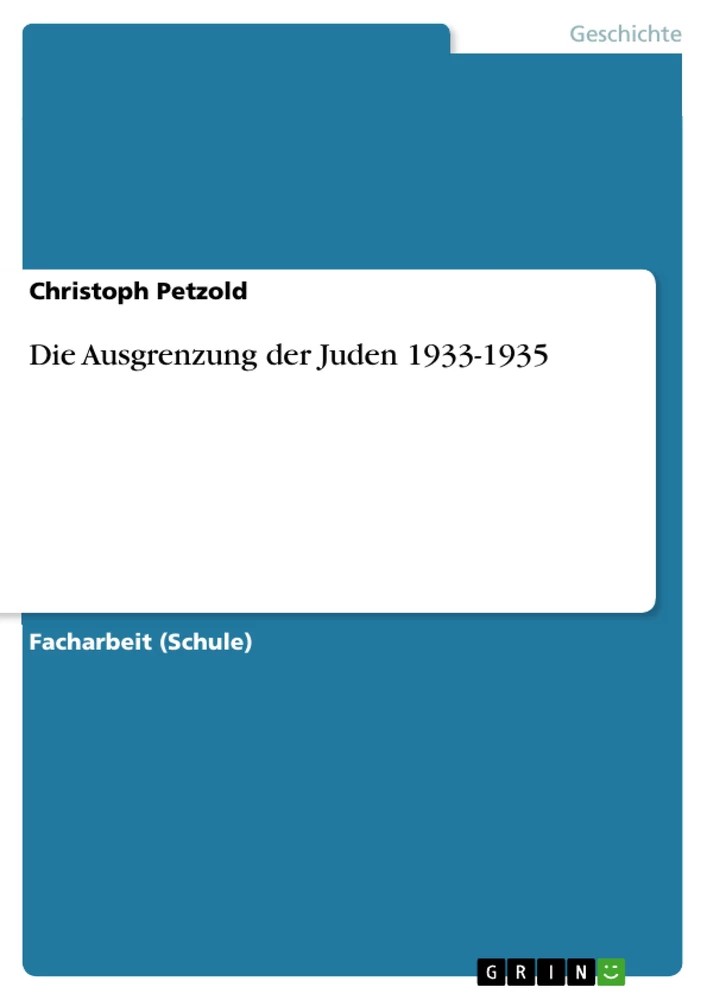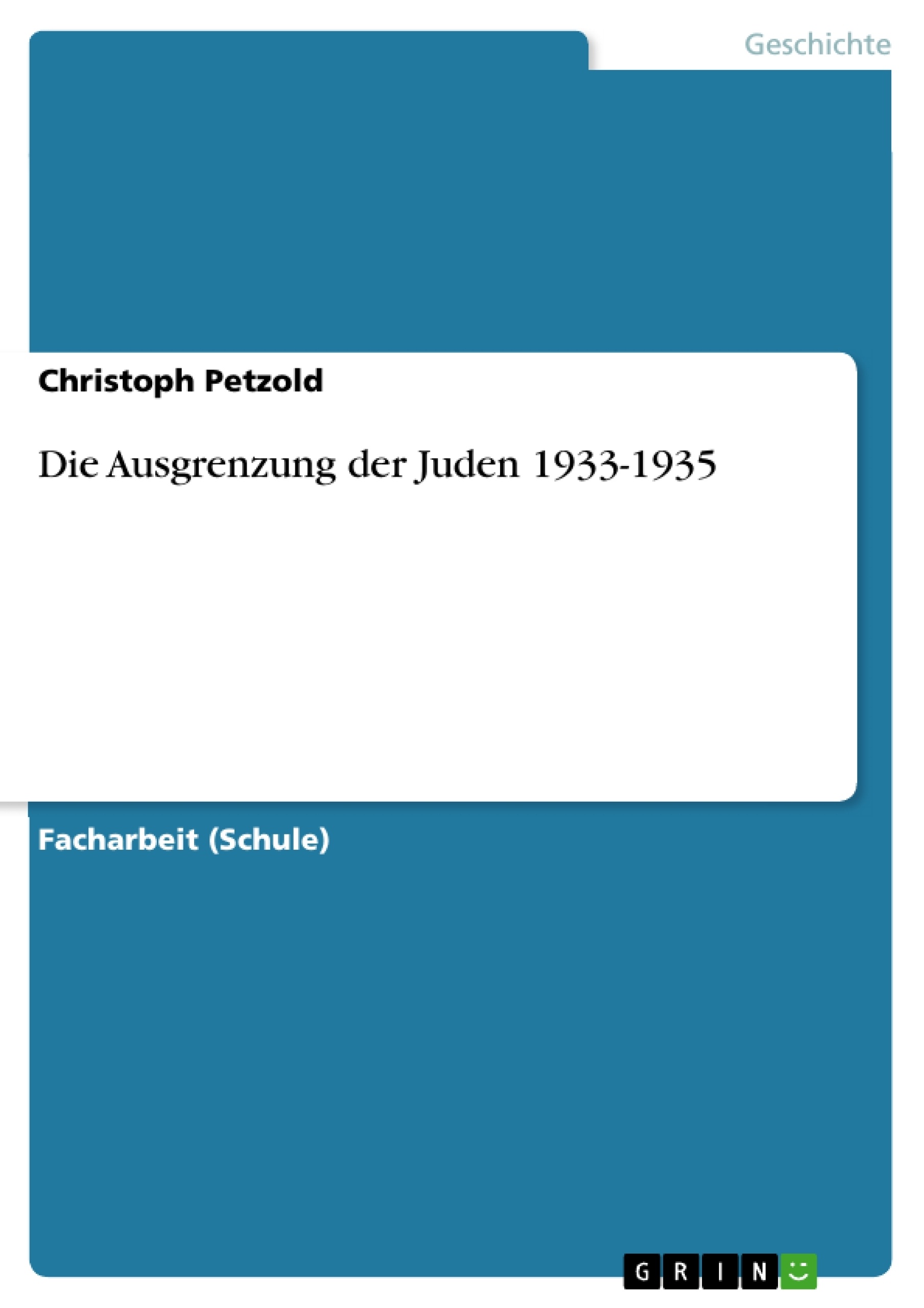Wie konnte es geschehen, dass eine zivilisierte Nation sich derartiger Grausamkeiten schuldig machte? Diese Frage hallt wider in dieser eindringlichen Analyse der frühen Phase der Judenverfolgung im nationalsozialistischen Deutschland. Beginnend mit der Machtergreifung Hitlers im Jahr 1933, zeichnet diese Arbeit ein beklemmendes Bild des systematischen Prozesses der Ausgrenzung, Entrechtung und Demütigung der jüdischen Bevölkerung. Der Leser wird Zeuge, wie die Nationalsozialisten, angetrieben von einer Ideologie des Rassenwahns und des Antisemitismus, Schritt für Schritt die Grundlagen für die spätere Vernichtung legten. Von dem propagandistischen Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 bis zu den verhängnisvollen Nürnberger Rassengesetzen von 1935, die Juden zu Bürgern zweiter Klasse degradierten, werden die einzelnen Maßnahmen der Diskriminierung detailliert beleuchtet. Dabei wird nicht nur die politische und rechtliche Dimension der Verfolgung untersucht, sondern auch die Auswirkungen auf das persönliche Leben der Betroffenen. Es wird der Frage nachgegangen, wie eine Gesellschaft, die sich auf Humanismus und Aufklärung berief, derart blind für das Leid ihrer Mitbürger werden konnte. Die Arbeit analysiert die Wurzeln des Antisemitismus in Deutschland und Europa, von religiös motiviertem Judenhass im Mittelalter bis zum modernen Rassenantisemitismus des 19. Jahrhunderts. Sie zeigt auf, wie diese tief verwurzelten Vorurteile von den Nationalsozialisten instrumentalisiert wurden, um ihre Macht zu festigen und ihre menschenverachtende Ideologie zu verbreiten. Ein tief bewegendes und erschreckend aufschlussreiches Werk über die Anfänge eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, das die Mechanismen von Ausgrenzung und Hass offenlegt und zur Auseinandersetzung mit den Ursachen von Antisemitismus und Rassismus auffordert. Eine kritische Auseinandersetzung mit den historischen Ereignissen rund um die Judenverfolgung, Rassenideologie, NS-Regime, Diskriminierung, Entrechtung, Antisemitismus, Nürnberger Gesetze und Deutschland 1933-1935.
Inhaltsverzeichnis
2. Einleitung
3. Vorgeschichte
3.1. Antisemitismus und Judenverfolgung
3.2. Der Antisemitismus in Deutschland
4. 1933-1935 – Maßnahmen der Ausgrenzung
4.1. 1. April 1933 – Boykott der jüdischen Geschäfte
4.2. 7. April 1933 – Verdrängung der Juden aus dem Beamtentum
4.3. 21. Mai 1935 – Ausschluss der Juden aus der Armee
4.4. Ausschaltung der Juden aus Kultur und Wissenschaft
4.5. Durchführungsverordnungen
4.6. Wer ist „Jude“
4.7. Ein persönliches Beispiel
5. September 1935 – Die Nürnberger Rassengesetze
5.1. Wie es zu den Gesetzen kam
5.2. „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der dt. Ehre“
5.3. „Reichsbürgergesetz“
6. Schlussbetrachtung
6.1. Der Vernichtungsprozess .
6.2. Die Bedeutung des Antisemitismus für den Nationalsozialismus
6.3. Persönliche Stellungnahme .
7. Quellen- und Literaturverzeichnis
Anhang
Erklärung zur Facharbeit
2. Einleitung
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 hat sich die Lage für die etwa 540.000 Juden1Deutschlands und, wie sich spä- ter herausstellen wird, auch für alle weiteren Juden Europas dramatisch verän- dert. Zwar ist Adolf Hitler bisher „nur“ Reichskanzler einer konservativen Re- gierung, aber in den folgenden Wochen und Monaten gelingt es ihm und seiner Partei, der NSDAP, die Macht zu behaupten und ihre Gegner auszuschalten.
Zum ersten Mal in der Geschichte ist es einer Partei, deren Programm Antise- mitismus, Antiliberalismus und Antimarxismus beinhaltet, gelungen, die Macht in einem modernen demokratischen Staat zu übernehmen.
In der folgenden Facharbeit soll nun untersucht werden, wie sich die einzelnen gegen die Juden gerichteten Maßnahmen ausgewirkt haben. Behan- delt werden soll dabei die erste Phase der Judenverfolgung von Februar 1933 bis November 1935, die hauptsächlich von diskriminierenden und ausgrenzen- den Maßnahmen gekennzeichnet war. Dieses Thema ist von daher besonders interessant, da der Leser im allgemeinen über diesen Zeitraum noch nicht so gut informiert ist wie über die spätere Phase der „Endlösung“ und Vernichtung.
Des weiteren soll auch auf die Geschichte des Antisemitismus im All- gemeinen, sowie auf die Bedeutung desselben für die nationalsozialistische Ideologie eingegangen werden.
Stützen werde ich meine Untersuchung dabei vor allem auf die Ausar- beitungen von Historikern, aber auch auf zeitgenössische Quellen die wie zum Beispiel die Texte der Nürnberger Rassengesetze von 1935.
3. Vorgeschichte
3.1. Antisemitismus und Judenverfolgung
3.1.1. Der historische Judenhass
Seit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels und der folgenden Zerstreuung der Juden über die ganze Welt (Diasporah) ist es immer wieder zu Progromen, Diskriminierungen und Verfolgungen der Juden gekommen; wohin auch immer sich der Jude flüchtete, oder wie sehr er versuchte sich anzupassen, immer wieder wurde er gedemütigt und verfolgt.
„Vielleicht könnten wir überall in den uns umgebenden Völkern aufgehen, wenn man uns nur zwei Generationen hindurch in Ruhe ließe. Man wird uns nicht in Ruhe lassen. Nach kurzen Perioden der Duldsamkeit erwacht immer und immer wieder die alte Feindschaft gegen uns.“ 2
Seit jeher wurden Minderheiten – wie die Juden in Europa – verant- wortlich gemacht für die verschiedenen Missstände und Probleme innerhalb der Gesellschaft. Die Kirche schürte diesen Hass noch, indem sie die Juden als
„Christusmörder“ verunglimpfte, ohne dabei zu bedenken, dass die Wurzeln des Christentums im Judentum liegen, da Jesus selbst Jude war.
„…Nemlich, das sie dürstige blut Hunde und Mörder sind der gantzen Christenheit…“ 3
Hinzu kam noch, dass die Juden häufig in Handel und Geldgeschäften tätig waren und auch sonst häufig überdurchschnittlich begabt waren, was den Neid der nichtjüdischen Bevölkerungsmehrheit noch vergrößerte. Die Juden- verfolgung vor allem im Mittelalter geschah also aus religiösen und wirtschaft- lichen Motiven und aus der Suche nach einem Sündenbock heraus.
Die Tatsache, dass der Antisemitismus tief in der deutschen und euro- päischen Geschichte verwurzelt war, kann natürlich nicht als Entschuldigung angeführt werden. Es soll nur deutlich gemacht werden, dass nicht Hitler der Erfinder des Judenhasses ist.
3.1.2. Der Rassenantisemitismus
Ganz anders hingegen verhält es sich mit dem modernen Antisemitis- mus des 19. und 20. Jahrhunderts. Nicht nur von Hitler und der NSDAP, son- dern von vielen Politikern und Wissenschaftlern wurde die von Charles Darwin 1859 veröffentliche Evolutionstheorie nicht nur als Tatsache akzeptiert, son- dern auch noch auf das Zusammenleben der Menschen übertragen.
Die Anhänger dieser Lehre (des Sozialdarwinismus) sahen die eigene Rasse (bzw. das eigene Volk) als den anderen überlegen an, und wähnten sich damit im Recht, gemäß den Prinzipien von „Natürlicher Auslese“ und dem
„Überleben der Stärksten“, die anderen, in ihren Augen „minderwertigen“ Menschen, zu unterdrücken und auszubeuten.
3.2. Der Antisemitismus in Deutschland
Dass der Rassenantisemitismus in Deutschland im Gegensatz zu Frank- reich oder England so bereitwillig akzeptiert wurde, hat folgende Ursachen:
Der Liberalismus, die Grundbedingung für die Emanzipation der Juden, war in Deutschland längst nicht so tief verwurzelt wie in Frankreich, dem Land der französischen Revolution.
Vielmehr wurden „Liberalismus, Parlamentarismus und Demokratie als undeutsch“ 4und von der französischen Besatzungsmacht aufgezwungen empfunden und später über 100 Jahre lang von der Staatsgewalt bekämpft. Aus diesem Grund wandelte sich die deutsche Nationalbewegung im 19. Jahrhun- dert; aus dem Verlangen nach einem Nationalstaat, in dem Einheit und Gleich- heit verwirklicht werden sollten wurde die Mystifizierung des Deutschtums und damit einhergehend eine Verachtung und sogar Feindschaft allem „anders- artigen“ gegenüber.
Auch aus diesen Gründen ist der Rassenantisemitismus und seine Ver- treter in Deutschland auf so offene Ohren und Herzen gestoßen.5
4. 1933-1935 —
Maßnahmen der Ausgrenzung
4.1. 1. April 1933 – Boykott der jüdischen Geschäfte
Unter dem Motto „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“ (s.a. Titelseite) initiierte das NS-Regime am 1. April 1933 als „Generalprobe für eine Reihe von Maßnahmen“ 6ein nationales Boykott jüdischer Einrichtungen. Wie man auch auf dem Photo erkennen kann, wie man auch auf dem Bild er- kennen kann, wurde dieses Boykott von der Hitlers Privatarmee, der SA, häu- fig auch gegen den Unwillen oder sogar offenen Protest der deutschen Bevöl- kerung durchgesetzt.
Da diese erste offene und große antijüdische Aktion im Ausland auf heftige Proteste stieß und wiederum zum Boykott von deutschen Waren und damit zu wirtschaftlichem Schaden für Deutschland führte, wurde längere Zeit von ähnlichen Aktionen abgesehen. Die antisemitische Politik wurde jetzt mehr über Gesetze und Verordnungen ausgeführt, die jeweils die Rechte der Juden ein wenig mehr einschränkten.
4.2. 7. April 1933 – Verdrängung der Juden aus dem Beamtentum
Mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ (siehe Anhang) wurde der Weg der Hinausdrängung der Juden aus dem wirtschaftli- chen Leben per Gesetz beschritten. Sämtliche jüdische Richter, Lehrer, Bür- germeister usw. usw. sollten durch dieses Gesetz in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. Nur dem Einwirken des Reichspräsidenten von Hindenburg ist es zu verdanken, dass, zumindest vorerst, diejenigen, die im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite gekämpft hatten, von diesem Gesetz verschont blieben.
Nachdem die „satanische Macht, die … die ganze Nation überwachte“ 7
gebrochen war, konnte man dazu übergehen, den Rest der Wirtschaft und ü- berhaupt des ganzen Landes zu „arisieren“.
[...]
1 Hummel, Karl-Joseph: „Deutsche Geschichte 1933-1945“. München (Olzog), 1998, S. 209.
2 Herzl, Theodor: „Der Judenstaat“, S. 26. Zitiert nach: Scheffler, Wolfgang: „Judenverfolgung im Dritten Reich“. Berlin (Colloquium Verlag Otto H. Hess), 1964, S. 15.
3 Luther, Dr. Martin: „Von den Juden“, S. 520. Zitiert nach: Hilberg, Raul: „Die Vernichtung der europäischen Juden – Band 1“, Frankfurt am Main (Fischer Taschenbuch), 19822, S. 22.
4 Graml, Herrmann: „Reichskristallnacht – Antisemitismus und Judenverfolgung im Dritten Reich“. München (dtv), 1988, S. 52.
5 vgl. Ebenda, S. 51ff.
6 Völkischer Beobachter, 3. April 1933. Zitiert nach: Schoenberner, Gerhard: „Der gelbe Stern– Die Judenverfolgung in Europa 1933-1945“. München (Bertelsmann), 1978, S. 17.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über die "Maßnahmen der Ausgrenzung" im Nationalsozialismus?
Dieses Dokument ist eine Facharbeit, die sich mit der frühen Phase der Judenverfolgung in Deutschland von 1933 bis 1935 befasst. Es analysiert die diskriminierenden und ausgrenzenden Maßnahmen, die von den Nationalsozialisten ergriffen wurden. Das Dokument enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Informationen zur Vorgeschichte des Antisemitismus, Details zu den Maßnahmen der Ausgrenzung (Boykott jüdischer Geschäfte, Verdrängung aus dem Beamtentum usw.), die Nürnberger Rassengesetze und eine Schlussbetrachtung.
Welche Themen werden in dieser Facharbeit behandelt?
Die Hauptthemen sind die Geschichte des Antisemitismus, die Rolle des Antisemitismus in der nationalsozialistischen Ideologie, die spezifischen Maßnahmen zur Ausgrenzung der Juden in Deutschland zwischen 1933 und 1935, und die Bedeutung der Nürnberger Rassengesetze.
Welche Maßnahmen werden im Zeitraum 1933-1935 detailliert beschrieben?
Die Facharbeit beschreibt detailliert den Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933, die Verdrängung der Juden aus dem Beamtentum durch das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom 7. April 1933, den Ausschluss der Juden aus der Armee (21. Mai 1935) sowie ihre Ausschaltung aus Kultur und Wissenschaft. Es geht auch auf die Durchführungsverordnungen und die Definition von "Jude" ein.
Was sind die Nürnberger Rassengesetze und welche Bedeutung hatten sie?
Die Nürnberger Rassengesetze, insbesondere das "Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre" und das "Reichsbürgergesetz", werden detailliert betrachtet. Die Facharbeit untersucht, wie diese Gesetze entstanden sind und welche Auswirkungen sie auf die jüdische Bevölkerung hatten.
Was wird in der Schlussbetrachtung behandelt?
Die Schlussbetrachtung befasst sich mit dem Vernichtungsprozess, der Bedeutung des Antisemitismus für den Nationalsozialismus und enthält eine persönliche Stellungnahme.
Welche Quellen und Literatur werden für die Facharbeit verwendet?
Die Untersuchung stützt sich auf Ausarbeitungen von Historikern und zeitgenössische Quellen, darunter die Texte der Nürnberger Rassengesetze von 1935.
Was wird über die Vorgeschichte des Antisemitismus gesagt?
Die Facharbeit behandelt den historischen Judenhass seit der Zerstörung Jerusalems und der Zerstreuung der Juden (Diaspora). Es wird der religiöse und wirtschaftliche Antisemitismus im Mittelalter erwähnt und der Unterschied zum modernen Rassenantisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts erläutert. Der Einfluss des Sozialdarwinismus wird ebenfalls angesprochen.
Warum wurde der Antisemitismus in Deutschland so bereitwillig akzeptiert?
Die Facharbeit argumentiert, dass der Antisemitismus in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern leichter akzeptiert wurde, weil der Liberalismus, die Grundbedingung für die Emanzipation der Juden, in Deutschland nicht so tief verwurzelt war. Zudem wurde Liberalismus, Parlamentarismus und Demokratie als "undeutsch" empfunden.
- Quote paper
- Christoph Petzold (Author), 2000, Die Ausgrenzung der Juden 1933-1935, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100770