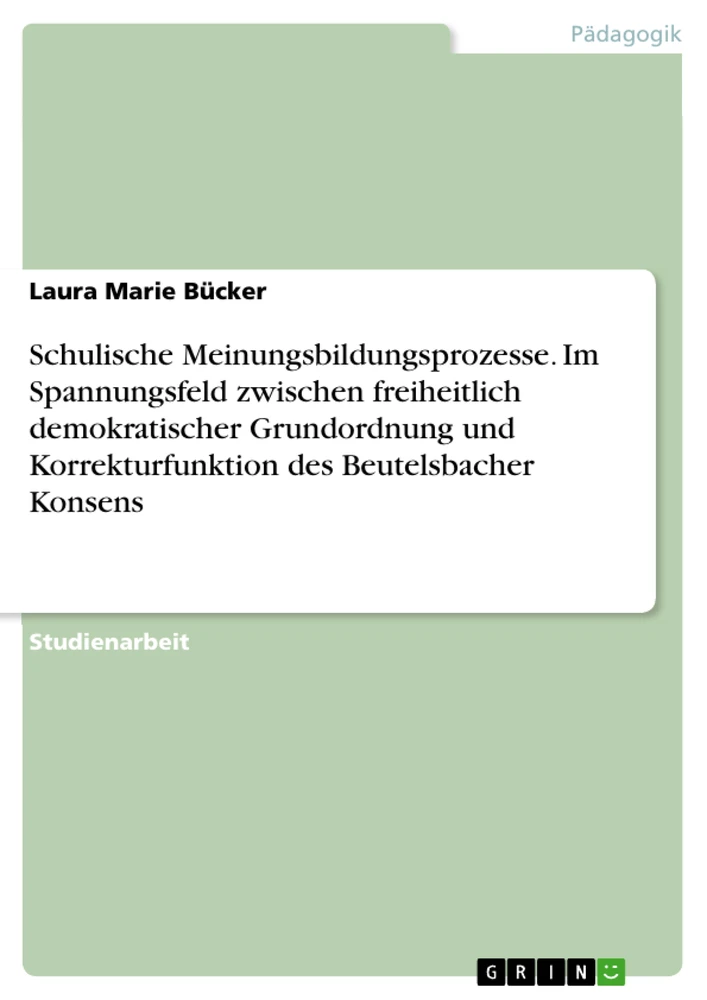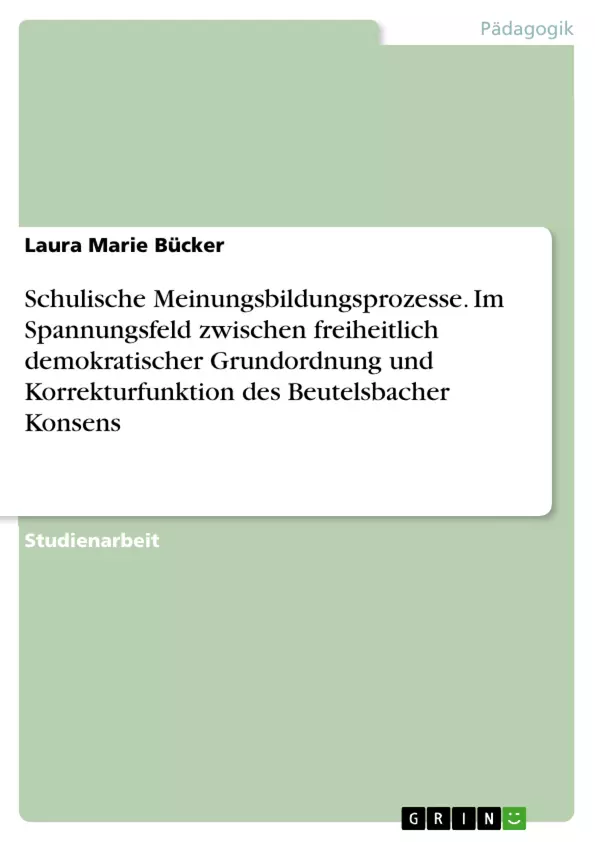Die Hausarbeit diskutiert die Konfliktposition der Lehrkraft zwischen freiheitlich demokratischer Grundordnung und Beutelsbacher Konsens.
Dazu wird zunächst auf die Entstehung und das Ziel der freiheitlich demokratischen Grundordnung eingegangen. Hierzu wird ihre Definition, ihr Inhalt und ihr Zweck näher erläutert. Zudem wird die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes vertieft und es wird hervorgehoben, wie die freiheitlich demokratische Grundordnung den LehrplänenPlus Gymnasium und Realschule zu Geltung kommt. Schließlich wird ebenfalls die Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetz definiert. Dann werden das Ziel und die Entstehungsgeschichte des Beutelsbacher Konsenses thematisiert. Außerdem wird das Überwältigungsverbot und das Kontroversitätsgebot näher beleuchtet und definiert.
Im anschließenden Unterkapitel über die Korrekturfunktion wird der Schnitt- und Konfliktpunkt schon deutlich. Darauffolgend werden alle Schnittstellungen und Spannungsfelder, in denen sich eine Lehrkraft befinden kann und die in dieser Hausarbeit aufgedeckt wurden, dargestellt und analysiert. Abschließend wird sich die Hausarbeit zu dem Thema positionieren und in einem Ausblick die Ergebnisse reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Entstehung und Ziel der freiheitlich demokratischen Grundordnung
- 2.1.1 Definition freiheitlich demokratischen Grundordnung
- 2.1.1.1 Inhalt und Zweck
- 2.1.1.2 Das Verständnis des Bundesverfassungsgerichts
- 2.1.1.3 FdGo im Lehrplan Plus Gymnasium Bayern
- 2.1.1.4 FdGo im Lehrplan Plus Realschule Bayern
- 2.1.1.5 Zweite Definition der freiheitlich demokratischen Grundordnung
- 2.1.2 Definition Meinungsfreiheit
- 2.1.1 Definition freiheitlich demokratischen Grundordnung
- 2.2 Entstehung und Ziel des Beutelsbacher Konsenses
- 2.2.1 Definition Kontroversitätsgebot
- 2.2.2 Definition Überwältigungsverbot
- 2.2.3 Korrekturfunktion
- 2.3 Konflikt- und Spannungsfeld
- 2.1 Entstehung und Ziel der freiheitlich demokratischen Grundordnung
- 3 Literaturverzeichnis
- 4 Ausblick, Positionierung, Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Herausforderungen für Lehrkräfte im Spannungsfeld zwischen der freiheitlich demokratischen Grundordnung (fdGo) und dem Beutelsbacher Konsens im Kontext schulischer Meinungsbildungsprozesse. Sie analysiert die Rolle der Lehrkraft bei der Gestaltung objektiver Meinungsbildungsprozesse, ohne die eigene Subjektivität übermäßig einfließen zu lassen.
- Definition und Anwendung der freiheitlich demokratischen Grundordnung
- Der Beutelsbacher Konsens und seine Bedeutung für den Unterricht
- Das Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit, Lehrfreiheit und den Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses
- Konfliktpunkte und Herausforderungen für Lehrkräfte in der Praxis
- Reflexion der Rolle der Lehrkraft im Meinungsbildungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Forschungsfrage: Wie steht die politikdidaktische Lehre/die Lehrkraft im Spannungsfeld zwischen Grundgesetz bzw. freiheitlich demokratischer Grundordnung und Beutelsbacher Konsens am Beispiel der Korrekturfunktion in schulischen Meinungsbildungsprozessen? Sie führt in die Problematik ein, dass Lehrkräfte aufgrund der zunehmenden politischen Polarisierung vor die Herausforderung gestellt werden, objektive Meinungsbildungsprozesse zu ermöglichen, ohne ihre eigene politische Haltung zu verbergen. Die Arbeit skizziert den weiteren Aufbau und die Methodik.
2.1 Entstehung und Ziel der freiheitlich demokratischen Grundordnung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und den Inhalten der freiheitlich demokratischen Grundordnung (fdGo). Es analysiert die Interpretation des Bundesverfassungsgerichts und untersucht, wie die fdGo in den bayerischen Lehrplänen für Gymnasium und Realschule verankert ist. Die Bedeutung der Grundrechte, der Gewaltenteilung und der Volkssouveränität für die fdGo wird ausführlich erläutert und mit Beispielen aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts veranschaulicht. Besonders wichtig ist die Erörterung der Schnittstellen und potentiellen Konflikte zwischen der fdGo und anderen Prinzipien, die im Bildungskontext relevant sind.
2.2 Entstehung und Ziel des Beutelsbacher Konsenses: Dieses Kapitel widmet sich der Entstehung und den Zielen des Beutelsbacher Konsenses, einem Minimalkonsens für politische Bildung. Es definiert die zentralen Prinzipien des Konsenses, insbesondere das Kontroversitätsgebot und das Überwältigungsverbot. Die Bedeutung dieser Prinzipien für die Gestaltung von Meinungsbildungsprozessen im Unterricht wird ausführlich dargestellt. Es werden kritische Punkte und mögliche Interpretationsspielräume des Beutelsbacher Konsenses beleuchtet und in Relation zur fdGo gesetzt. Der Fokus liegt dabei auf den Herausforderungen, die sich daraus für die Praxis der politischen Bildung ergeben.
Schlüsselwörter
freiheitlich demokratische Grundordnung (fdGo), Beutelsbacher Konsens, Meinungsbildungsprozess, politische Bildung, Lehrkraft, Kontroversitätsgebot, Überwältigungsverbot, Meinungsfreiheit, Lehrfreiheit, Grundgesetz, Bundesverfassungsgericht, Schulcurriculum, Bayern.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Freiheitlich Demokratische Grundordnung und Beutelsbacher Konsens
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Herausforderungen für Lehrkräfte im Spannungsfeld zwischen der freiheitlich demokratischen Grundordnung (fdGo) und dem Beutelsbacher Konsens im Kontext schulischer Meinungsbildungsprozesse. Sie analysiert die Rolle der Lehrkraft bei der Gestaltung objektiver Meinungsbildungsprozesse, ohne die eigene Subjektivität übermäßig einfließen zu lassen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Anwendung der fdGo, den Beutelsbacher Konsens und seine Bedeutung für den Unterricht, das Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit, Lehrfreiheit und den Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses, Konfliktpunkte und Herausforderungen für Lehrkräfte in der Praxis sowie die Reflexion der Rolle der Lehrkraft im Meinungsbildungsprozess.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit Unterkapiteln zur fdGo und zum Beutelsbacher Konsens, ein Literaturverzeichnis und einen Ausblick/Reflexionsteil. Der Hauptteil analysiert detailliert die Entstehung und Ziele der fdGo und des Beutelsbacher Konsenses, beleuchtet deren Prinzipien (Kontroversitätsgebot, Überwältigungsverbot) und untersucht das Spannungsfeld zwischen beiden im schulischen Kontext.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie steht die politikdidaktische Lehre/die Lehrkraft im Spannungsfeld zwischen Grundgesetz bzw. freiheitlich demokratischer Grundordnung und Beutelsbacher Konsens am Beispiel der Korrekturfunktion in schulischen Meinungsbildungsprozessen?
Wie wird die fdGo definiert und behandelt?
Die Arbeit definiert die fdGo, analysiert die Interpretation des Bundesverfassungsgerichts und untersucht deren Verankerung in den bayerischen Lehrplänen für Gymnasium und Realschule. Die Bedeutung der Grundrechte, der Gewaltenteilung und der Volkssouveränität wird ausführlich erläutert.
Was ist der Beutelsbacher Konsens und seine Bedeutung?
Die Hausarbeit beschreibt die Entstehung und Ziele des Beutelsbacher Konsenses als Minimalkonsens für politische Bildung. Sie definiert dessen zentrale Prinzipien (Kontroversitätsgebot und Überwältigungsverbot) und erläutert deren Bedeutung für die Gestaltung von Meinungsbildungsprozessen im Unterricht. Mögliche Interpretationsspielräume und Herausforderungen für die Praxis werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: freiheitlich demokratische Grundordnung (fdGo), Beutelsbacher Konsens, Meinungsbildungsprozess, politische Bildung, Lehrkraft, Kontroversitätsgebot, Überwältigungsverbot, Meinungsfreiheit, Lehrfreiheit, Grundgesetz, Bundesverfassungsgericht, Schulcurriculum, Bayern.
Welche konkreten Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit veranschaulicht die theoretischen Konzepte mit Beispielen aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und bezieht sich auf die Verankerung der fdGo in den bayerischen Lehrplänen. Konkrete Beispiele aus der Praxis der politischen Bildung werden im Kontext der Herausforderungen für Lehrkräfte diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Laura Marie Bücker (Autor:in), 2020, Schulische Meinungsbildungsprozesse. Im Spannungsfeld zwischen freiheitlich demokratischer Grundordnung und Korrekturfunktion des Beutelsbacher Konsens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1006873