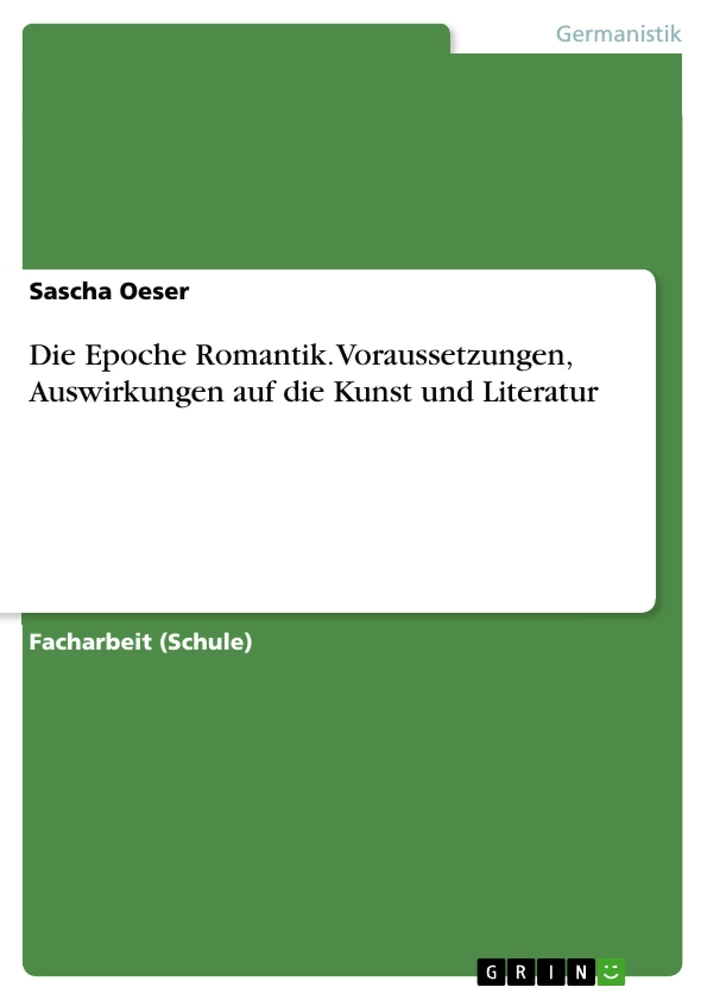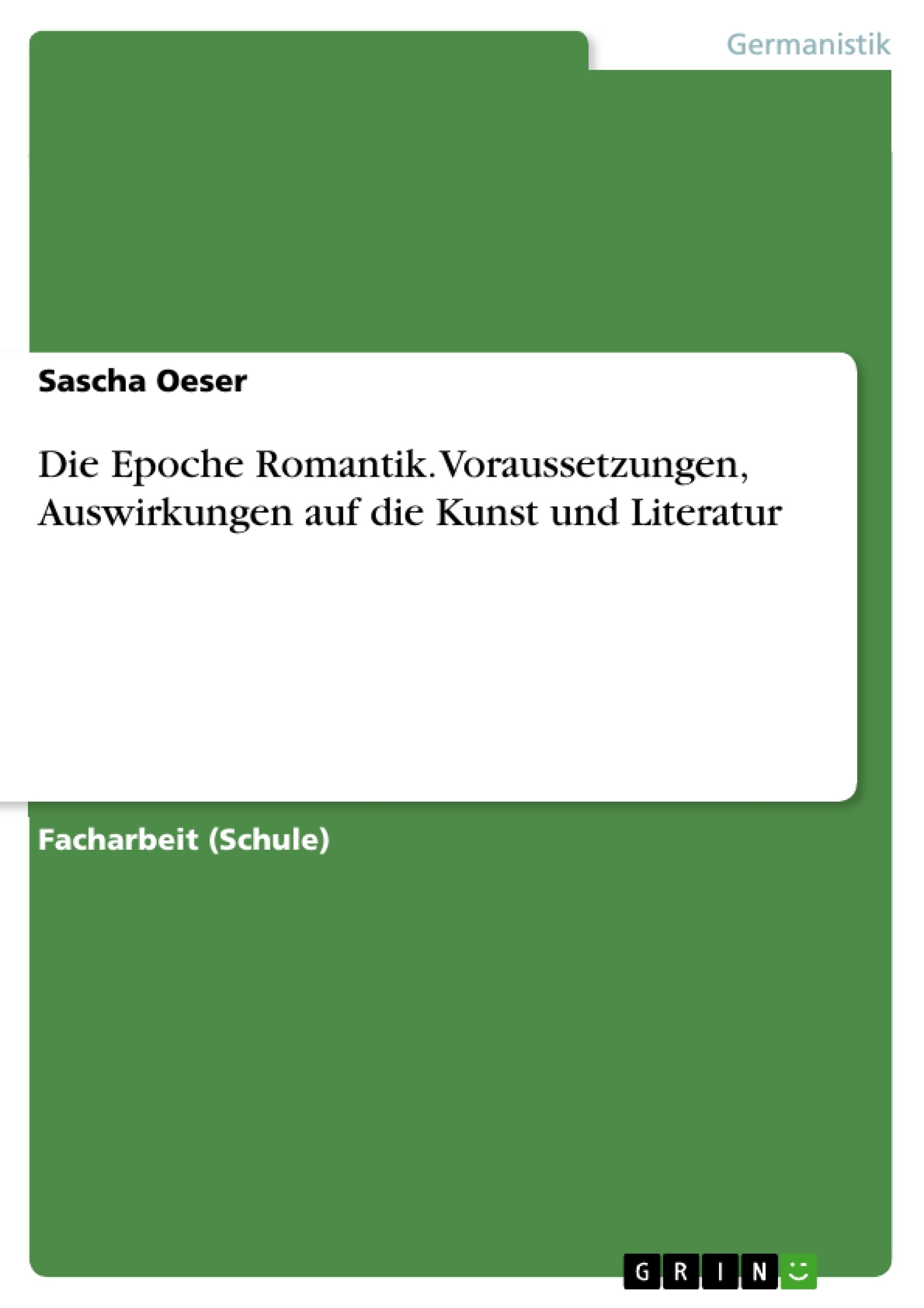Was bedeutet Romantik wirklich? Jenseits von Mondschein und Naturerlebnissen entführt diese umfassende Analyse in die vielschichtige Welt der Romantik, einer Epoche, die Europa zwischen 1790 und 1850 tiefgreifend prägte. Von den politischen Umwälzungen der Französischen Revolution und der Napoleonischen Herrschaft bis hin zu den philosophischen Strömungen des deutschen Idealismus, die von Fichte, Schelling und Hegel ausgingen, enthüllt dieses Buch die komplexen Zusammenhänge, die die romantische Bewegung formten. Entdecken Sie die drei Hauptströmungen – Jenaer Frühromantik mit ihren Vertretern wie Novalis und den Schlegels, die Heidelberger Hochromantik um Arnim und Brentano, die das Volkstümliche wiederentdeckten, und die Schwäbische Spätromantik mit Uhland, Hauff und E.T.A. Hoffmann, die historische Stoffe und dunkle Elemente in ihre Werke einfließen ließen. Erfahren Sie, wie die Romantik sich in verschiedenen Kunstformen manifestierte, von der Malerei Caspar David Friedrichs bis zur Musik Schuberts und Schumanns, und wie sie die literarischen Gattungen revolutionierte, wobei der Roman, das Märchen und die Novelle eine zentrale Rolle spielten. Tauchen Sie ein in die zentralen Themen und Motive der Romantik, von der Sehnsucht nach nationaler Einheit und der Spannung zwischen Heimatliebe und Fernweh bis hin zur Bedeutung des Nachtmotivs und der Naturverbundenheit. Ein besonderes Augenmerk gilt Novalis, dem Dichter der "blauen Blume", dessen Leben und Werk, insbesondere sein unvollendeter Roman "Heinrich von Ofterdingen", exemplarisch für die romantische Suche nach der "poetischen Wahrheit" stehen. Dieses Buch beleuchtet nicht nur die Blütezeit der Romantik, sondern auch ihr Ende um 1835 und ihre nachhaltigen Nachwirkungen bis in die moderne Literatur, Philosophie und Kunst. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die die Romantik in ihrer ganzen Tiefe und Vielfalt verstehen möchten, ein Schlüssel zum Verständnis einer Epoche, die bis heute unsere kulturelle Identität prägt. Das Buch bietet einen tiefen Einblick in die politische Situation, die kulturellen Strömungen, die Literatur, die Philosophie, die Malerei und die Musik der Romantik und zeigt, wie diese Bereiche miteinander verwoben waren.
Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeines
2. Politische Situation
3. Kultur
4. Literatur
4.1. Jenaer Romantik (Frühromantik)
4.2. Heidelberger Romantik (Hochromantik)
4.3. Schwäbische Romantik (Spätromantik)
4.4. Literarische Gattungen
4.5. Themen und Motive
5. Philosophie
6. Malerei
7. Musik
7.1. Epochen
7.2. Motive und Merkmale
7.3. Musikalische Merkmale
8. Biografie Novalis
9. Novalis - „Heinrich von Ofterdingen“
10. Ende der Romantik
Literaturverzeichnis
Quellen
1. Allgemeines
- Romantik: Zustand, der durch Betonung des Gefühls und der Phantasie gekennzeichnet ist und mit Mondschein, Naturerlebnis und Zivilisationsferne verbunden wird
➔ durch romantische Bewegung des 18. und 19.Jh. geprägt · Begriff: altfranzösisch „romanz“ = „in der Volkssprache“
- Bereiche: - bildende Kunst
- Malerei (Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich,
die Nazarener)
- Musik (Schumann, Schubert, Loewe)
- Literatur (zwischen 1790 und 1850)
- Verbreitung in ganz Europa
- Lord Bryon, Madame de Stael
- Beginn der Literaturepoche in Deutschland: Wanderung Ludwig Tiecks und Wilhelm Heinrich Wackenroders im Jahr 1793
- Auflösungserscheinungen: vor allem im Werk Heinrich Heines erkennbar
- Nachwirkungen bis über das 19.Jh. hinaus bis in unsere Zeit (Neuromantik um 1880, Surrealismus, Thomas Mann)
- Gegenströmung zum Klassizismus
2. Politische Situation
- Französische Revolution und Herrschaft Napoleons
➔ gewaltige Veränderungen in politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht in Europa
- anfangs Begeisterung für Revolution bei deutschen Intellektuellen
➔ Septembermorde, Hinrichtung Ludwig XVI.
➔ gewandelte Einstellung
- weitere Verunsicherung: - Auflösung des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation (Niederlegung der
Kaiserkrone durch Franz II.)
- Mediatisierung und Säkularisation
geistlicher und immediater weltlicher Herrschaftsbezirke
➔ mit der Zeit wurde die erst bewunderte Gestalt Napoleon zur Person, die es zu bekämpfen galt
- wachsender Nationalismus
➔ Ablehnung jeglicher Fremdherrschaft (z.B.: Kaisertum Bonaparte (seit 1804)) · Ablehnung der neuen Ordnung
(von Volk und legitimen Herrschern Europas ausgehend) ➔ Befreiungskriege (1813)
- Freiwilligenverbände (z.B. Studenten)
➔ traten für freie Selbstbestimmung des Deutschen Volkes ein
1
- Truppen Napoleons sehr schnell geschlagen
aber: militärische Erfolg konnte nicht in politisches Kapital verwandelt werden
- Wiener Kongress: - Wiederherstellung der alten vorrevolutionären Ordnung
(1814/15) (z.T. unter Einbezug Frankreichs)
➔ Deutscher Bund
- lockere Vereinigung deutscher Länder mit Österreich
- Instanz: Bundestag in Frankfurt am Main
- Vorsitz: Österreich
➔ restaurative Politik des österreichischen Staatskanzlers Fürst von Metternich (Karlsbader Beschlüsse 1819)
➔ Niederhalten der liberalen und nationalen Bewegungen
- Machtlosigkeit des Bürgertums und territoriale Zersplitterung
➔ z.T. Sehnsucht nach alter vorabsolutistischer, quasi naturgewollter politischen und gesellschaftlichen Ordnung
- Königsherrschaft und ständische Ordnung des Hochmittelalters
➔ Hochmittelalter = Fluchtpunkt bürgerlicher Sehnsüchte um 1815
3. Kultur
- philosophische Grundlagen für romantische Kunst: deutscher Idealismus mit Fichte (1762 - 1814), Schelling (1775 - 1854) und Hegel (1770 - 1831)
- religiöser Individualismus: Schleiermacher (1768 - 1834) · Romantik nicht auf Literatur beschränkt
➔ verschiedene Kunstformen beeinflussten sich gegenseitig
- z.T. Künstler, Maler und Dichter in einer Person (z.B. Runge) · Zuwendung zum Volkhaften (auch Wissenschaft) · Mentalitätswandel
- Gefühl wieder als wichtigste menschliche Fähigkeit ➔ Welt möglichst intensiv erleben
(möglich durch Romantisierung)
Novalis: „Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein
geheimnisvolles Aussehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.“
(1)
4. Literatur
4.1. Jenaer Romantik (Frühromantik, 1795 - 1804)
- wichtigste Vertreter: Wackenroder, Tieck, Schlegel, Novalis (8)
- Beginn der romantischen Dichtung an Namen Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773 - 1798) und Ludwig Tieck (1773 - 1853) gebunden
- Wanderung durch die fränkische Schweiz im Jahre 1793
➔ Entdeckung des Mittelalters in Nürnberg
- nachhaltige Beeindruckung durch Religion und Kunst (vor allem fränkisches Barock und Katholizismus)
➔ Mittelalter wurde zur idealen Epoche
„goldenes Zeitalter“, das es wieder herzustellen galt
- ältere Romantik vorwiegend philosophisch ausgerichtet
- Hinwendung zum Volkstümlichen
Anregungen: - Herder
- Volkspoesie der Stürmer und Dränger
➔ Vertiefung durch Philosophie
- Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814)
- „Wissenschaftslehre“ (1794/95)
- subjektives Individuum = Mittelpunkt allen Seins
- kann durch begrenzte Wirklichkeit nicht zur vollkommenen
Entfaltung seines Wesens kommen
- Tendenz zur Unendlichkeit
- Hinwendung an die Vergangenheit
- Erwartung einer „neuen Religion“ (Spätromantik)
➔ Widerspiegelung in Literatur
(Inhalt verweist auf das Ganze, das jegliche Begrenztheit überschreitende)
- seit 1794 Lehrer an Universität Jena
➔ nahe dem Zentrum der klassischen Literatur (Weimar)
- persönliche Kontakte zwischen Vertretern der klassischen und romantischen
Dichtung (z.B. Schiller <--> Schlegel)
- Romantik erwuchs auf dem Boden der Klassik
➔ alte Goethe wurde Frühromantikern zu nachahmenswertem Vorbild
- Friedrich Schlegel (1772 - 1829)
- literarischer Ausdruck der Stimmung und Geisteshaltung (siehe Fichte)
= „Universalpoesie“
(„Willkür des Dichters“ ➔ dichten, wie er es für richtig hält)
- charakteristisches Mittel: romantische Ironie
- romantischer Dichter weiß um das Auseinanderfallen von
Phantasie und Erfahrung, von Ideal und Realität, von begrenzter Wirklichkeit und imaginierter Unendlichkeit
➔ Aufhebung dieser Grenzen mit Hilfe der Ironie
- verwebt Zeiten (Vergangenheit - Zukunft),
Bewusstseinsebenen (Verstand - Traum/Vision) und literarische Formen (klassisch geschlossen - fragmentarisch) miteinander oder hebt sie ganz auf
Novalis: „Die Poesie heilt die Wunden, die der Verstand schlägt.
Der Sinn für Poesie hat viel mit dem Sinn für Mystizism gemein. Er ist der Sinn für das Eigentümliche, Personelle, Ungekannte, Geheimnisvolle, zu Offenbarende. Er sieht das Unsichtbare, fühlt das Unfühlbare. Schön, romantisch, harmonisch sind nur Teilausdrücke des Poetischen. Das ganze Menschengeschlecht wird am Ende poetisch. Neue goldene Zeit.“ (2)
- Übersetzungen ausländischer Literatur ➔ Kennen lernen anderer Kulturen
- Jena = Zentrum der frühromantischen Literatur
- Friedrich von Hardenberg (Novalis) gab Romantik ihr Symbol
„blaue Blume“ (aus Roman: „Heinrich von Ofterdingen“)
- August Wilhelm Schlegel (1767 - 1845): Übersetzungen von Shakespeare
- Ludwig Tieck: „Volksmärchen“ (1797)
- Dichter ließen sich stark von der Wissenschaft leiten
4.2. Heidelberger Romantik (Hochromantik, 1805 - 1814)
- wichtigste Vertreter: Arnim, Brentano (7), Eichendorff
- Heidelberg = Zentrum der Hoch- bzw. Spätromantik
- Beginn: Rheinfahrt von Achim von Arnim (1781 - 1831) und Clemens Brentano (1778 - 1842) im Jahre 1802
- Anregung vom Nachdenken über die politische Situation in Frankreich und in den deutschen Staaten (nach Zusammenfall des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation)
➔ Sammlung von Volksliedern als Dokumente deutschen Nationalgeistes
- ältere mündlich überlieferte Lieder, zeitgenössische und einige im volksliedhaften Ton verfasste Gedichte
- Inspiration durch Volksliedsammlung Herders (1778)
- Vorbildfunktion für „Kinder- und Hausmärchen“ (Grimm; 1812/15) „Deutschen Volksbücher“ (3 Bände; 1836/37), ...
- ab 1805 Bildung einer romantischen Bewegung
(Achim von Arnim, Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff (1788 - 1857), Joseph Görres (1776 - 1848), Karoline von Günderode (1780 - 1806), Brüder Jakob (1785 - 1863) und Wilhelm Grimm (1786 - 1859) · weniger theoretisch - philosophisch ausgerichtet ➔ vor allem volkstümliches Element
- Dichter wenden sich gegen französische Einflüsse auf die dt. Literatur, gegen Aufklärung und Klassizismus
- Pflege des Volksguts, Sammlung von Volksliedern und volksliedhaften Dichtungen, Volksmärchen, Sagen und Neuentdeckung der Volksbücher (Till Eulenspiegel,...)
- Gebrüder Grimm: - Sprachforscher (Grimmsches Wörterbuch)
- Begründer der Germanistik
- nach Protestschreiben des Amtes enthoben und des Landes verwiesen
4.3. Schwäbische Romantik (Spätromantik, 1815 - 1835)
- wichtigste Vertreter: Uhland, Hauff, Schwab, Hoffmann
- vorwiegend historisch orientiert
- Orientierung besonders an Geschichte und Kultur der Staufer, die sie auch
literarisch gestalteten
- Wilhelm Hauff (1802 - 1827)
- vor allem als Märchendichter in Erinnerung („Der kleine Muck“,...)
- Johann Peter Hebel (1760 - 1826)
- bedeutendstes Werk: „Schatzkästlein des Rheinisches Hausfreundes“
(Anekdoten und Novellen)
- Eduard Mörike (1804 - 1875)
- Einbeziehung des Dämonischen in seine Darstellung
➔ Schwelle zum Realismus
- Gustav Schwab (1792 - 1850)
- steter Sammler und Nacherzähler von alten dt. Sagen und Volksbüchern
- Ludwig Uhland (1787 - 1862)
- auch polit. Aktiv
- Stoffe für seine Dichtungen (Balladen und Romanzen) vorwiegend aus dem
Bereich der deutschen, romantischen und nordischen Sagen
- E.T.A. Hoffmann (1776 - 1822)
- Begründer der Kriminalgeschichte
- führte romantische Ironie auf ihren Höhepunkt
- Vorform der Kurzgeschichte
- weitere Zentren:
- Berlin
- Dresden
4.4. Literarische Gattungen
- Ziel der Dichter: Grenzen der Gattungen verwischen ➔ Wechsel zwischen Prosa und Vers
- Mittelpunkt: Roman (v.a. Frühromantik (Künstlerroman))
- beeinflusst von Goethes „Lehrjahren“
- Überzeugung, im Roman romantisches Literaturprogramm am besten
Verwirklichen zu können
➔ höchste Bewertung dieser Gattung
- trotzdem viele relativ unbedeutende Werke
- Versuch der Romantisierung des Lebens
➔ Auflösung typischer Romanformen
➔ märchenhafte oder lyrische Elemente (z.B. in Form von Erzählungen oder Gedichten) in epische Texte aufgenommen
- Novelle (v.a. Spätromantik)
- unerhörte Begebenheit zum Thema
➔ kommt antirationalistischer Tendenz der romantischen Bewegung nahe ➔ viele bedeutende Werke
- Märchen (Hochromantik)
- nicht Erzählung einer wirklichen Begebenheit, sondern spielt frei von allem
Gegenständlichen nur mit der Imagination des Lesers
➔ wichtige Gattung
- ähnlich: Anekdote
- Aufhebung der Grenzen zwischen Wirklichkeit und Unwirklichem
- Drama
- fehlender strenger Formwille der Romantiker
➔ nur geringe Aufmerksamkeit
- Schaffen der Vätergenerationen (v.a. Klassik und Sturm und Drang) zu
übermächtig und vollendet
➔ neue Ansätze eher behindert als gefördert
- einzig wichtige Bühnenautoren
- Heinrich von Kleist (Schaffen von romantischer Theorie aber nur
wenig beeinflusst)
- Zacharias Werner („Der vierundzwanzigste Februar“ (1809)) ➔ Schicksalstragödie
- Lyrik
- nicht abstrakt analytisch und rational
- Vorliebe für gleichförmige Strophik und Reim
- keine Erlebnisdichtung
- dominant: volkstümliche Formen und Inhalte
➔ oft zum Kunstlied vertont (v.a. von Eichendorff)
- Gedichte (6)
- gefühlvoll
- enges Netz aus Symbolen und Leitmotiven
<--> trotzdem leicht verständlich ➔ konnten Volksgut werden („Das Wandern ist des Müllers Lust“)
- Spannungsfeld zwischen einer am Volkslied orientierten Schlichtheit und
höchster sprachlicher Virtuosität
4.5. Themen und Motive
Themen
- Sehnsucht nach nationaler Einheit
- Spannung zwischen Heimatliebe und Fernweh
- christliches Mittelalter
- Zusammenwirken der Künste
Motive
- Nachtmotiv
Novalis: „Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht?“ (3)
- Sehnsucht
- Naturverbundenheit
5. Philosophie
- zerstörte Hoffnung der Intellektuellen auf bürgerliche Umgestaltung
- Mensch nur noch als ökonomischer Nutzwert gesehen (durch Einsetzen der Industrialisierung)
➔ Selbstverwirklichung nur noch außerhalb der Gesellschaft oder gegen dieselbe · Dichter als Außenseiter
- Sehnsucht als bestimmendes Gefühl
- kein benennbares Motiv
➔ kann nie Erfüllung finden
➔ speist sich aus sich selbst und kann hingebungsvoll und dauerhaft genossen werden
- Gegenposition zum Menschenbild der Aufklärung (Vernunft) ➔ gegen Rationalismus und Erkenntnisoptimismus
- mit der Zeit mehr und mehr okkulte Züge (auch Naturwissenschaften und Medizin beeinflusst)
- subjektivistische Weltsicht
- Einheit von Natur und Geist
- unsichtbarer Geist = Erscheinungsform der beseelten Natur · Wunsch nach Vermischung verschiedener Sinnesbereiche
- Natur als Spiegel subjektiven Erlebens
- bevorzugtes Motiv: Landschaft
- durch Ausschnitthaftigkeit Verdeutlichung der Unbegrenztheit des Universums (5)
- „Altdeutsches“ wurde zum Symbol des Künstlertraumes von einer guten alten Zeit
7. Musik
7.1. Epochen
1. Frühromantik
- 1810 - 1828
- Beethoven, Schubert
Schubert: „Musik ist die höhere Potenz der Poesie.“ (4)
2. Hochromantik
- 1828 - 1860
- Schumann, Mendelsson - Bartholdy
3. Romantischer Klassizismus
- Brahms
4. Romantischer Mystizismus
- Brucker
5. Spätromantik
- 1860 - 1910
- Wagner
7.2. Motive und Merkmale
Motive
- Illusion
- Gefühle/Phantasien · Unzufriedenheit
- Enttäuschung über Ausgang der Französischen Revolution
Merkmale
- subjektives Ausdrucksbedürfnis · märchenhafte Weltsicht · naturbezogene Idyllik
- freischaffende Komponisten mit Nebenberufen · Komponisten meist Dirigent und Solist
7.3. Musikalische Merkmale
- liedhafte Themen
- große Klangfarbenkontraste
- Ausdrücke des Fühlens und Erlebens des Menschen
8. Biografie Novalis
8.1. Leben
- eigentlich Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg
- geboren am 2.5.1772 als Sohn des Großgrundbesitzers und Salinendirektors
Heinrich Ulrich Erasmus von Hardenberg im sächsischen Oberwiederstedt (Harz) ➔ adliger Herkunft
- in politischen, philosophischen und kunsttheoretischen Auffassungen reaktionär · in strengem Pietismus aufgewachsen
- 1790 - 1794: Studium von Jurisprudenz, Mathematik und Philosophie in Jena,
Leipzig und Wittenberg (von Schiller und Reinhold unterrichtet) ➔ erster Kontakt mit romantischem Gedankengut · zunächst für preußischen Staatsdienst vorgesehen
➔ Aktuarius eines Kreisamtmanns
- 1794: Verlobung mit der 13-jährigen Sophie von Kühn ohne Wissen der Eltern
- 1797: plötzlicher Tod der Verlobten
➔ verstärkter Hang zur Mystik
- nach 1797: Studium von Bergwerkskunde, Chemie und Mathematik an der Bergakademie Freiberg
- 1798: 2. Verlobung (mit Julie von Charpentier, keine Hochzeit)
- nach 1800: erschwerte Lungenkrankheit (seit seiner Geburt; unheilbar)
- Tod am 25.3.1801 in Weißenfels
8.2. Schaffen
- Freundschaft zu Schiller, Tieck und Schlegel · beeinflusst von dt. Nationalismus · Suche nach „poetischer Wahrheit“
- geprägt vom Motiv der Nacht („Hymnen an die Nacht“)
- irrationalistische, mystische Jenseitssucht und Diesseitsfreude · intensive natur- und geisteswissenschaftliche Studien · strenger christlicher Glauben ➔ blindes Gottvertrauen · Ideal: verklärtes „dunkles“ Mittelalter und katholische Kirche ➔ kritiklose Darstellung und Idealisierung
- bildet den Höhepunkt des romantischen Künstlerromans (unvollendeter Roman „Heinrich von Ofterdingen“)
➔ gewann in wenigen Jahren sehr großen Einfluss auf die romantische Literatur ➔ bedeutendster Lyriker und Prosadichter der dt. Frühromantik
- weitere Werke: - „Die Lehrlinge zu Sais“ (1798)
- „Die Christenheit oder Europa“ (1802)
- Vorbilder der romantischen Erzählprosa:
- Goethe: „Wilhelm Meisters Lehrjahre“
- Heinse: „Die glückseligen Inseln“
„Ardinghello“
- populäres Verfahren: Einbindung mehrerer Erzählungen und Novellen in einen erfundenen Erzählrahmen
- Heranreifen des mittelalterlichen Dichters Heinrich (historisch nicht nachweis- bar) zum Minnesänger und zum Helden des Sängerwettstreits auf der Wartburg · träumt zu Beginn von der blauen Blume (erfuhr von Reisendem davon) · im weiteren Handlungsfortgang (dient zur Vervollkommnung des Helden): Heinrich trifft in der Person der Mathilde (Tochter des Dichters Klingsohr) auf das Mädchen seiner Traumvision, das er heiratet
- erster Teil des Romans („Die Erwartung“) vom Märchen Klingsohrs beendet (stellt den Beginn des Goldenen Zeitalters in Aussicht)
- zweiter Teil („Die Erfüllung“) aus Bruchstücken und Planskizzen erahnbar · Roman in das Genre des Bildungsromans einzuordnen · bewußte Nachfolge aber romantisches Gegenstück zu Goethes „Wilhelm Meister“
- Bezugspunkt des Helden: Universelles, göttliches Prinzip im
Unendlichen
➔ ermöglicht Überwindung seiner irdischen Beschränkungen
- Novalis gestaltet Bezug zur Unendlichkeit mit Hilfe von Leitmotiven und Symbolen aus („blaue Blume“)
- Entrückung des Protagonisten in die Welt des Mittelalters (idealisiert) ➔ gesellschaftspolitische Relevanz in Frage gestellt
10. Ende der Romantik
- um 1835
- meistens Unterwerfung unter den restaurierten Absolutismus von Staat und Kirche
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Romantik als Literaturepoche in Deutschland, einschließlich ihrer politischen, kulturellen und philosophischen Hintergründe.
Was sind die Hauptthemen im Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Hauptthemen: Allgemeines zur Romantik, politische Situation zur Zeit der Romantik, Kultur, Literatur (inkl. Jenaer, Heidelberger und Schwäbische Romantik), Philosophie, Malerei, Musik, Biografie Novalis', Novalis' "Heinrich von Ofterdingen", und das Ende der Romantik.
Was wird unter dem Abschnitt "Allgemeines" behandelt?
Der Abschnitt "Allgemeines" definiert den Begriff "Romantik" und nennt die verschiedenen Bereiche, in denen sich die Romantik verbreitete, wie bildende Kunst, Malerei, Musik und Literatur. Zudem werden wichtige Persönlichkeiten und Ereignisse im Zusammenhang mit dem Beginn und den Nachwirkungen der Epoche genannt.
Welche politischen Ereignisse beeinflussten die Romantik?
Die Französische Revolution und die Herrschaft Napoleons hatten einen großen Einfluss auf die Romantik. Zunächst begeisterten sich deutsche Intellektuelle für die Revolution, aber die Septembermorde und die Hinrichtung Ludwig XVI. führten zu einer veränderten Einstellung. Die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und die Mediatisierung und Säkularisation trugen zur Verunsicherung bei.
Was wird unter dem Abschnitt "Kultur" behandelt?
Der Abschnitt "Kultur" behandelt die philosophischen Grundlagen der romantischen Kunst, wie den deutschen Idealismus mit Fichte, Schelling und Hegel, sowie den religiösen Individualismus von Schleiermacher. Er betont auch, dass die Romantik nicht auf die Literatur beschränkt war, sondern verschiedene Kunstformen beeinflusste. Es wird die Bedeutung des Gefühls hervorgehoben und wie wichtig es war, die Welt möglichst intensiv zu erleben.
Was sind die Unterschiede zwischen Jenaer, Heidelberger und Schwäbischer Romantik?
Die Jenaer Romantik (Frühromantik) war philosophisch ausgerichtet und suchte nach einer "neuen Religion". Die Heidelberger Romantik (Hochromantik) konzentrierte sich auf volkstümliche Elemente und sammelte Volkslieder und Märchen. Die Schwäbische Romantik (Spätromantik) war historisch orientiert, insbesondere an der Geschichte und Kultur der Staufer.
Welche literarischen Gattungen waren in der Romantik von Bedeutung?
Der Roman, insbesondere der Künstlerroman, stand im Mittelpunkt der Frühromantik. Die Novelle war in der Spätromantik bedeutend, und das Märchen war eine wichtige Gattung in der Hochromantik. Die Lyrik war durch volkstümliche Formen und Inhalte geprägt.
Welche Themen und Motive sind typisch für die Romantik?
Typische Themen sind die Sehnsucht nach nationaler Einheit, die Spannung zwischen Heimatliebe und Fernweh, das christliche Mittelalter und das Zusammenwirken der Künste. Wichtige Motive sind das Nachtmotiv, die Sehnsucht und die Naturverbundenheit.
Was sind die wichtigsten Merkmale der romantischen Musik?
Die romantische Musik zeichnet sich durch liedhafte Themen, große Klangfarbenkontraste und den Ausdruck von Gefühlen und Erlebnissen des Menschen aus. Es gab verschiedene Epochen der romantischen Musik, darunter Frühromantik, Hochromantik, Romantischer Klassizismus, Romantischer Mystizismus und Spätromantik.
Was sind die wichtigsten Informationen zur Biografie von Novalis?
Novalis (Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg) war ein bedeutender Lyriker und Prosadichter der deutschen Frühromantik. Er wurde am 2.5.1772 geboren und starb am 25.3.1801. Er studierte Jurisprudenz, Mathematik und Philosophie und war geprägt von mystischen Jenseitssucht und Diesseitsfreude. Sein unvollendeter Roman "Heinrich von Ofterdingen" gilt als Höhepunkt des romantischen Künstlerromans.
Wann und wie endete die Romantik?
Die Romantik endete um 1835, meistens mit der Unterwerfung unter den restaurierten Absolutismus von Staat und Kirche. Allerdings hatte sie lange Nachwirkungen bis in die Literatur der Gegenwart.
- Quote paper
- Sascha Oeser (Author), 2000, Die Epoche Romantik. Voraussetzungen, Auswirkungen auf die Kunst und Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100660