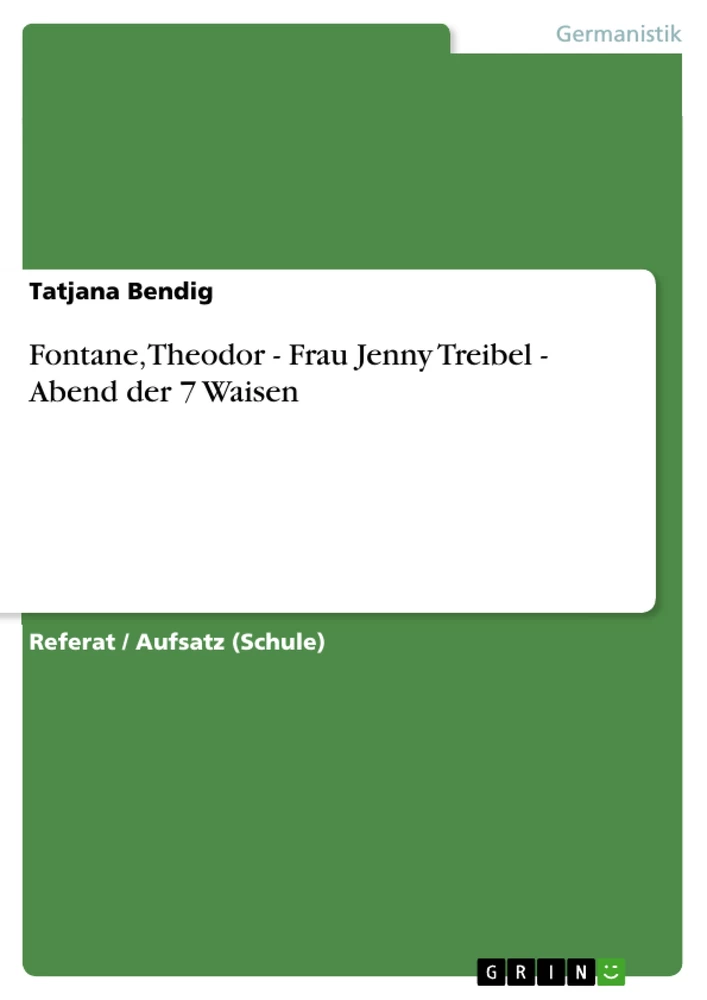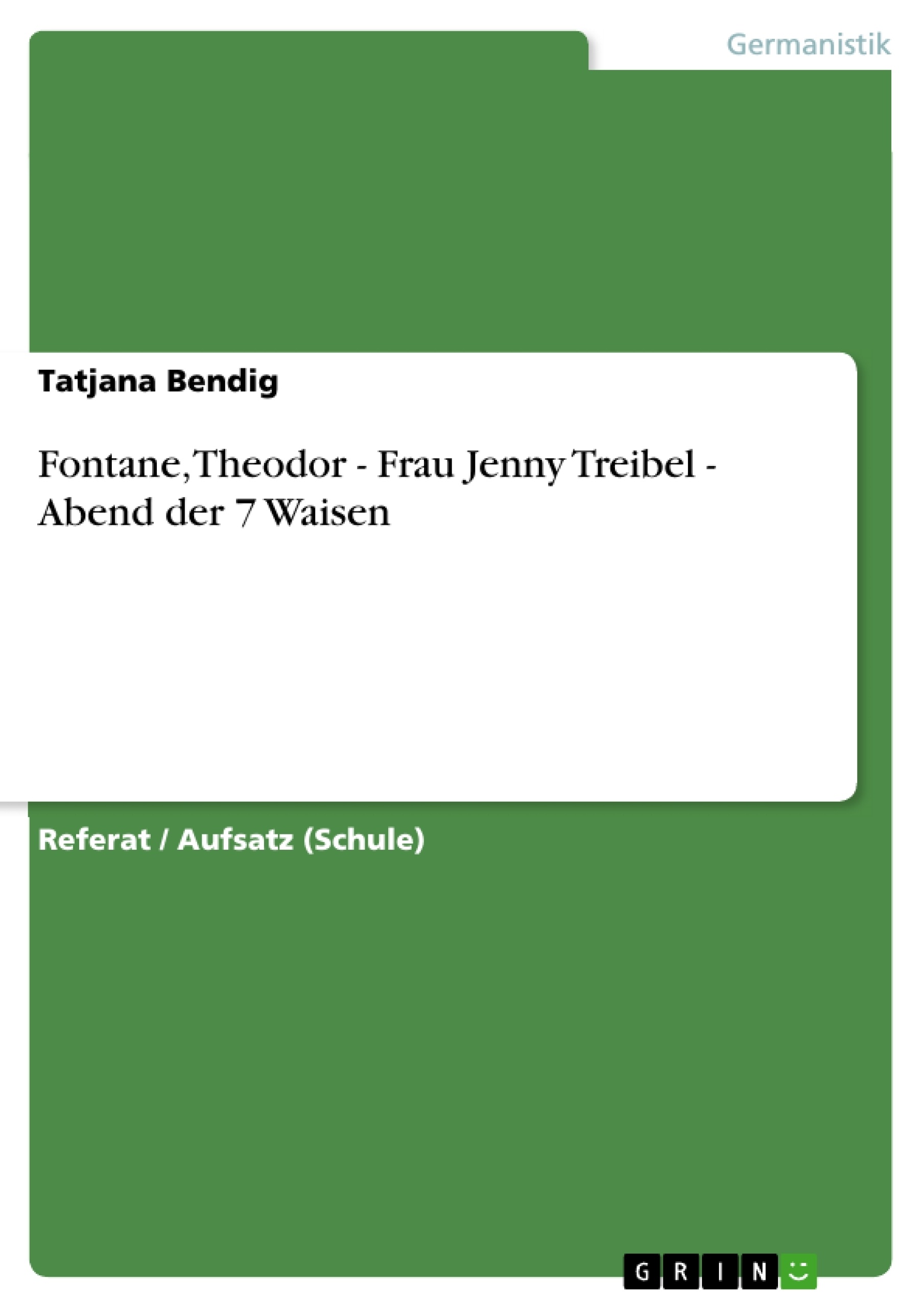Was geschieht, wenn sich der Geist des alten Berlin mit dem Anspruch der Moderne kreuzt? Theodor Fontanes Roman "Frau Jenny Treibel" entführt uns in eine Welt des aufstrebenden Bürgertums des 19. Jahrhunderts, wo Fassade und Realität einen delikaten Tanz aufführen. Im Zentrum steht ein Abend bei Professor Willibald Schmidt, einem Hort des intellektuellen Berlins, an dem sich die sogenannten "Sieben Waisen Griechenlands" versammeln – eine illustre Runde von Gymnasiallehrern, die sich selbstironisch dem Geist der Antike verschrieben haben. Doch hinter der geselligen Maske brodeln Kontroversen. Ein hitziger Disput zwischen Schmidt und dem emeritierten Direktor Distelkamp entfacht einen Kampf zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen veralteter Autorität und dem Anspruch des wahren Wissens. Während das Diner bei Jenny Treibel, der Jugendfreundin Schmidts, den Luxus und die gesellschaftliche Konvention zelebriert, suchen die "Sieben Waisen" nach einer höheren Wahrheit, nach dem "eigentlich Menschlichen" im vermeintlich Nebensächlichen. Doch auch in diesem Kreis der Gelehrten lauern Eitelkeiten und das Streben nach Anerkennung. Finden sie einen Weg, sich von den Fesseln des Besitzbürgertums zu befreien, oder sind sie, wie Schneewittchens Zwerge, in ihrer eigenen Welt gefangen? Eine brillante Analyse der wilhelminischen Gesellschaft, die mit scharfzüngigem Witz und feiner Beobachtungsgabe die Widersprüche einer Epoche offenbart, in der Bildung, Reichtum und Charakter in einem spannungsvollen Dreieck zueinander stehen. Eine Geschichte über Ideale, Illusionen und die ewige Suche nach dem wahren Wert im Leben, eingebettet in den Strudel gesellschaftlicher Veränderungen und persönlicher Ambitionen. Ein literarisches Meisterwerk, das den Leser auf eine Reise in eine vergangene Zeit mitnimmt und doch brandaktuelle Fragen aufwirft: Was bedeutet wahre Bildung? Welche Rolle spielt Ansehen in unserem Leben? Und wie finden wir unseren Platz in einer Welt, die sich ständig wandelt? Tauchen Sie ein in Fontanes Berlin und entdecken Sie eine Welt voller Intrigen, Ironie und unerwarteter Wahrheiten. Lassen Sie sich von der scharfen Zunge des Autors und der Vielschichtigkeit seiner Charaktere verzaubern und erleben Sie einen Roman, der noch heute, über hundert Jahre nach seiner Entstehung, nichts von seiner Brisanz verloren hat.
Der Abend des Professors (S.44-60)
Der 1892 erschienene, von Theodor Fontane verfasste Roman ,,Frau Jenny Treibel" befasst sich mit dem Bürgertum jener Jahre und der Schilderung des Lebens, sowie der Atmosphäre dieser Zeit, worin die kritische Sicht der Autors im Bezug auf die damalige gesellschaftliche Wirklichkeit deutlich wird.
Der Roman beginnt mit Szenen, die zwar für den Handlungsstrang keine große Bedeutung haben, dem Leser jedoch dabei helfen, sich in die Situation der Gesellschaft des 19. Jh. hineinzudenken. Diese Gesellschaft wird durch typische Vertreter bestimmter Charaktere repräsentiert. Auch die von mir im folgenden zu behandelnde Textstelle, dem Abend bei Professor Willibald Schmidt, ist jedoch keine Vorkenntnis über den Roman erforderlich.
Professor Willibald Schmidt gehört dem Bildungsbürgertum Berlins an. Er kann zwar ein gewisses Kapital aufweisen, legt jedoch keinen Wert auf Besitz und Ansehen in der Öffentlichkeit, sondern belächelt vielmehr die luxusorientierte Bourgeoisie, worauf ich später noch im Näheren eingehen werde. Schmidt gehört dem Kreis der ,,Sieben Waisen Griechenlands" an, welcher aus Gymnasiallehrern besteht, die sich selbstironisch diesen Titel gaben und sich nun seit Jahren einmal wöchentlich zu gemeinsamem Abendessen und Gesprächen Treffen. Ort des Geschehens ist in Kapitel 6 des 16 Kapitel umfassenden Romans das Anwesen des Professors. Hier sollen sich die Sieben Waisen, sobald sie vollständig sind, ,,um einen runden Tisch und eine mit roten Schleier versehene Morderateurlampe" (S.44, Z.27 ff.) versammeln, die der Atmosphäre wohl einen gewissen mysterisch-esoterischen Anstrich verleihen soll. Der hier noch neutrale und außenstehende Erzähler berichtet vorerst am Anfang des sechsten Kapitels über die Zusammensetzung des Kränzchens aus Schmidt, den drei Gymnasiallehrern Rindfleisch, Hannibal Kuh und Immanuel Schultze, Dieselkamp, Friedeberg und Dr. Charles Etienne. Weiter berichtet der Erzähler über die Vergangenheit dieses Kreises. So wird angeführt, dass man versucht hatte, Friedeberg aufgrund seiner ,,wissenschaftlichen Nichtzugehörigkeit" (S.45, Z.7 f.), die dafür verantwortlich war, dass er ,,für nicht ganz voll angesehen" (S.45, Z.2 f.) wurde, aus dem Kreis ,,herauszugraulen" (S.45, Z.5).
Die nach außen hin durch Beruf und Verwandtschaft einig erscheinende Gemeinschaft wird vertritt jedoch die gegensätzlichsten Einstellungen (S. 45, Z.40 ff.)
Etienne ist bereits vor allen anderen da, da er ,,so gut wie zur Familie" (S.47, Z.6 f.) gehört. Distelkamp trifft verspätet ein. Die Abwesenheit von Kuh und Immanuel entschuldigen sie sich dadurch, dass diese nur ,,ihres Schwagers und Schwiegervaters Klientel" (S.47, Z. 9) sind. Hiermit ist Rindfleisch gemeint, der sich aber zuvor abgemeldet hatte. Somit ist das Fehlen dieser drei entschuldigt.
Nur nach außen hin beschwören die Herren die große Priorität dieses Abends, innerlich jedoch sucht jeder nach einer Ausrede und nimmt jegliche Gelegenheit, sei es auch nur eine Skatrunde, wahr, um diesem Abend aus dem Weg zu gehen. (S.46, Z.25 ff.)
Distelkamp und Schmidt begeben sich also vorerst alleine ins Nebenzimmer, wo ein kontroverses Gespräch über die Problematik der Autorität eines Lehrers zwischen den beiden entfacht. Der ,,emeritierte Gymnasialdirektor, Senior des Kreises" (S.44, Z.31 f.) Distelkamp sehnt sich nach alten Zeiten (,,Ja Schmidt, das waren Zeiten, da verlohnte sich's, ein Lehrer und ein Direktor zu sein" S.49, Z.10 ff.), zu denen die Schüler noch in Angst und Ehrfurcht vor dem Lehrer erstarrten. Im Gegensatz hierzu vertritt Schmidt einen ganz anderen Standpunkt. Er widerspricht Distelkamp vehement, ,,Nur die reelle Macht des wirklichen Wissens und Könnens" (S.50, Z.33 f.) dürfe Autorität beanspruchen, ja er macht sich sogar über die Perückengelehrsamkeit lustig und führt sogar an, die stupende Wichtigkeit, mit der diese sich gebe, könne sie nur noch erheitern (S.49, Z.34 f.).
Letztlich hält Schmidt ein wahres Plädoyer auf die neue Zeit (S.51, Z.7 ff.).
Aus dieser angeregten Diskussion lassen sich die unterschiedlichen Stellungen der beiden innerhalb des Kreises der Sieben Waisen ablesen. Distelkamp verkörpert die alte Zeit und damit eine in meinen Augen falsche Autorität. Schmidt tritt als Vertreter der neuen Zeit als Distelkamps Gegenpol auf, der seiner wahre Autorität während der Diskussion sehr vernünftig und realistisch darstellen und untermauern kann. Im Gegensatz zu Distelkamp geht Schmidt sogar auf seinen Diskussionspartner ein, und sucht nach Gründen, die diesen wohl zu einer solchen Einstellung haben leiten können: ,,Weil du von den alten Anschauungen nicht los willst. Du kannst dir nicht vorstellen, dass jemand, der Tüten geklebt und Rosinen verkauft hat, den alten Priamus ausbuddelt, und kommt er nun gar ins Agamemnonsche hinein und sucht nach dem Schädelriss, aegisthschen Angedenkens, so gerätst du in helle Empörung." (S.51, Z. 22ff.)
Doch auch wenn Schmidt sich in Distelkamps Gedankengänge hineinversetzt, kann er diesen nicht zustimmen: ,,Aber ich kann mir nicht helfen, du hast Unrecht. Freilich, man muss was leisten, hic Rhodus, hic salta; aber wer springen kann, der springt, gleichviel ob er's aus der Georgia Augusta oder aus der Klippschule hat" (S.51, Z.27 ff.). Hier wird gleichzeitig Schmidts Leistungsprinzip deutlich.
Zu einer Einigung der beiden kommt es verständlicherweise nicht.
Mit dem 7. Kapitel beginnt der gesellige Teil des Abends.
Mit einer scheinheiligen Ausrede trifft der überaus verspätete Friedeberg ein.
Während die vier verbliebenen ,,Waisen" auf das Abendessen warten, gibt Schmidt eine Geschichtsphilosophie zum Besten, in der er die tiefere Bedeutung des Nebensächlichen mit seinem poetischen Realismus darlegt: ,,Das Nebensächliche, so viel ist richtig, gilt nichts, wenn es bloß nebensächlich ist, wenn nichts drinsteckt. Steckt aber was drin, dann ist es die Hauptsache, denn es gibt einem dann immer das eigentlich Menschliche." (S.56, Z.28 ff.)
Schließlich tritt Schmidts Tochter Corinna mit ihrem Cousin Marcell ein, die soeben vom Diner Jenny Treibels, Schmidts Jugendfreundin, wiederkehren.
Diese aufeinander folgenden Abendessen stellen Gegensätze dar. Während Schmidts ,,Kränzchen" der politischen Diskussion dient und die Bildung präsentiert, verkörpert das ,,Diner" Jenny Treibels den Luxus und der Präsentation höflicher Umgangsformen, die scheinheilig das Ansehen steigern sollen.
Während Corinna sich zurückzieht, gesellt sich Marcell zur Gesellschaft.
Gegen Ende des Krebsessens wird deutlich, dass sehr wohl auch Schmidt auf sein Ansehen achtet. Er möchte jedoch nicht aufgrund von Reichtum, wie es bei Jenny Treibel der Fall ist, sondern aufgrund von Charakter angesehen werden. So hat Schmidt auch genügend Selbstbewusstsein, eine positive Eigencharakteristik von sich zu geben (S.59, Z.13 ff.).
Auch das Selbstbewusstsein der anderen ,,Waisen" scheint aufgrund ihrer Zustimmung gut zu sein. Sie stellen sich hiermit eindeutig über das reiche Besitzbürgertum (S.59, Z.10 ff.).
Dieses Verhalten halte ich jedoch absolut für gerechtfertig, vielmehr sogar für sehr klug. Die Sieben Waisen waren mit dieser Einstellung sicherlich ihrer Zeit voraus und Personen wie Jenny Treibel überlegen.
Bereits im zweiten Kapitel befragte Jenny den Spiegel, ,,ob sie sich neben ihrer Hamburger Schwiegertochter auch werde behaupten können" (S.12, Z.10 ff.).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Auszug "Der Abend des Professors (S.44-60)"?
Der Text ist ein Auszug aus Theodor Fontanes Roman "Frau Jenny Treibel", speziell der Abend bei Professor Willibald Schmidt. Er befasst sich mit dem Bürgertum des 19. Jahrhunderts und der kritischen Darstellung der gesellschaftlichen Realität durch Fontane.
Wer ist Professor Willibald Schmidt?
Professor Willibald Schmidt gehört dem Bildungsbürgertum Berlins an. Er legt keinen Wert auf Besitz und Ansehen, sondern belächelt die luxusorientierte Bourgeoisie.
Wer sind die "Sieben Waisen Griechenlands"?
Die "Sieben Waisen Griechenlands" sind ein Kreis von Gymnasiallehrern, die sich selbstironisch so nennen und sich wöchentlich zu Gesprächen und Abendessen treffen. Zu ihnen gehören Schmidt, Rindfleisch, Hannibal Kuh, Immanuel Schultze, Dieselkamp, Friedeberg und Dr. Charles Etienne.
Welche unterschiedlichen Meinungen werden im Text dargestellt?
Der Text stellt vor allem die unterschiedlichen Ansichten von Distelkamp, einem emeritierten Gymnasialdirektor, und Professor Schmidt über die Autorität von Lehrern dar. Distelkamp sehnt sich nach alten Zeiten zurück, in denen Schüler Ehrfurcht vor Lehrern hatten, während Schmidt die "reelle Macht des wirklichen Wissens und Könnens" als Grundlage von Autorität sieht.
Was ist die Bedeutung des Nebensächlichen laut Schmidt?
Schmidt vertritt eine Geschichtsphilosophie, in der er die tiefere Bedeutung des Nebensächlichen betont. Er sagt: "Das Nebensächliche, so viel ist richtig, gilt nichts, wenn es bloß nebensächlich ist, wenn nichts drinsteckt. Steckt aber was drin, dann ist es die Hauptsache, denn es gibt einem dann immer das eigentlich Menschliche."
In welchem Verhältnis steht das Abendessen bei Schmidt zum Diner bei Jenny Treibel?
Die beiden Abendessen stehen im Gegensatz zueinander. Schmidts "Kränzchen" dient der politischen Diskussion und Bildung, während das "Diner" bei Jenny Treibel den Luxus und die Präsentation höflicher Umgangsformen verkörpert, die scheinheilig das Ansehen steigern sollen.
Welche Parallelen werden zum Märchen "Schneewittchen" gezogen?
Es werden Parallelen zwischen Jenny Treibel und der bösen Schwiegermutter sowie zwischen den "Sieben Waisen Griechenlands" und den sieben Zwergen gezogen. Die Waisen leben in ihrer eigenen Welt, abgeschottet vom Rest der Welt, ähnlich wie die Zwerge hinter den sieben Bergen.
- Citar trabajo
- Tatjana Bendig (Autor), 2001, Fontane, Theodor - Frau Jenny Treibel - Abend der 7 Waisen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100658