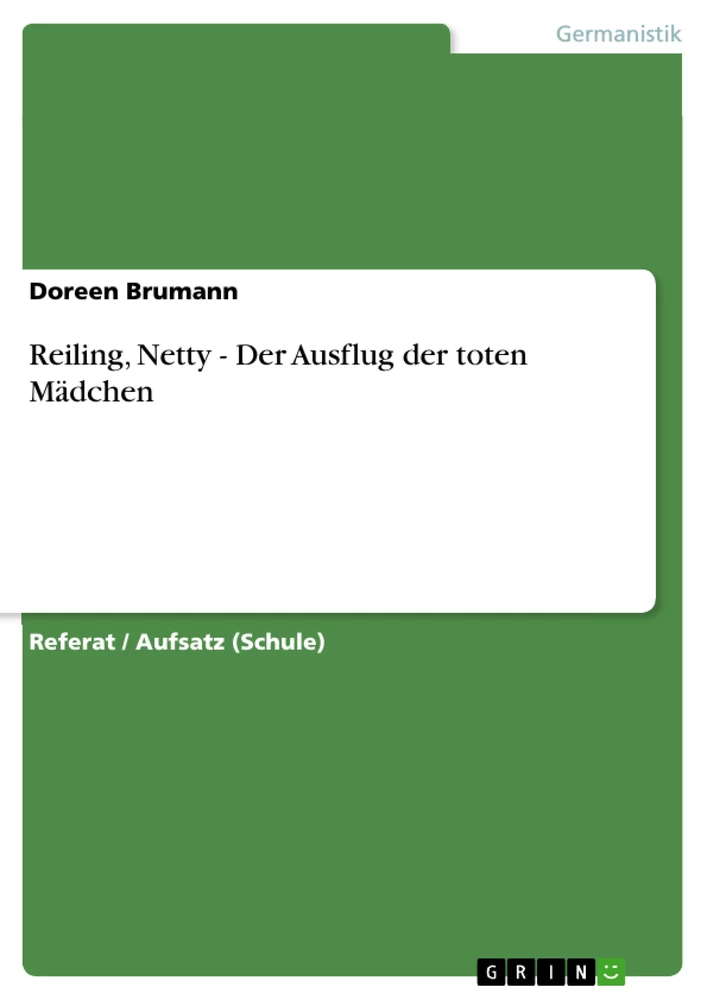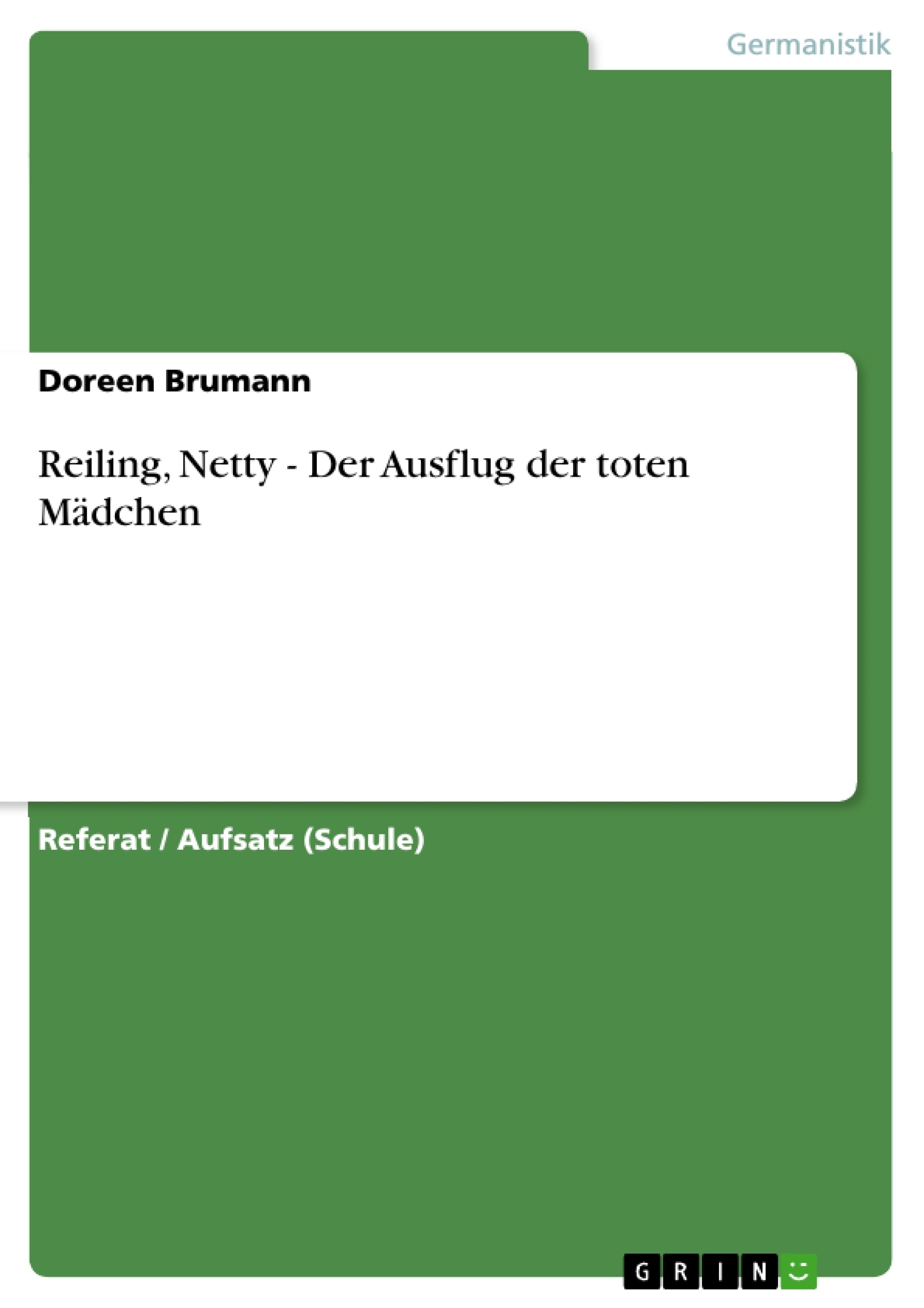Was bleibt von einer Jugend, die im Schatten des aufkeimenden Nationalsozialismus verblasst? Anna Seghers' tiefgründige Erzählung entführt uns in eine Zeit des Umbruchs, in der die Unschuld einer Schulklasse auf einem Ausflug unaufhaltsam von den dunklen Vorboten des Krieges eingeholt wird. Durch die Augen der Ich-Erzählerin, die sich in der mexikanischen Hitze plötzlich in ihre Mainzer Kindheit zurückversetzt sieht, erleben wir ein Wiedersehen mit Freundinnen, Lehrerinnen und den kleinen, unbedeutenden Momenten, die das Leben ausmachen. Doch unter der Oberfläche der idyllischen Erinnerung lauern Verrat, Verfolgung und der unausweichliche Verlust. Wer bewahrt Haltung angesichts der drohenden Katastrophe, wer wird zum Mitläufer, wer gar zum Täter? Seghers' meisterhafte Sprache zeichnet ein erschütterndes Bild der Zerrissenheit einer Gesellschaft, in der Freundschaften zerbrechen und Ideologien die Menschlichkeit vergiften. "Der Ausflug der toten Mädchen" ist mehr als nur eine nostalgische Reise in die Vergangenheit; es ist eine eindringliche Mahnung, die fragt, wie wir uns in Zeiten der Krise entscheiden – und welche Konsequenzen unsere Entscheidungen haben. Eine zeitlose Erzählung über Schuld, Verantwortung und die unzerstörbare Kraft der Erinnerung, die den Leser noch lange nach der letzten Seite nicht loslässt. Ein literarisches Kleinod, das die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts auf bewegende Weise lebendig werden lässt und zum Nachdenken über die ewige Frage der Menschlichkeit anregt. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Vergangenheit zur Gegenwart wird und die Schatten der Geschichte bis in die heutige Zeit reichen. Eine bewegende Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, Exil-Erfahrung und der Frage nach Identität und Erinnerung. Eine tiefgründige Erzählung über Freundschaft, Verrat und die Suche nach Gerechtigkeit in einer Zeit des Umbruchs, die jeden Leser aufwühlt und lange im Gedächtnis bleibt.
Gliederung
1.Biographie
2.Personen der Handlung
3.Inhalt
4.Formmerkmale und Sprache
5.Leserobe
1.Biografie
- 19.11.1900 Netty Reiling als einziges Kind von Hedwig und Isodor Reiling in Mainz geboren
- war als Kind oft krank à lernt sehr früh lesen und schreiben und erfindet zu Abziehbildern Geschichten
- 1920 Studium in Heidelberg
- 1933 alle Bücher von Anna Seghers verbrannt à Flucht nach FR über die Schweiz
- 1940 Flucht aus Paris in den unbesetzten Süden FR, Tod des Vaters
- 1941 Verlassen FR über Marseille; 16.06 Ankunft auf Ellis Island in New York, Weiterreise nach Mexiko
- 1943 Tod der Mutter in Auschwitz; von einen unbekannten Auto angefahren und schwer verletzt à schwere Kopfverletzungen mit Bewusstlosigkeit, Amnesie und Verletzung der Augennerven è „Ausflug der toten Mädchen“ literarische Bewältigung ihrer Krankheitsgeschichte à Zusammenhang zwischen dem Symptom „Amnesie für Vorgänge des früheren Lebens“
- 1944 Abschluss „Der Ausflug der toten Mädchen“
- 1946 Veröffentlichung in New York
- 1947 Heimkehr nach Berlin
- 01.06.1983 Tod in Berlin
2. Personen der Handlung
- positive und negative Figuren
- positiv: Erzählerin, Leni , Fräulein Mees, Liese Möbius, Gerda und Lore à trotz der vom Nationalsozialismus hervorgerufenen radikalen Veränderungen machen diese Charaktere keine innerlichen Veränderungen durch, üben keinen Selbstverrat, sondern bleiben der „Spur von Gerechtigkeit“ treu à diese positive Unveränderlichkeit zeigt in der Erzählung die häufige Wiederholung des Zeitadverbs „immer“ an Leni:
- Charakter entschlossen, etwas energischer Ausdruck den sie von klein auf bei allen schwierigen Unternehmungen annahm à bleibt gleich
- sie behält ihn als ständiges Merkmal auch während des antinazistischen Widerstandes bei und noch „als man sie im Frauenkonzentrationslager im zweiten Winter dieses Krieges langsam verhungern liess
- ihren Charakter bewahrt sich vielleicht sogar über ihren Tod mit ihrer kleinen
Tochter welche zur Zwangserziehung abgeholt wird
Fräulein Mees und Liese Möbius:
- schöpfen Kraft und Autonomie aus ihrem religiösen Glauben
- Fräulein Mees die ihr Brustkreuz wie ein Wahrzeichen trägt immer
gleichbleibende Haltung, der auch die Vorladung vor das von Hitler in Szene gesetzte Volksgericht mit Androhung von Gefängnis nichts anhaben konnte
- Liese ist sich treu geblieben bis zu ihrem Tod beim englischen Fliegerangriff
Gerda:
- Inbegriff der traditionellen weiblichen Demut und zur Krankenpflege und
Menschenliebe geboren
- folgt ihrem Mann nicht, sondern bleibt ihren Zielen treu
Lore:
- häusliche Begabungen
- ein verärgerter Naziliebhaber hatte sie, da ihre Untreue Rassenschande hieß, mit Konzentrationslager bedroht
- negative Charaktere: Nora, Ida, Else, Elli, Katharina u. vorallem Marianne
- fehlende Kraft und Selbstständigkeit
- sie sind schwach, beugen sich den kollektiven Normen eines starken Staates oder ordnen sich den Entscheidungen ihrer Männer unter, ohne hinterfragen zu können
- im Gegensatz zur ersten Gruppe gehören zu ihren Merkmalen Untreue u. Verrat
- das „immer“ was in der 1. Gruppe positive Konstanz markierte, signalisiert
hier das Fortdauern negativer Eigenschaften oder wird nach neg.
Veränderungen durch „später“ ersetzt
Nora u. Ida:
- neg. Gegenstück zu Gerda u. Lore
- zur Zeit des Ausflugs erweist Nora ihrer Lieblingslehrerin „Gefälligkeit und Bereitschaft“, hatte dies später bereut, als „Leiterin der nationalsozialistischen Frauenschaft unserer Stadt“
- Mangels einer gefestigten Persönlichkeit steht sie immer auf der Seite der Stärkeren
- à später jagt sie die schon greisenhaft gewordene Lehrerin „mit groben Worten“ von einer Bank, „weil sie auf einer judenfreien Bank sitzen wollte“
- Ida führte lockeres Leben, verliert ihren Verlobten vor Verdun und widmet sich von da an der Krankenpflege
- Inzwischen „Funktionärin bei den nationalsozialistischen Krankenschwestern“, ist ihr Leben vom „Wunsch nach Rache“ bestimmt
- Gefühle während des 2.WK Gefühle immer noch vorhanden
- Animiert die jungen Pflegerinnen die Kriegsgefangenen nicht mit falschen Mitleid zu pflegen
Marianne:
- zweite große Jugendfreundin der Erzählerin neben Leni
- ohne ausgeprägte Persönlichkeit von ihren Mann geformt, an dessen Seite sie lebt
- völlige Ergebenheit, Ausdruck ewiger Treue à Verrat von Gerechtigkeit
- absolute Hingabe gilt zunächst Otto Fresenius, der im 1.WK ums Leben kommt später ihrem Mann Gustav Liebig (SS- Sturmbandführer in der Stadt)
- verweigert ihrer Freundin Leni ihre Hilfe
3. Inhalt
Die Autorin Anna Seghers bezieht sich durch die Ich- Form in den Hergang der Geschichte ein und gibt damit eine Auskunft ihrer Jugend und das Exil. In dieser Geschichte ruft Anna Seghers ihren ursprünglichen Namen zu Hilfe um sich in ihre Jugend zu versetzen. Die Ich- Erzählerin befindet sich in Mexiko und unternimmt in der Mittagsglut einen Ausflug. In einem Zustand von „Müdigkeit“, die alles vernebelte, verwandelt sich die öde und kahle mexikanische Landschaft in eine üppige, grüne Rheinlandschaft. Dort überwältigt sie eine Kindererinnerung: die Dampferfahrt ihrer Schulklasse zu einem Ausflugsort bei Mainz kurz vor dem 1.WK. Sie ist mit ihren Freundinnen Marianne und Leni - drei Hauptfiguren der Erzählung - an der Schaukel, danach mit Mitschülerinnen und Lehrerinnen an der Kaffeetafel vereint, erlebt die Begegnung mit einer Jungenklasse und deren Lehrern, anschließend die Heimfahrt und den Weg nach Hause durch Mainz. Als sie in die Wohnung eilen will, verschwindet das Traumbild.
Am Schicksal von Frauen und Männern wird der verhängnisvolle Verlauf der deutschen Geschichte vor Augen geführt. Bei einem Ausflug zeigt sich, wie die Menschen unter normalen Umständen miteinander umgehen. Dabei treten Eigenschaften auf wie sie sich dann in der Nazizeit verhalten: zu Freunden u. Bekannten. Diese Gegenüberstellung der Jugend und des Erwachsen, bzw. Rück- und Vorausschau gibt Aufschluss über ihre Stärken u. Schwächen. Dabei wird ein politisches System entlarvt, dem Brutalität zugrunde liegt und welches Angst erzeugt. Obwohl alle Mädchen unterschiedliche Lebenswege einschlagen sterben alle während des 2.WK oder kurz zuvor eines gewaltsamen Todes.
4. Sprache und Formmerkmale
- Stück kann man in 5 Akte teilen à Arbeitsblatt
- Widerstreit der Gefühle, der aus Traumerleben, Ahnung und Wissen herrührt erzeugt Spannung
- Vergleiche Fremdheit und Starre - Geborgenheit und Frische
- Erzählung im Präteritum/Imperfekt geschrieben, dem Tempus/Zeitform der Erinnerung
- Künftiges mit Futur und Konjunktiv, aber auch
Plusquamperfekt/Vorvergangenheit, was den Eindruck des Unwiederbringlichen hervorruft
- Rahmen- und Binnenerzählung fließend à bei Stichwörtern (am Anfang: Heimfahrt, am Schluss: Mutter)
- Vollzieht sich mit dem Motiv von Müdigkeit, Wolke, Dunst u. Nebel über Darstellung von Sinnesempfindungen: Grünes sehen u. riechen, Knarren der
Schaukel und Namen hören, Zöpfe greifen, Schreie von Truthähnen hören
- Name = Zauberwort, beschwört verlorenes Ich u. löst Strom von Gedanken aus
- Keine völlige Identität mit Kind, Wissen u. Erfahrung verschwinden nicht
- Zum Schluss bleibt Mensch der nicht aufgibt à will in die Heimat zurück
5. Leseprobe
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Biografie von Anna Seghers?
Anna Seghers, geboren am 19.11.1900 in Mainz, war das einzige Kind von Hedwig und Isidor Reiling. Schon als Kind lernte sie früh lesen und schreiben. Sie studierte ab 1920 in Heidelberg. 1933 wurden ihre Bücher verbrannt, woraufhin sie über die Schweiz nach Frankreich floh. 1940 floh sie aus Paris und 1941 über Marseille nach New York und dann nach Mexiko. 1943 starb ihre Mutter in Auschwitz und sie wurde bei einem Autounfall schwer verletzt, was zur literarischen Bewältigung ihrer Krankheitsgeschichte im "Ausflug der toten Mädchen" führte. 1946 wurde das Werk in New York veröffentlicht. 1947 kehrte sie nach Berlin zurück und starb dort am 01.06.1983.
Wer sind die positiven und negativen Figuren in der Handlung?
Zu den positiven Figuren gehören die Erzählerin, Leni, Fräulein Mees, Liese Möbius, Gerda und Lore. Sie bleiben trotz des Nationalsozialismus ihren Werten treu. Zu den negativen Figuren zählen Nora, Ida, Else, Elli, Katharina und vor allem Marianne. Ihnen fehlt Kraft und Selbstständigkeit, und sie passen sich den Normen des Staates an oder verraten ihre Überzeugungen.
Wie werden die positiven und negativen Charaktere sprachlich unterschieden?
Das Zeitadverb "immer" markiert bei den positiven Charakteren deren Konstanz und Unveränderlichkeit. Bei den negativen Charakteren signalisiert "immer" das Fortdauern negativer Eigenschaften oder wird durch "später" nach negativen Veränderungen ersetzt.
Was ist der Inhalt der Erzählung "Der Ausflug der toten Mädchen"?
Die Erzählung handelt von Anna Seghers' Kindheitserinnerung an einen Klassenausflug kurz vor dem Ersten Weltkrieg. In Mexiko erinnert sich die Ich-Erzählerin an diese Zeit in Mainz und die Schicksale der Frauen und Männer, die im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg starben oder sich veränderten. Die Geschichte zeigt, wie sich Menschen unter normalen Umständen verhalten und wie sich diese Verhaltensweisen in der Nazizeit widerspiegeln.
Welche Formmerkmale und sprachlichen Elemente prägen die Erzählung?
Die Erzählung kann in 5 Akte geteilt werden. Sie ist im Präteritum/Imperfekt geschrieben, der Zeitform der Erinnerung, wobei Futur und Konjunktiv sowie Plusquamperfekt den Eindruck des Unwiederbringlichen erzeugen. Rahmen- und Binnenerzählung gehen fließend ineinander über, besonders bei Stichwörtern wie "Heimfahrt" und "Mutter". Motive wie Müdigkeit, Wolke, Dunst und Nebel werden durch Sinnesempfindungen wie Sehen, Riechen und Hören verstärkt. Der Name der Erzählerin wirkt als Zauberwort, das verlorene Erinnerungen hervorruft.
Was symbolisieren die Namen der Personen in der Geschichte?
Die Namen der Figuren sind mit bestimmten Eigenschaften und Verhaltensweisen verbunden. Positive Charaktere bleiben ihren Werten treu, während negative Charaktere Verrat und Anpassung an den Nationalsozialismus zeigen. Die Namen tragen zur Charakterisierung bei und verdeutlichen die ideologischen Konflikte der Zeit.
- Quote paper
- Doreen Brumann (Author), 2001, Reiling, Netty - Der Ausflug der toten Mädchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100649