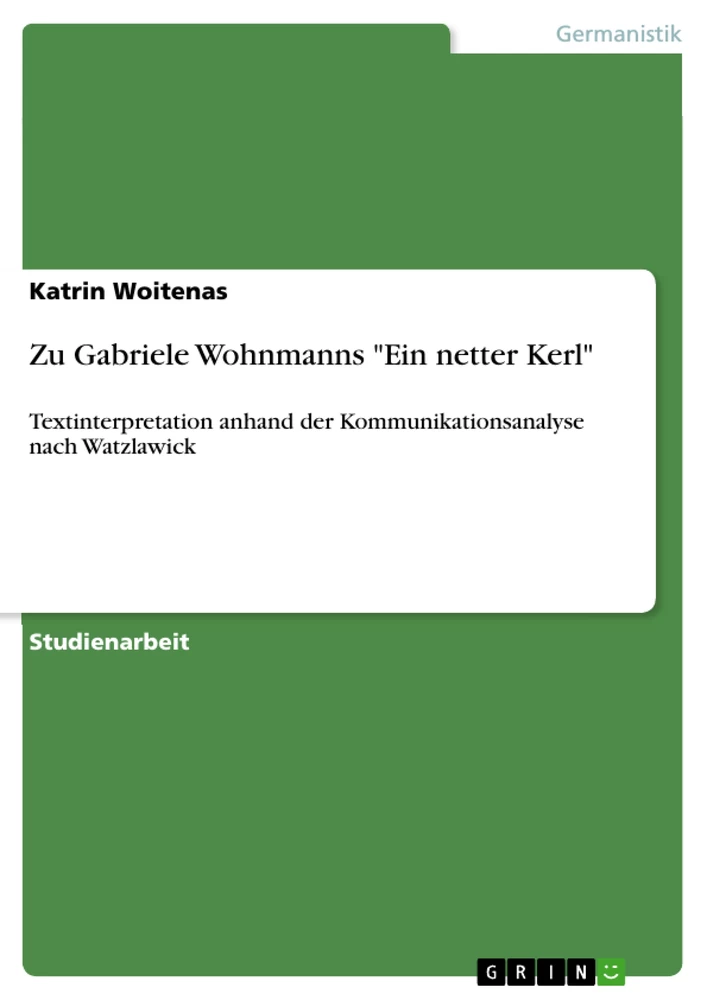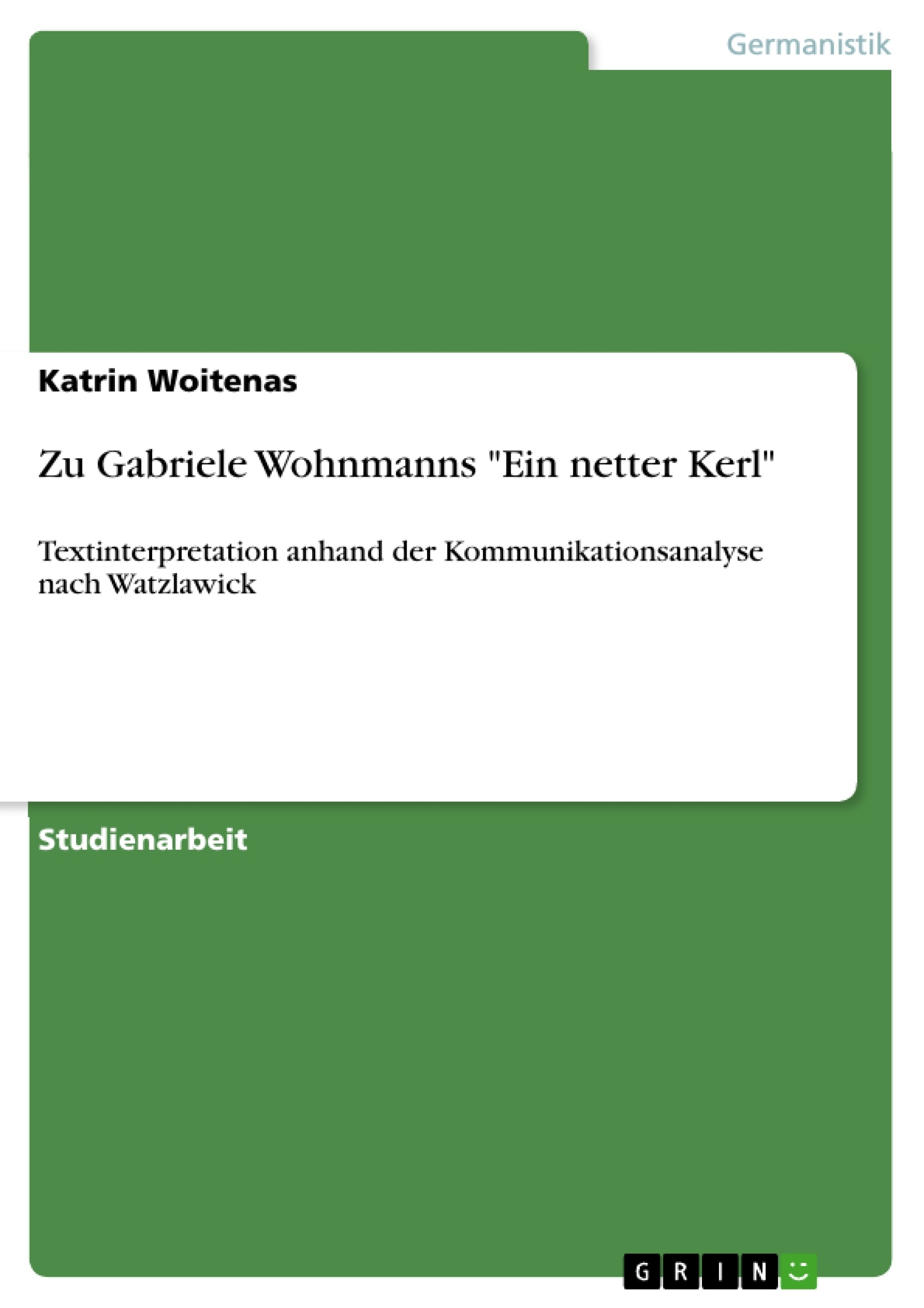Ein harmloser Besuch kann zum Minenfeld werden, besonders wenn es um die Liebe geht. In Gabriele Wohnmanns messerscharfer Kurzgeschichte "Ein netter Kerl" entlarvt sich die Fassade bürgerlicher Konventionen innerhalb einer Familie auf erschreckend komische Weise. Was als oberflächliche Lästerei über Ritas neuen Freund beginnt, entfaltet sich zu einem Psychogramm individueller Befindlichkeiten und verdeckter Rivalitäten. Die spöttischen Kommentare der Mutter und die zynischen Einwürfe der Schwester Nanni, die sich in Häme ergießt, treffen Rita ins Mark, während der Vater und die andere Schwester, Milene, zwischen Distanz und zaghafter Anteilnahme schwanken. Doch als Rita überraschend ihre Verlobung verkündet, kehrt sich das Blatt auf dramatische Weise. Plötzlich überschlagen sich die Familienmitglieder mit wohlmeinenden Ratschlägen und überschwänglichen Glückwünschen, die jedoch den bitteren Nachgeschmack der vorherigen Abfälligkeiten kaum überdecken können. Die Geschichte ist eine brillante Studie über Scheinheiligkeit, Kommunikationsmuster und die Schwierigkeit, in einer Familie wirklich gehört und verstanden zu werden. Sie wirft ein grelles Licht auf die Dynamik zwischenmenschlicher Beziehungen, auf die Diskrepanz zwischen Worten und Taten und auf die oft schmerzhafte Erkenntnis, dass die engsten Vertrauten zu den größten Kritikern werden können. Der Leser wird unweigerlich dazu angeregt, über eigene Erfahrungen mit Familie, Vorurteilen und der Suche nach Anerkennung nachzudenken. "Ein netter Kerl" ist ein literarisches Juwel, das mit feinem Gespür für Ironie und psychologischer Tiefe die Abgründe des Familienlebens auslotet und dabei den Leser bis zum Schluss in Atem hält. Eine perfekte Lektüre für alle, die sich für moderne Literatur, Gesellschaftskritik und die komplexen Facetten menschlicher Beziehungen interessieren. Die Geschichte bietet reichlich Gesprächsstoff und regt zur Auseinandersetzung mit Themen wie Verlobung, Familie, Kommunikation und Vorurteilen an.
Gabriele Wohnmann: "Ein netter Kerl"
Zur Gliederung der Erzählung lassen sich zwei große Abschnitte bestimmen: Zeile 1 bis Zeile 34 und Zeile 35 bis Schluß.
Der erste Abschnitt hat die Person des „netten Kerls“ zum Thema, den Rita der Familie vorgestellt hat. Die Familienmitglieder ziehen mit Beleidigungen und Verunglimpfungen über ihn her. Der Abschnitt endet mit Nannis Frage: „Wann kommt die große fette Qualle denn wieder, sag, Rita, wann denn?“ Die Spannung erreicht mit dem erwartungsvollen Schweigen der Familie ihren Höhepunkt, wodurch auch deutlich der Einschnitt markiert wird.
Der zweite Abschnitt beginnt mit Ritas Eröffnung, dass sie mit dem netten Kerl verlobt sei. In Anbetracht der veränderten Situation versucht nun jeder den zuvor verspotteten in ein positiveres Licht zu rücken. Da wir es hier mit einer Kurzgeschichte zu tun haben, fehlt eine Einleitung; wir werden sogleich mit dem Gesprächsthema (der „nette Kerl“) konfrontiert.
Die Absichten der einzelnen Gesprächsteilnehmer unterscheiden sich zum Teil grundsätzlich. Nannis Intention besteht vor allem darin, Lachen zu provozieren. Interessant ist jedoch, dass es ihr nicht gelingt, dieses bei den anderen hervorzurufen.,obwohl sie selbst den ganzen ersten Abschnitt über lacht. In ihrem Verhalten gibt sie auch eine Selbstdarstellung ab. Sie äußert sich ausschließlich in lautstarker, aufdringlicher Form und versucht so sich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu drängen (das Verb „rufen“ begleitet vier der insgesamt fünf Gesprächsbeiträge; Zeile 1; Zeile 7; Zeile 12 und Zeile 20). Obwohl während des Gesprächs durchgehend Umgangssprache verwandt wird, hebt sich Nannis Ausdrucksweise deutlich hiervon ab. In sehr bildreichen, oft übertriebenen Worten zeichnet sie das Bild des Mannes unter sehr oberflächlichen Gesichtspunkten ( z.B. „entsetzlich“ Zeile 2; „weich wie ein Molch, wie Schlamm“ Zeile 6/ 7). Ihre nonverbalen und paraverbalen Äußerungen verstärken dieses Verhalten. Dies wird besonders in Zeile17 /18 deutlich. Mit ihrem Einwurf, der Nannis Beschimpfungen den Boden entzieht, ist für sie die Bedrohung verbunden, nicht mehr im Mittelpunkt des Gesprächs zu stehen. Die benötigte Aufmerksamkeit versucht sie durch das folgende paraverbale Mittel wieder herzustellen ( „..und warf die Hände auf den Tisch: die Messer und gabeln auf den Tellern klirrten.“). Kennzeichnend für Nannis Selbstdarstellung ist ihr Egoismus. Um Aufmerksamkeit zu erlangen ist ihr jedes Mittel recht; sie beschimpft einen Menschen, von dem sie so gut wie nichts weiß und bemerkt nicht, wie sie damit Ritas Gefühle verletzt.
Die Mutter schlägt – mehr oder weniger – in dieselbe Kerbe („Furchtbar fett für sein Alter“ Zeile 3). Obwohl auch sie negativ besetzte Worte benutzt, fallen ihre Äußerungen weniger drastisch aus als bei Nanni. Dies resultiert vermutlich daraus, dass sie sich gesellschaftlichen Konventionen verpflichtet fühlt (man spricht nicht schlecht über Menschen in deren Abwesenheit) und sich sehr wohl ihrer Vorbildrolle bewußt ist. Darauf deutet auch das Adjektiv „beschämt“ in Zeile 10 hin. Zwar würde sie gerne, wie Nanni offen über den „netten Kerl“ herziehen, kann dies jedoch im Hinblick auf ihre Vorbildfunktion nicht in vollem Umfang tun. Darum ist auch ihre Ausdrucksweise geprägt von diesen beiden sich widersprechenden Intentionen; z.B. verknüpft sie positive mit negativen Beurteilungen ( Zeile 10/ 11: „“recht lieb, aber gräßlich komisch“). Außerdem benutzt sie Relativierungen und Verlegenheitsfloskeln um ihre Kritik abzuschwächen (Zeile 3: „...für sein Alter“ – Abschwächung; Zeile 3 „sollte“ – Konjunktiv rückt den Sachverhalt in den Bereich des Fiktiven; Zeile 10 „na ja“, anstelle von einwandfreier Zustimmung).
Zu Mutter und Nanni:
Zusammenfassend kann man sagen, dass beide die ganze Situation sehr oberflächlich betrachten und ein hohes Maß an Egoismus zeigen; die Gefühle Ritas scheinen ihnen entweder egal zu sein, oder aber sie stehen sich nicht nahe genug (bzw. sind zu unsensibel), Ritas Gefühle zu erkennen. Beide bringen keinerlei Sachinformationen vor, sondern beschränken sich auf eine eher inhaltslose Kommentierung.
Milene erscheint hier als die Verständnisvollste. Sie scheint die einzige zu sein, der Ritas Gemütsverfassung nicht entgangen ist. Sie äußert sich als einzige positiv über den netten Kerl, was ihr selbst komisch vorkommt (Zeile 16). Hier wird deutlich, wie sie im Verlauf des Gesprächs von den anderen beeinflußt wird. Dies geht soweit, dass sie In Zeile 24 in das allgemeine Lachen einstimmt.
Der Vater wird im ersten Abschnitt nur nonverbal, bzw., mit indirekter Rede eingeführt. Wie Rita trägt er im ersten Abschnitt sehr wenig zum Gespräch bei. Bezeichnend für seine Charakterisierung und Intentionen ist jedoch das zweimalige auftauchen des Adjektivs
„ängstlich“ (Zeile22). Dies kann man so interpretieren, dass er sich nicht traut, gegen die allgemeine Einstellung seine Meinung offenzulegen, andererseits aber auch so, dass er ängstlich darauf bedacht ist, niemandes Gefühle zu verletzen. Er erscheint als der distanzierte, Überlegte („..brachte kühle, nasse Luft mit herein“ Zeile 21). Die zweite Einschätzung erscheint um so wahrscheinlicher, als er im zweiten Abschnitt sogleich Partei für den Mann ergreift, nachdem er sich erst ein Bild über die gesamte Situation verschafft hat. Er ist der einzige, der Rita nicht mit seinen Äußerungen verletzt.
Rita kommt hier eine Doppelrolle zu. Während sie sich im ersten Abschnitt kaum am Gespräch beteiligt und durch nonverbale Mittel signalisiert, wie unwohl sie sich in der Gesprächssituation fühlt, und damit auch ihre Unsicherheit zu erkennen gibt (Zeile5; Zeile15; Zeile24) ändert sich dies im zweiten Abschnitt radikal.
Mit Ritas Verhalten nähern wir uns nun dem Aufbau der Gesprächssituation: zu Anfang haben wir ein komplementäres Verhältnis. Nanni bestreitet den Großteil des Gesprächs, unterstützt von der Mutter. Mit ihren Fragen drängen sie Rita in die inferiore Position; dies signalisiert Rita vor allem durch ihre Körperhaltung; das Festhalten am Stuhl (Zeile 5; Zeile15) weist darauf hin, dass sie Halt sucht, Unterstützung in der unangenehmen Situation. Da ihr diese jedoch nicht gewährt wird, kann man an den nonverbalen Mitteln nachvollziehen, wie die Spannung in Rita immer mehr wächst, bis sie sich Luft machen muß. Aufbau: am Sitz festhalten – die Fingerkuppen ins Holz pressen, schwitzen. Mit dem allgemeinen Gelächter bricht Ritas Selbstbeherrschung zusammen und sie beendet das komplementäre Verhältnis. Bemerkenswert ist hier, das sie dies nicht tut, indem sie sich auf eine Ebene mit dem Rest der Familie stellt (also ein symmetrisches Verhältnis anstrebt), sondern vielmehr die ganze Situation umkehrt. Nun übernimmt sie die Gesprächsführung und damit die superiore Position; diese wird unterstrichen durch nonverbale Mittel (Zeile 35: „Sie hielt den Kopf aufrecht.“). Die Gesprächssituation „kippt“; d.h. die Verhaltensmuster werden umgekehrt. Rita karikiert Nannis Stil, indem sie mit den gleichen paraverbalen Mitteln, ja sogar den gleichen Worten, ihre Verunglimpfungen nachahmt.
Daraufhin entsteht eine Pause, sie sitzen „gesittet und ernst“ (Zeile 36). Erst an dieser Stelle wird der Familie ihr Verhalten klar: das Verstoßen gegen gesellschaftliche Anstandsregeln sowohl wie Ritas verletzte Gefühle. Hierauf schlüpft die Mutter wieder in ihre Vorbildposition, indem sie versucht, den „netten Kerl“ in ein positives Licht zu rücken. Diese Versuche wirken jedoch, rückblickend auf den vorangegangenen Dialog , relativ
unglaubwürdig. Glaubwürdiger erscheint daher der Vater, der sich vorher nicht zum Sachverhalt geäußert hat.
Der Schluß des Gesprächs kann – um mit den Worten des Textes zu sprechen – als Ruhe vor dem Sturm bezeichnet werden. Es ist anzunehmen, dass sobald Rita nicht mehr im Raum ist, die Diskussion erneut aufflammen wird, wobei jeder sein Unverständnis über Ritas Entscheidung kund tun wird. Die Abneigung der Familie gegen den Schwiegersohn wird so auch in Zukunft aller Voraussicht nach zu Problemen führen.
Schematische und tabellarische Darstellungen:
Paraverbale und nonverbale Mittel:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kommunikationsverlauf:
- Nanni eröffnet das Gespräch, indem sie es mit einer Beleidigung beginnt
- Die Mutter bestätigt sie hierin indirekt und wendet sich mit einer Frage direkt an Rita
- Nonverbales Element zeigt Ritas Gefühlslage
- Kurze Antwort Ritas
- Nanni knüpft an ihre Einleitung an
- Gegensatz zwischen Nannis Heiterkeit und Ritas Verletztheit durch nonverbale Einschübe
- Einwurf Milenes zur Verteidigung des „netten Kerls“
- Nonverbaler Einwurf der Mißbilligung von Nanni
- Zynische Kommentierung des Einwurfes
- Heimkehr des Vaters; indirekte Rede, kein direktes Eingreifen in den Kommunikationsverlauf
- Erster sachlicher Einwurf Ritas
- Lachen der anderen
- Rita fühlt sich zunehmend unwohler; nonverbaler Einwurf
- Erneuter Versuch Ritas, das Gespräch auf die Inhaltsebene zu bringen
- Scheitern des Versuchs durch Lachen der anderen
- Mutter versucht schlichtend einzugreifen und das Thema zu beenden
- Nanni jedoch hält mit ihrer Frage an Rita, an dem Thema fest
An dieser Stelle ändert sich die Gesprächssituation. Rita übernimmt die superiore Position, die zuvor Nanni innehatte.
- Rita bezieht Stellung und macht Mitteilung über die Verlobung
- Nonverbale Reaktion der anderen; Entsetzen, Überraschung
- Ironische Wiederholung von Nannis Aussagen
- Kommentar des Vaters; positiv belegt
- Kommentar der Mutter; ebenfalls positiv belegt
- Bestätigung und Ergänzung durch den Vater
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Gabriele Wohnmanns "Ein netter Kerl"?
Die Erzählung gliedert sich in zwei Hauptabschnitte: Zuerst geht es um die negative Beurteilung eines Mannes, den Rita ihrer Familie vorgestellt hat. Der zweite Abschnitt beginnt mit Ritas Verlobung mit diesem Mann, woraufhin die Familie versucht, ihn positiver darzustellen.
Welche Absichten verfolgen die einzelnen Gesprächsteilnehmer?
Nanni will vor allem Lachen provozieren und sich selbst darstellen. Die Mutter versucht, gesellschaftlichen Konventionen gerecht zu werden, äußert sich aber dennoch kritisch. Milene zeigt Verständnis für Rita, wird aber von den anderen beeinflusst. Der Vater hält sich zuerst zurück, ergreift aber später Partei für den Mann. Rita nimmt im ersten Abschnitt eine untergeordnete Rolle ein, ändert dies aber im zweiten Abschnitt.
Wie verhält sich Nanni im Gespräch?
Nanni versucht durch laute und aufdringliche Äußerungen Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie benutzt bildreiche und übertriebene Worte, um den Mann negativ darzustellen.
Welche Rolle spielt die Mutter in der Erzählung?
Die Mutter äußert sich ebenfalls negativ, aber weniger drastisch als Nanni. Sie fühlt sich gesellschaftlichen Konventionen verpflichtet und versucht, ihre Kritik durch Relativierungen abzuschwächen.
Wie wird Milene dargestellt?
Milene wird als die Verständnisvollste dargestellt. Sie äußert sich zuerst positiv über den Mann, wird aber im Verlauf des Gesprächs von den anderen beeinflusst.
Wie wird der Vater charakterisiert?
Der Vater wird zuerst als ängstlich und distanziert dargestellt. Im zweiten Abschnitt ergreift er Partei für den Mann, nachdem er sich ein Bild von der Situation gemacht hat.
Welche Rolle hat Rita im Gespräch?
Rita nimmt im ersten Abschnitt eine untergeordnete Rolle ein und signalisiert ihr Unwohlsein durch nonverbale Mittel. Im zweiten Abschnitt ändert sich dies, und sie übernimmt die Gesprächsführung.
Wie ändert sich die Gesprächssituation im Laufe der Erzählung?
Zu Beginn herrscht ein komplementäres Verhältnis, in dem Nanni und die Mutter Rita in die inferiore Position drängen. Mit der Bekanntgabe der Verlobung ändert sich dies, und Rita übernimmt die superiore Position.
Was passiert am Ende des Gesprächs?
Am Ende entsteht eine Pause, in der der Familie ihr Verhalten bewusst wird. Es ist anzunehmen, dass die Diskussion erneut aufflammen wird, sobald Rita nicht mehr im Raum ist.
Welche paraverbalen und nonverbalen Mittel werden eingesetzt?
Der Text enthält eine schematische Darstellung paraverbaler und nonverbaler Mittel sowie des Kommunikationsverlaufs.
Wie ist der Kommunikationsverlauf dargestellt?
Der Kommunikationsverlauf wird detailliert beschrieben, von der Eröffnung des Gesprächs durch Nanni bis zum Schweigen am Ende.
- Quote paper
- Katrin Woitenas (Author), 2001, Zu Gabriele Wohnmanns "Ein netter Kerl", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100637