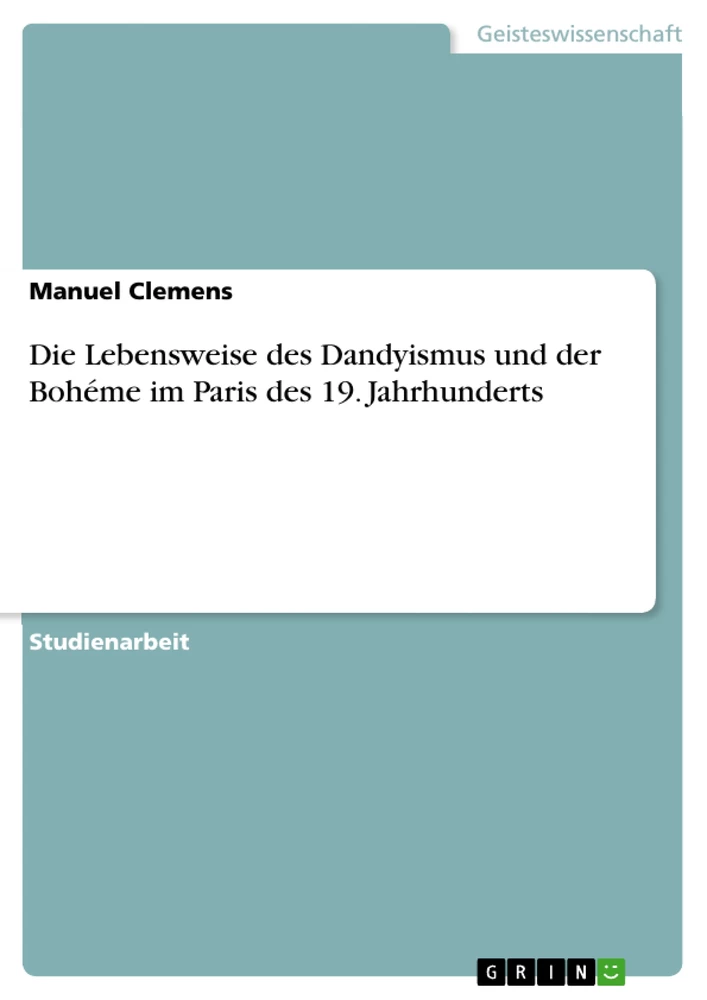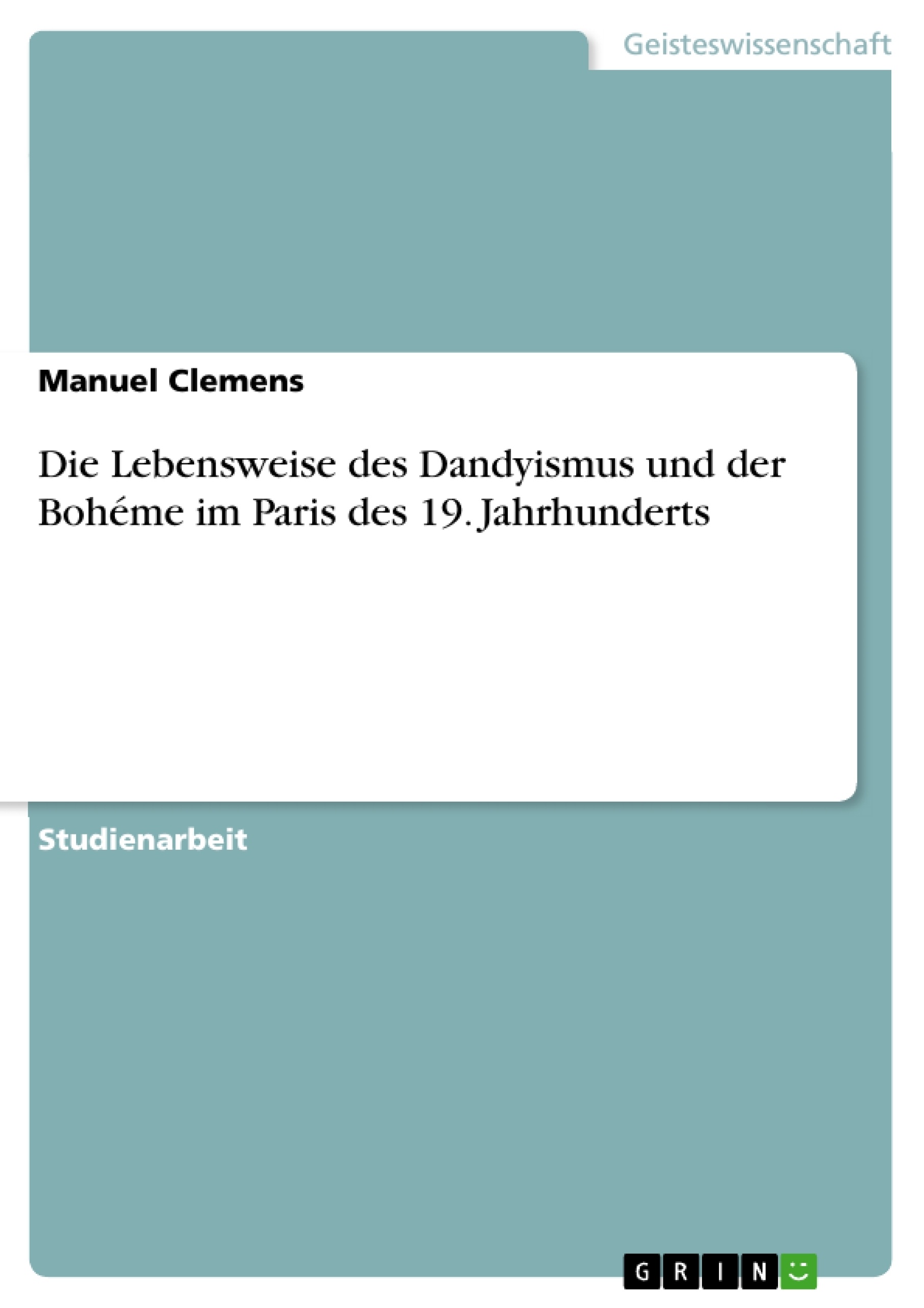Was bedeutet es, in einer Welt der Konventionen und des aufkommenden Kapitalismus seinen eigenen Weg zu gehen? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Dandyismus und der Boheme im 19. Jahrhundert, zwei Gegenströmungen, die das bürgerliche Zeitalter auf ihre Weise herausforderten. Diese tiefgründige Analyse enthüllt die Wurzeln und Ausprägungen dieser Subkulturen, beginnend mit dem Dandy, der in der unsicheren Nachwehen der Französischen Revolution entstand. Entdecken Sie, wie der Dandy, ein Bürgerlicher mit Vermögen und Geschmack, die aristokratische Welt eroberte, indem er Individualität, Zynismus und eine überlegene äußere Erscheinung kultivierte. Erfahren Sie mehr über sein Innenleben, seine Kunstauffassung und sein theatralisches Auftreten in den Salons von Paris und London. Im Gegensatz dazu wird die Boheme beleuchtet, eine Subkultur des Künstlermillieus, die sich durch ihre Ablehnung des Bürgerlichen und ihre Suche nach künstlerischer Freiheit definierte. Erkunden Sie ihr Selbstverständnis, ihre ambivalente Haltung zum Bürgertum, ihre unkonventionelle äußere Erscheinung und ihre alternativen Wohnformen, von Ateliers bis zu Künstlerpensionen. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Salons, Cafés, Künstlerkneipen und Kabaretts, die zu ihren Treffpunkten wurden, und entdecken Sie ihr komplexes Verhältnis zur Großstadt und zum Kunstmarkt. Diese Untersuchung bietet einen faszinierenden Einblick in die Lebensweise, die Ideale und die Widersprüche dieser beiden Bewegungen, die bis heute Künstler, Intellektuelle und Freigeister inspirieren. Untersuchen Sie, wie Dandyismus und Boheme die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts prägten und wie ihre postmoderne Varianten in der heutigen Zeit fortbestehen. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für Kunst, Literatur, Kulturgeschichte und die ewige Suche nach Individualität interessieren, und die Frage, wie man in einer zunehmend uniformen Welt ein authentisches Leben führen kann. Entdecken Sie die verborgenen Facetten dieser Bewegungen und lassen Sie sich von ihrem rebellischen Geist inspirieren. Tauchen Sie ein in eine Zeit des Umbruchs und der kreativen Explosion, in der Konventionen gebrochen und neue Lebenswege beschritten wurden.
Inhalt
1. Der Dandyismus
1. 2 Das vertretene Ideal
1. 3 Das Innenleben
1. 4 Das geistige und Intellektuelle Vermögen
1. 5 Die Kunstauffassung
1. 6 Das Schauspiel
2. Die Boheme
2. 1 Selbstverständnis
2. 2 Einstellung zum Bürgertum
2. 3 Die äußere Erscheinung
2. 4 Die Wohnungen der Bohemiens
2. 5 Der Bohemekreis
2. 6 Salon Café, Künstlerkneipe und Kabarett
2. 7 Das Verhältnis zur Großstadt
2. 8 Einstellung zum Literatur- und Kunstmarkt
2. 9 Bürgerliche Arbeit und Geldwirtschaft
3. Schlußbetrachtung
4. Literaturverzeichnis
1. Der Dandyismus
Die Boheme und der Dandyismus waren im 19. Jahrhundert eigentlich nur in Frankreich und in England möglich. Im Deutschem Reich konnte sich auf Grund der Zersplitterung des deutschen Reiches keine lebendig-liberale Metropole wie London oder Paris herausbilden. Österreich-Ungarn hatte zwar mit Wien eine Metropole, jedoch war diese vom Konservatismus des Kaiserhauses geprägt1.
Die Französische Revolution hatte 1789 den Adel entmachtet und die bürgerliche Emanzipation erlangt2. Jedoch nur für kurze Zeit. In der Kaiserzeit Napoleons (1804-1815), mit der Rückkehr zur Monarchie, konnten sich große Teile des alten Adels wieder etablieren. Dies führte zur Herausbildung einer völlig neuen Gesellschaftsschicht: Der alte, aus der Emigration zurückgekehrte Adel auf der einen und bürgerliche Kaufleute, Revolutionsgewinnler, hohe Beamte und ehemalige Jakobiner, die nun genauso selbstverständlich in den oberen Rängen der Gesellschaft verkehrten, auf der anderen Seite. Dies führte zu großen Unsicherheiten in Fragen des guten Geschmacks, des gesellschaftlichen Umgangs und der politischen Situation. Die Revolution bedeutete einen großen Traditionsverlust für den Adel3.
Auch hatte sie den stetigen Machtverlust des Adels eingeleitet. Die Stellung des Adels wurde auf der einen Seite durch Arbeitsimmigranten aus den ländlichen Gebieten4, ständigen Bevölkerungswachstum5 und mehreren Wirtschaftskrisen und Armut6 bedroht. Auf der anderen Seite durch die Emanzipation des Bürgertums und der Demokratie im Zuge der Industriellen Revolution und der Aufklärung. Diese beiden Bedrohungen für die restaurierte Adelsgesellschaft führten 18307, 18488 und auch 1869-719, zu Revolutionen, die die jeweilige (konstitutionelle) Monarchie stürzten.
In dieser unruhigen, in ihren Grundfesten erschütterten und manchmal auch siedenden Gesellschaft taucht der Dandy auf. Er ist bürgerlicher Abstammung, kann sich aber dank seines Vermögens und seines Geschickes in den adligen Salons behaupten. Die Herkunft des Namens ist ungewiß und es gibt viele Legenden darüber. Der Bergriff „Dandy“ tauchte im 19. Jahrhundert in England auf und galt als ein englisches Kulturprodukt. Erst in den 30er Jahren tauchte er auch in Kontinentaleuropa auf10.
1. 2 Das vertretene Ideal
Auch nach Baudelaire war der Dandy eine Erscheinung der Übergangsgesellschaft im 19. Jahrhundert. Die Demokratie hatte sich noch nicht fest etabliert und der Adel war noch nicht vollkommen entmachtet. Der Dandy, ein beschäftigungsloser, reicher Mann mit Talent, taucht in dieser Zeit als eine Art Zwischenadel auf, da jetzt auch Bürger in die Salons dürfen. Nur in dieser Situation kann sich ein Bürger mit Extravaganz zum Speudo-Aristokraten hochstilisieren. Danach wird die Demokratie bzw. das Bürgertum zu stark und der Adel verschwindet ganz und mit ihm eigentlich auch der Dandy11.
Der Dandy behauptet sich mit seiner distinguierten Individualität auch gegen die Industrie- und Massengesellschaft des 19. Jahrhunderts. Es ist kein politischer Protest, sondern ein ästhetischer: Wenn alles möglich ist und die Menschen immer gleicher werden, wird er immer individueller12. Paris war die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts und eine Massengesellschaft. Bereits im ersten Drittel des Jahrhunderts konnte man durch Passagen flanieren13, später durch die ersten Kaufhäuser14 und nach der Haussmanisierung über große Boulevards, die nun sauber und sicher waren15 ; in Cafés, Tanzpalästen und Kabaretts konnte man sich amüsieren16.
Und genau an diesen Punkten vermischten sich die neue bürgerliche und die alte adlige Gesellschaft. Besonders für den Dandy ist dies nun Ausdruck von Geschmacklosigkeit, da man sich in der Gesellschaft, d.h. in der Masse immer von Mittelmäßigkeit umgeben sieht.
Vor allem die gehobene Gesellschaft des Second Empires (1852-1870) und später die der Belle Epoque (1871-1914) lebten im Vergnügen und Überfluß, aber auch in nivellierter Geistlosigkeit17:
Ü berhaupt eignete dem mondÄnen Leben... vor allem eine gewisse leere Routine (an), bestand dieses doch im wesentlichen in jenem aufwendigem M üß iggang, dem sich die happy few hingaben. Und diese happy few, der Monde parisien waren eine bizarre, eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft, in der sich Angehörige des neuen, des napoleonischen Adels und ReprÄsentanten der Groß bourgeoisie, Bankiers, Spekulanten, Industrielle miteinander mischten. Achse und Mittelpunkt, um den sich diese Monde parisien drehte, war der kaiserliche Hof 18 ...
Diese Gesellschaft war höchst affektiert und gelangweilt. Es gab eine aufwendige und anstrengende Etikette, die genau eingehalten werden mußte. Die Salons erhielten ihre letzte Blüte, jedoch dienten sie mehr dem Klatsch als der geistvollen Konversation. Man feierte viele Bälle, Abendessen, Empfänge und Theaterabende, um der Eintönigkeit zu entkommen. Später entfloh man ganz seiner Welt und vergnügte sich in der bürgerlichen Gesellschaft, die mit ihren Theatern, Opernhäusern, Passagen, Kaufhäusern und Boulevards und auch Bordellen, reizvoller geworden war19. Die beiden Welten hatten sich nun auf einer höheren Ebene vermischt und das Einzige, was noch zählte war Geld:
Was die Grenzen... so rasch verwischte, war, das beide Welten dem nÄmlichen Götzen mit verwandter Schamlosigkeit huldigten: dem Geld... In dieser Parvenu-Gesellschaft, deren Wahrheit vorzüglich der Schein war, (hatte) auch die gesellschaftliche Reputation Wahrencharakter 20.
So waren es vergangene Epochen, die die Ideale des Dandyismus darstellten: Sie träumten sich in die Antike und in die Renaissance. Diese Epochen hatten für sie die Freiheit des
Geistes und den überlegenen, heldenhaften Menschen mit seiner Schönheit im Mittelpunkt gestellt. Die Kunst war das Maß aller Dinge und das öffentliche Leben aristokratisch. Auch das Mittelalter mit dem Glauben an eine göttliche Ordnung und der Vorstellung, die Erde sei das Zentrum des Universums wurde Ziel ihrer romantischen Sehnsucht21.
1. 2 Das Innenleben
Seine Opposition zeigt sich auch in seinem Zynismus. Er fühlt sich der Gesellschaft überlegen, verachtet sie und fühlt sich fremd in ihr. Andererseits braucht er Anerkennung von ihr. Sie ist seine einzige Wirkungsstätte. Er erhält die ersehnte Anerkennung, in dem er mit der Gesellschaft spielt: An Intelligenz, Witz, Charisma und Kleidung überlegen, zieht er ihre Aufmerksamkeit auf sich.
Dies setzt Fremdheit zur Gesellschaft gerade voraus. Nur wer über eine innerliche Distanz zu einer Umwelt verfügt, kann über sie - sinnvoll - reflektieren und ihre und seine Mechanismen erkennen22.
Innerlich bleibt der Dandy jedoch unerfüllt und unter anderen Umständen hätte aus ihm auch eine depressive, gescheiterte Existenz werden können, die Zuflucht im Alkohol sucht. Sein Auftritt ist stets eine Ablenkung. Der Beifall in den Salons verhallt schnell und der Dandy muß immer wieder von vorne anfangen23.
Der Dandy unterscheidet sich aber von dem Exzentriker, weil der Gesellschaft sein Anderssein und seine innere Einsamkeit nicht auffällt. Sie zählt ihn zu sich, nimmt ihn in ihren Kreis mit auf und erfreut sich an ihm, wie an einer Berühmtheit. „Der Dandy... ist ein Außenseiter, der incognito reist“24.
Durch seine Angst vor Nähe und Intimität, begegnet er der Liebe zwiespältig. Einerseits sehnt er sich danach, andererseits kann gerade die Innigkeit mit einer anderen Person sein wahres Ich enthüllen, welches er stets in den Salons verborgen hat. Sie bringt seine Selbstkontrolle in
Gefahr. Er kann nur reflektieren, wenn abstand dazu hat und nicht, wenn er mittendrin ist. Würde er richtig lieben, wäre er mittendrin: Er liebt, er betet jemanden an, seine Gefühlswelt kontrolliert ihn und damit ist er verletzbar und seine „überlegene Gelassenheit“25 verliert sich in seinen Leidenschaften26.
Ein weiteres kaltes Merkmal kennzeichnet nämlich den Dandy: Sein Stoizismus oder sein „Dandystoizismus“27. Zwar überrascht er mit Unerwartetem, schockiert und fällt durch sein Äußeres auf, jedoch bleibt er immer kühl und blasiert. Sein Prinzip ist es, immer ruhig und unbewegt zu bleiben und nie in das Leben einzugreifen. Er ist zu stolz, um sich in der Gesellschaft etwas so trivialem wie Gefühle hinzugeben28. Und gerade seine Kälte begründet seine Schönheit, seine Anziehungskraft: „... als glimme da ein Feuer, das sich höchstens andeutet, das zwar auflodern könnte, sich dessen jedoch enthält“29. Der Dandy ist natürlich arrogant, wenn er Gefühle für die von ihm zu bekämpfende Trivialität hält. Aber wird seine Arroganz nicht als Schwäche, sondern als Stärke ausgelegt, fällt er in jeder Gesellschaft auf. Er verbirgt etwas und man vermutet gleich, dass es seine Größe ist, die er zurückhält.
1. 3 Das geistige und intellektuelle Vermögen
Der Dandy wirkt durch seine individuelle Erscheinung, durch seine geistreiche Konversation und durch seinen aristokratischen Lebensstil. Er hinterläßt in der Regel kein umfangreiches Werk, sondern wirkt durch seine Unterhaltungskunst. Es gibt zahlreiche Anekdoten über Oscar Wilde, Brummel, Baudelaire oder Barbey d´Aurevilly, die ihren verblüffenden Witz, ihre geniale Ironie und ihren scharfen Intellekt belegen.
Sie schossen auf alles und jeden und nahmen alles auf, womit sie gerade konfrontiert wurden. Wirbelten Realitäten durcheinander, bezauberten mit Paradoxen und lieferten letztendlich doch nur eins: außergewöhnliche Unterhaltung. Sie schufen keine Theorien oder beschäftigten sich mit schwierigen Themenkomplexen. Sie wirkten nur durch ihre Aphorismen. Hatten sie literarische Werke verfasst, blieben diese oft hinter ihren Gesprächskünsten zurück. Sie waren Leute der Praxis30.
1. 4 Der Geschmack und das Äußere
Zum kreativen Reichtum und zur geistigen Brillanz kommen weitere Merkmale des Dandys hinzu: Eine individuelle, vorzügliche äußere Erscheinung und finanzielle Unabhängigkeit bzw. Verschwendung. Die meisten waren auch noch sehr schön dazu.
Der Dandy blieb also auch wegen seiner äußeren Erscheinung im Gedächtnis seiner Zuhörer. Zu seiner Ausstrahlung kam noch die erlesene Garderobe. Sie war nicht nur modern und teuer, sondern auch ein Kunstwerk. Niemals kleidete sich der Dandy einfach nur nach der Mode. Der herrschenden Mode fügte er eigene Kompositionen aus verschiedenen Stilen, Epochen und individuellen Merkmalen hinzu. Er ging damit nicht nur seiner Selbstverliebtheit nach, sondern verstand dies auch als Ausdruck und als eine Ergänzung zu seinem aristokratischen Geist31. Das Äußere ersetzt auch sein Kunstwerk. Ihm fehlt ja die große Idee und das Durchhaltevermögen dazu. Er arbeitet so, wie er in den Salon wirkt: aphoristisch32.
Dadurch schafft sich der Dandy seine eigene Ästhetik. Sie ist nicht nur individuell und elegant, sondern sie kann auch provokant sein. Viele Dandys sahen in Gut und Böse keinen Maßstab mehr. Sie befanden sich - beeinflußt beispielsweise durch Nietzsches Philosophie33 - jenseits davon. Viele waren geradezu fasziniert vom Bösen, z.B. vom Satan, von Giftmischern oder von Verbrechern. Da sie sich in der Gesellschaft fremd fühlten, konnten sie auch mit ihren Vorstellungen von Ästhetik nichts anfangen. Diese war für sie oft scheinheilig, deshalb wandten sie sich einem „elitärem Anarchismus“34 zu35.
1. 5 Die Kuns tauffassung
Der Dandy ist ein Romantiker. Durch die Vergötterung des Schönen und des individuellen Lebensstils, war die Kunst nur noch ein „subjektives Mittel zur Aufpeitschung“36. Die Kunst ist zweckfrei (l`art pour l`art - Prinzip). Der Dandy selbst ist die höchste Form der Kunst: „Er schuf nicht Kunst, er war sie“37. Der Dandy verbannt die natürliche Umwelt aus seinem Leben. Sein übersteigerter Schönheitskult ersetzt ihm diese Umwelt. Oscar Wilde: „Die Kunst betrachte ich als die oberste Wirklichkeit, das Leben nur als einen Zweig der Dichtung“38.
Den Schaffensdrang eines Künstlers führt den Dandy nicht zur Erschaffung eines Kunstwerkes, sondern zu einem Schönheitskult an seiner eigenen Person. Der Dandy will nichts verwirklichen, sondern nur sich selbst erhalten. So betont der wahre Dandy, dass er nichts wolle und nichts mehr verachte, als ein nützlicher Mensch zu sein. In dem er die Welt nicht realisiert, protestiert er gegen sie. Er lehnt ihre banale Zweckmäßigkeit ab und stellt sich als zweckfreier Kulturmensch dagegen, der sein beseeltes, lebendiges Inneres pflegt. Dies unterscheidet den Dandy auch vom Dandy-Schriftsteller, welcher zwar auch ein elegantes Leben führt, jedoch gleichzeitig auch an seinem Werk arbeitet39.
1. 7 Das Schauspiel
Der Dandy ist immer auch ein Schauspieler. Nur dadurch kann er seine Wirkung voll entfalten. Er spielt den zur Kunst gewordenen Menschen: Er gibt sich immer frei, ungezwungen und weltmännisch. Nichts kann ihn erschüttern. Er gibt sich betont überlegen, in Situationen, die andere Menschen empören, verunsichern oder einschüchtern. Jede Unsicherheit, jedes Defizit kann er galant überspielen. Er ist ein erstaunlich angenehmer Zeitgenosse. Er stellt seine Raffinesse einfach und selbstverständlich dar, seine Künstlichkeit als absolut natürlich. Sein wahres Wesen gibt er allerdings nicht preis. Er achtet streng darauf, dass es immer verhüllt bleibt, sonst würden die anderen Menschen seine Schwächen erkennen und er hätte seine Überlegenheit ginge verloren40.
Der Dandy ist auch nur in der Großstadt, in einer Metropole möglich. Er schwankt nicht, wie die Boheme, zwischen Großstadtleben und Natursehnsucht. Die Natur ist für ihn langweilig, da er dort nicht wirken kann, sprich niemand sein Äußeres und seine Bonmots bewundert. Dort ist er sich selbst überlassen und damit einer Einsamkeit und seiner inneren Leere preisgebe41.
2. Die Boheme
Die Bezeichnung „Boheme“ hat sich aus dem französischen Begriff für Zigeuner (Bohemiens) entwickelt. Er kam im zweiten Drittel des 19. Jahrhundert in Frankreich auf und ist die Bezeichnung einer Subkultur innerhalb des Künstlermillieus. Kennzeichen dieser Subkultur ist vor allem ihr Anti-Bürgerliches Leben42.
Genauso wie die Boheme ein „Schreck- und Wunschbild des Bürgers“43 ist, so ist sie auch ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft. Sie steht nicht nur im Gegensatz zu ihr, sondern sie bildet sich auch aus ihr heraus. Erst mit der Erfindung des Buchdruckes und der Entstehung eines Marktes für literarische Produktionen im 18. Jahrhundert, konnte sich ein - nichtakademisches - intellektuelles Leben in den Großstädten Europas etablieren. Wenn der Bohemien vielleicht nicht unbedingt für diesen Markt schrieb, so war er dennoch von ihm abhängig, da er seine einzige Einkommensquelle war. Die Existenz dieses Marktes machte das freie Schriftstellertum überhaupt erst möglich. Davor waren Künstler nur als Produzenten für den Adel tätig. Nun bestand dieses Abhänigkeitsverhältnis nicht mehr und sie besaßen zum ersten Mal künstlerische Freiheit und jeder, der künstlerisch tätig sein wollte, konnte sich auf dem Markt versuchen44.
Von der Emanzipation des Bürgertums durch die Erkämpfung von Freiheits- und Partizipationsrechten, profitierte auch die Boheme. So konnte für sie eine relative Bejahung oder praktische Duldung ihres Individualismus und der geforderten Autonomie der Kulturbereiche durch die Gesellschaft entstehen45.
Letztendlich liegt dieser Entwicklung natürlich die Industrialisierung zu Grunde, welche die Emanzipation des Bürgertums, den Anstieg des Bevölkerungseinkommens, Alphabetisierung und Urbanisierung erst möglich machte.
2. 1 Selbstverständnis
Die Boheme war idealistisch, wild und zügellos. Da sie nicht für den Kunstmarkt produzieren wollte, wurde sie schnell zum Außenseiter im Kunstbetrieb. Durch ihr unkonventionelles bis exzentrisches Verhalten fielen sie auf und wurden bald nicht mehr als Einzelerscheinung, sondern als Gruppe wahrgenommen. Die Außenseiterposition machte sie nicht besonders erfolgreich. Für die Boheme war dies allerdings ein Zeichen von Avantgardismus und Genialität: Nur wer außerhalb der Gesellschaft und der Massenproduktion steht, kann neues und geniales erschaffen. Dies führte schnell zu einem Geniekult in der Boheme. War man nicht mehr auf das Urteil der Gesellschaft oder auf das der Kritiker angewiesen, konnte man sich selbst zum Genie erklären46.
2. 2 Einstellung zum Bürgertum
Die erste Grundvorstellung der Boheme von der bürgerlichen Gesellschaft war das Bild des „braven“, subalternen Bürgers, der sich in ein hierarchisches System einfügt. Dessen Wertvortsellungen und Tugenden Ordnungsliebe, Reinlichkeit, Sparsamkeit, Arbeitssamkeit, Pünktlichkeit, wirtschaftliche Sicherheit, guter Ruf und Verantwortung für Familie und Gesellschaft sind. Meist wird er sich als Mittel- oder Kleinbürger vorgestellt, kann jedoch als hoher Militär, hoher Beamter oder Kleriker auch einen anderen sozialen Hintergrund haben.
Dieser Bürger fühlt sich weniger personeller Autorität verpflichtet, sondern Gesetzen und Dogmen: Herkunft, Sitte, Konventionen des Denkens und des Handelns. Er unterdrückt Individualität, spontane Impulse (Kreativität) und Erneuerungen zugunsten fester Lebens- und auch Kunstregeln47.
Die zweite Grundvorstellungen ist der Bourgeois als Ausdruck einer unmenschlichen und zweckrationalisierten Lebensweise. Er wird als geistfeindlich, rücksichtslos und herzlos begriffen, voller stillosem Protztum und vulgärer Genußsucht. Durch seine monetäre Macht auf dem Markt besitzt er auch Macht über den Künstler, der ja seine Werke dort verkaufen muß48.
Beide Vorstellungen sind natürlich Stereotype. Die Bilder der Boheme vom Klein- und Mittelbürger gingen sicherlich noch auf deren persönliche Beobachtungen und Erfahrungen zurück. Das negative Bild vom Groß- oder neureichem Wirtschaftsbürgertum sicherlich weniger und kamen meistens durch Berichte Dritter zustande. Dementsprechend war es auch viel schwieriger zu korrigieren und konnte sich als Klischee umso mehr festsetzten49.
2. 3 Die äußere Erscheinung
Die Boheme toleriert Trachten und Moden, auch die allgemeinen und duldet modische und extravagante dandyische Eleganz genauso wie eine extreme Vernachlässigung der äußeren Erscheinung. Dem Idealtyp des Bohemiens entspricht jedoch nicht die unauffällige, sondern die recht eigenwillig gekleidete Person. Ärmliche Kleidung wurde sicherlich oft nicht freiwillig getragen, sondern war durch die Armut vieler Bohemiens bedingt. Jedoch konnte Schäbigkeit auch demonstrativ zur Schau gestellt und als eigener Stil ausgewiesen werden.
Daneben gab es natürlich zahlreiche Phantasietrachten der Boheme, die aus purer Lust am phantastisch-exzentrischem oder zugleich um dessen distanzierenden und provozierenden Effekts willen, entworfen und getragen wurden. Beispielsweise folkloristische, exotische, klerikale oder aus vergangenen Zeiten stammende Kostüme waren von dieser Art. Am meisten verbreitet ist jedoch die städtische Mode, die durch kleine Details abgeändert wurde: kühne Krawatten, Sandalen, schrille Westen, betonte Unordnung oder eigenwillige Haar- oder Barttrachten.
Jedoch wurden viele dieser Abweichungen zu modische Regeln. Aus der Ablehnung der Mode der bürgerlichen Gesellschaft wurde eine Mode für Künstler und Rebellen, die mit der Zeit genauso uniform werden konnte. Das reizte wiederum zu neuer, potenzierter Distanzierung, was die antibürgerliche Mode ständig weiter entwickelte und zahlreiche phantasievolle Eigenkreationen schuf50.
2. 4 Die Wohnungen der Bohemiens
Der Wohnstil der gehobenen Boheme (oder Halb-Boheme) und der verarmten Boheme ist genauso unterschiedlich wie ihre Kleidung. Man wollte vom bürgerlichen Wohnen abweichen und tat dies durch unfreiwillige (oder auch freiwillige) Schäbigkeit oder durch teuren, verschwenderischen und phantasievollen Luxus und Raffinement der Einrichtung.
Die Wohnungen befanden sich in bestimmten Vierteln der Großstadt, wo sich auch das gesamte Bohemeleben abspielte. Die Wohnung wurde oft gewechselt, teils aus äußeren Ursachen (Konflikte mit den Vermietern, Mietrückstand, Flucht vor Gläubigern), teils aus inneren Gründen (man fühlte sich in keiner Wohnung richtig wohl, da sie ärmlich waren; Ideal des Kulturnomadentums).
Am typischsten ist wohl das Atelier und die „Bude“, jenes möblierte oder unmöblierte Zimmer im Dachgeschoß eines Großstadthauses. Vor allem das Atelier wurde wegen seiner Größe der Hauptschauplatz der vielen Künstlerfeste und Dauerpartys der Boheme. Es wurde aber nicht nur von Malern gemietet, sondern auch von Literaten und Schauspielern und diente dann als ein Saal für Lesungen oder als Bühne für Theaterstücke. Hier konnte man sich als eine große Familie fühlen und wurde von der bürgerlichen Gesellschaft nicht gestört. Viele Atelierbesitzer nahmen auch heimatlose Bohemiens bei sich auf und gaben ihnen dort einen Schlafplatz.
Eine weiter Form des Wohnens waren die Künstlerpensionen. Manche dieser Pensionen sind wegen ihrer Gemütlichkeit und der Persönlichkeit ihrer Betreiber berühmt geworden oder wegen ihrer ausschweifenden Partys in die Literatur der Boheme eingegangen. Mancher mittellose Bohemien versuchte auch in Klöster unterzukommen, jedoch schreckten sie meist die strengen Klosterregeln ab, da ihnen der Glaube und der Gehorsam fehlte51.
2. 5 Der Bohemekreis
Die meisten Bohemiens hatten sich verschiedener Kreise angeschlossen. Sie trafen sich regelmäßig, kannten sich persönlich und hatten ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl als Bohemiens an lockeren Stammtischen in öffentlichen Künstlerlokalen.
Man traf sich immer am gleichen Ort, bildete Wohngemeinschaften oder Zirkel in der Nachbarschaft. Bei den Gruppen, die wenig miteinander gemeinsam hatten, war die gemeinsame Basis manchmal nur die Verachtung der bürgerlichen Gesellschaft und die Freude am bohemischen Lebensgenuß. Ansonsten hatten sie unterschiedliche Welt- und Kunstanschauungen und politische Richtungen. Es gab aber auch Gruppen mit vielen Gemeinsamkeiten und festgelegtem Programm: intellektuelle Auseinandersetzungen, Spiel, Tanz, gemeinsamer Sex, Alkohol- und Drogengenuß oder Geniekult.
Bohemische Arbeitsgemeinschaften planten und betrieben Galerien, Lesungen, Kabarette, Theater, Jazzbands, (Underground-) Filmprojekte, politische Demonstrationen, Zeitungen und Verlage, sowie Reformkolonien und Kommunen um alternative Lebensstile auszuprobieren.
Oft hatten diese Kreise eine Führerfigur, die den anderen weit überlegen war. Mit seiner dominierenden Persönlichkeit - ausgezeichnet durch künstlerische Erfahrung oder Bedeutung, höheres Alter, bessere Ausbildung, Intelligenz und Eloquenz, durch antibürgerliche oder avantgardistische Radikalität, legendären Ruf oder Charisma, konnte er viele der autoritätsfeindlichen Bohemiens in seinen Bann ziehen52.
2. 6 Salon, Café, Künstlerkneipe und Kabarett
Der Salon hatte im 18. Jahrhundert die kulturelle Funktion des Hofes übernommen. Er wurde zu einer Art Enklave, in der sich sozial grundverschiedene Kreise (Stadtaristokratie, Großbürgertum, Beamtenschaft, Intellektuelle und Bürger kleinerer Herkunft) begegneten. Sonst waren diese Kreise streng voneinander getrennt. Neben den gemischten Salons gab es auch streng voneinander abgegrenzte. Beispielsweise die Intellektuellensalons oder die Literatursalons. In beide Salons fanden herausragende Vertreter der Boheme Einzug. Hatten sie etwas besonderes geschaffen, so interessierte man sich dort für sie53.
Ansonsten waren öffentliche Lokale der Treffpunkt der Boheme. Besonders wenn sie in der Nähe von Theatern und Akademien gewesen sind. Man konnte dort auf seinesgleichen treffen aber auch die Öffentlichkeit bekommen, die man suchte. Die Lokale boten eine Bühne auf der man vor anderen Bohemiens oder vor Bürgern „spielen“, d.h. provozieren oder diskutieren konnte.
Das Intellektuellencafé erleichterte den Anschluß an das künstlerische und geistige Leben. Hier konnte man am besten auf Gleichgesinnte, Freunde und vielleicht auch auf Bewunderer und Gönner treffen. Es hält Zeitungen und Zeitschriften bereit und bringt Künstler, Gelehrte und Journalisten zusammen. Für Nichtakademiker konnte es sogar eine Art Universitätsersatz sein, da man von den Gesprächen und Diskussionen einiges lernen konnte. Viele Schriftsteller nutzten das Café auch als Arbeitsstätte.
Man konnte hier auch den tristen, beengten Wohnverhältnissen entkommen, wenn man ein mittelloser Bohemien war. Da viele Bohemiens unverheiratet und in möblierten Zimmern wohnten, ohne die Absicht oder die Möglichkeit einen Haushalt zu führen, besuchten sie, soweit es ihre Mittel erlaubten, Speiselokale. Von ihnen gab es ganz billige und recht vornehme.
Die Stammlokale der Boheme wurden zu Künstlerlokalen. Manchmal wurden hier die Darbietungen der Künstler, erst für ihre Bekannten und später auch für Gäste, zur Regel. Dies leitete den Übergang zu Galerien, Kabaretten und literarischen Varietés ein. Aufführungen stellten bald eine zusätzliche Einnahmequelle für Bohemiens dar. Der Ruf, ein Künstlerlokal zu sein, konnte für den Wirt auch Werbung sein. Die Gäste versprachen sich von der ausgelassenen, nicht alltäglichen Atmosphäre ein besonderes Erlebnis54.
2. 7 Das Verhältnis zur Großstadt
Die Treffpunkte und Wohnungen der Boheme sind oft in bestimmten Großstatdvierteln und Vororten gelegen. Als ideal galten Viertel, die billig waren oder folkloristische oder historische Reize hatten. Mit der Zeit konnte so eine „Stadt in der Stadt“ entstehen. Bohemetypische Geschäfte Lokale und Geschäfte schossen dort aus dem Boden, Lokalzeitungen werden gegründet und die Leute sahen viel bunter und schriller aus als in der übrigen Stadt55.
Das Verhältnis der Boheme zur Großstadt ist jedoch zwiespältig. Denn mit dem Gefühl der dortigen Unabhängigkeit verbindet sich auch das Gefühl, einsam zu sein. Gerade wenn sich dort noch kein richtiges Boheme-Viertel herausgebildet hat. Häufig sind deshalb verklärte romantische Vorstellungen vom Landleben und das Herumpendeln zwischen Stadt und Land.
Zahlreiche Reisen und Reiseträume sind ebenfalls Ausdruck dieses Spannungsverhältnisses: Man verklärt fremde Orte und träumt sich dort in ein besseres Leben hinein. Auch der Reiz des Fremden, Unbekannten und Abenteuerlust waren damit verbunden. Manche von der Reispassion besessene Autoren werden zu Reiseschriftstellern und Weltreportern. Andere zu Landstreichern und Gelegenheitsarbeitern56.
Blieb man seßhaft, jedoch fast ohne Einkommen, konnte man als studierter Bohemien schnell zum Intelligenzproletariat gehören. Sie hatten danach keine Anstellung gefunden, wollten jedoch in keinen anderen Beruf wechseln, der ihnen ein höheres Einkommen gebracht hätte. Stattdessen kämpften sie immer am Rande des Existenzminimums und widmeten sich ihrer Künste oder dem Schreiben57.
2. 8 Einstellung zum Literatur- und Kunstmarkt
Die Boheme verachtete den Markt. Der echte Künstler dürfe nur zu seinem Vergnügen, zu seiner Befreiung schreiben. Das Publikum könne den Wert und Sinn der Kunst eh nicht verstehen. Allenfalls das Urteil der Nachwelt (welches als positiv antizipiert wird), der Avantgarde (die ihrer Zeit voraus ist) oder einzelner erlesener Geister sei von Bedeutung. Dieser Publikumsstereotyp trägt die gleichen Züge wie der des Bürger- und Bourgeoisstereotyps.
Der Künstler, welcher über keine Mittel oder über keinen Mäzen verfügt, steht natürlich vor dem Dilemma, entweder einfaches und drittklassiges für den profanen Markt zu produzieren und die Kunst zu verraten oder sich auf sein sakrales Künstlertum zurückzuziehen und mittellos zu bleiben58.
2. 9 Bürgerliche Arbeit und Geldwirtschaft
Die Notwendigkeit einer nichtkünstlerischen, bürgerlichen Arbeit wird von der Boheme manchmal resigniert akzeptiert, häufiger mit Widerwillen, Auflehnung, als Sklaverei, Entfremdung von der Kunst und dem künstlerischen Selbst aufgefaßt. Mit der Liebe zur Kunst geht die Verneinung der Arbeit Hand in Hand.
Geld wird meistens sehr großzügig ausgegeben. Man möchte den Augenblick so genußvoll wie möglich genießen. Diese Geldverschwendung durch Ausflüge in Tanzlokale, Eß- und Trinkgelage oder durch prunkvolle Kleidung bei plötzlichem Geldzufluß steht natürlich im Gegensatz zur bürgerlichen Welt. Dort ist man meist sparsamer und sorgt sich um die Zukunft. Für die Boheme ist dies viel zu beengt. Sie fühlt sich zum ästhetisch verfeinerten Genuß prädestiniert und zur spontanen Lebensäußerung bereit.
In der mittleren und unteren Boheme manifestiert sich dieser Großzügige Lebensstil vor allem in Schulden beim Vermieter, in Lokalkredieten und im freien Umgang mit Vorschüssen. Andere haben geerbt reich eingeheiratet, lassen sich von Freunden, etc. aushalten oder erhalten regelmäßige oder unregelmäßige Zuwendungen von (bürgerlichen) Mäzen, Freunden, Organisationen, etc. , wenn sie von ihren Werken nicht leben konnten.
Es gibt aber auch Bohemiens, die Arbeit und Geld ablehnen, weil es den Menschen verderbe. Ihnen schwebte ein - praktiziertes oder ideelles - kommunistisches Zusammenleben vor59.
3. Schlußbetrachtung
Den Dandy gibt es heute nur noch in seiner postmodernen Variante: Jeder kann ein Dandy sein, aber niemand ist es mehr so richtig, da der Dandy als Klischee kopiert und weniger konsequent verwirklicht wird. Der Dandy hatte viel zu interessante Züge, als das er einzigartig bleiben konnte.
In der heutigen Gesellschaft gibt es nur noch wenige Konventionen und um etwas zu sein, muß man sich von anderen unterscheiden, hervorstechen, eben wie der Dandy, individuell sein. Was bietet sich da besser an als ihn zu kopieren? Kombiniert man geschickt die Kleidung der schwedischen Firma H&M, kann man leicht für einen (Pseudo-) Dandy gehalten werden. Hier wird individuell wirkende Kleidung massenweise produziert und deshalb billig verkauft, mit dem Nachteil, dass jeder sie tragen kann. Erst ein Playboy kann sich die große Dandyexsistenz erkaufen.
Wenn es heute noch Tabus gibt, dann kann man sie in unserer - trivialen - Mediengesellschaft, aber auch im kleinen Kreis, leicht brechen und schon fällt man nicht nur durch sein Äußeres auf. Mit Drogen- und Alkoholkonsum, lange Partynächte in der Erlebnisgesellschaft, selbstverliebter Geniekult im Zeitalter der Egogesellschaft und innere Leere durch Säkularisierung kann man heute jeden Tag versuchen, seinen Ruf als Dandy zu begründen.
Was damals erst im Entstehen war gibt es heute an jeder E>und ihre Anhänger stilisieren sich schnell zu Individualisten, usw. und glauben es auch zu sein. Ihr neustes Phänomen ist vielleicht die sogenannte Popliteratur. Junge Schriftsteller schreiben einfach das auf, was sie erleben und was jeder Leser nachvollziehen kann. Das Ergebnis sind dann flotte Sprüche und derbe Worte über die Schwierigkeiten und Freuden jung zu sein. Von den Verlagen werden diese Popdandys vermarktet wie selbst Günter Grass nach dem Nobelpreis nicht.
Wer könnte dann heute noch ein Dandy sein? Vielleicht jemand mit Eigenschaften, die sich nicht so leicht kaufen, überstülpen oder vermarkten lassen: Mit Esprit und Witz. Doch wo soll er agieren? Die Salons gibt es nicht mehr, dass gesellschaftliche Leben findet heute überall statt. Letztendlich gibt es genug Witz und Satire im fernsehen. Der Dandy des 19.
Jahrhunderts ist wohl in zahlreiche unterschiedliche Persönlichkeiten und Lebensentwürfe eingegangen.
Auch die Boheme gibt es heute meist in ihrer postmodernen Variante: Sie ist überall und doch nirgends. Auch sie war reizvoll und wurde zum Mythos. Ehemalige sogenannte
Bohemeviertel (Montmartre in Paris oder Greenwich Village) wurden zu Touristenattraktionen und zu Wohnvierteln für geschmackvolle Beserverdienende. Auch viele ehemalige Cafés der Boheme sind heute sehr teuer geworden und machen immer noch Werbung mit ihren verstorbenen berühmten Gästen. Ein Café in Paris hat ironisch auf der Wand neben dem Eingang eine Tafel angebracht mit der Aufschrift: „Hier hat Hemingway nicht zu Mittag gegessen“.
Viele neue Cafés, beispielsweise in den Berliner Bezirken Prenzlauer Berg und Mitte, geben ihrer Einrichtung Bohemetünche. Sind mehrere Cafés dieser Art in einer Straße und sitzen dort dandyähnliche junge Leute, so spricht man heute schnell von Künstlerbezirken - bzw. neudeutsch - Szeneviertel. Der Flair, den die Boheme ausstrahlte, ist genauso populär, chic und werbewirksam geworden wie den der Dandys. An unzähligen Stellen in jeder Stadt gibt es einen Hauch von Boheme.
Heute sollen sich in Paris die Künstler im 11. Arrondissment, nahe des Platzes der Bastille, niedergelassen haben. In New York in Wilhelmsburg, auf der anderen Seite des Hudsons. Wahrscheinlich leben dort wirklich mehr Künstler als anderswo. Aber wenn diese Viertel schon in Reiseführern als „sehenswert“ aufgeführt sind, kann es sein, dass ihre Zeit auch bald schon wieder vorüber ist. Ein blühendes Bohemeviertel lebt gerade davon, dass es wenig bekannt ist.
Die Boheme lebt heute verstreut in den Großstädten. Sie hat noch ihre Viertel und Treffpunkte, jedoch verteilen sie sich über die gesamte Stadt und gehen schnell in die Szene der jungen Massenkultur über. Die Boheme muß sich heute nicht mehr zu einer Community zusammenschließen. Kunst kann heute vom Markt leben und wird von zahlreichen Institutionen gefördert. Auch ist die Kunst vielfältiger geworden: Medien- und Instalationskünstler haben mit dem Schriftsteller und dem Kunstmaler nicht mehr so viel gemeinsam. Auch gibt es wohl kaum noch eine Armutsboheme: Mit dem Verschwinden der Klassengesellschaft in eine Mittelstandsgesellschaft ist auch der Künstlerproletarier verschwunden. Wenn es ihn heute noch gibt, dann in der Form des kreativen Sozialhilfeempfängers.
4. Literaturverzeichnis
Barck, Karlheinz, Literarisches Lexikon.Ästhetische Grundbegriffe, Band 1, Stuttgart, Weimar, 2000.
Baudelaire, Charles, SÄmtliche Werke. AufsÄtze zur Literatur und Kunst, Band 5, München, Wien, 1989.
Kreuzer, Helmut, Die Boheme. BeitrÄge zu ihrer Beschreibung, Stuttgart, 1968.
Otto, Mann, Der moderne Dandy. Ein Kulturproblem des 19. Jahrhunderts, Berlin, 1925. Stein, Gerd, Bohemien, Tramp, Sponti, Frankfurt/Main, 1981.
Willms, Johannes, Paris. Hauptstadt Europas 1800 - 1914, München, 2000.
[...]
1 Mann, Otto, Der moderne Dandy. Ein Kulturproblem des 19. Jahrhunderts, Berlin, 1925, S. 11 - 15.
2 Die Geschichte Frankreichs im 19. Jahrhundert ist wesentlich komplexer als hier dargestellt. In dieser Arbeit sollen lediglich die Ereignisse und die gesellschaftlichen Veränderungen besprochen werden, die zur Herausbildung des Dandyismus (und auch der Boheme) beitrugen.
3 Johannes Willms, Paris. Hauptstadt Europas 1800 - 1914, München, 2000, S. 15 - 25.
4 ebd. , S. 44 - 47, S. 112 - 113 und S. 252
5 ebd. , S. 110, S. 123 und S. 252
6 ebd. , S. 117 - 123, 164, 264 - 274 und S. 356
7 ebd. , S. 163 - 181
8 ebd. , S. 256 - 264
9 ebd. , S. 373 - 413
10 Karlheinz Barck (Hg.), Ä sth. Grundbegriffe. Band 1, Weimar, Stuttgart, 200S. 814 - 815
11 Charles Baudelaire, SÄmtliche Werke. AufsÄtze zur Literatur und Kunst, Band 5, München, Wien, 1989, S. 244.
12, Ästhetische Grundbegriffe, S. 818
13 Willms, S.128 - 138
14 ebd. , S. 336 - 343
15 ebd. , S. 314 - 326
16 ebd. , S. 434 - 439
17 ebd. , S. 348 - 354 und S. 432 - 445
18 ebd. , S. 349
19 ebd. , S. 350
20 ebd., S.350-351
21 ebd.,, S. 45 - 55
22 ebd., S. 821 - 822
23 end., S. 33 - 44
24 Ästh. Grundbegriffe, S. 821
25 ebd. , S. 827
26 ebd. , S. 825 - 827
27 Mann, S. 30
28 Baudelaire, S. 244 - 245
29 ebd. , S. 245
30 ebd. , S. 56 - 68
31 Baudelaire, S. 242
32 Mann. , S. 68 - 85
33 Für Nietzsche waren die Kategorien „Gut“ und „Böse“ falsch. Die Vorstellungen von dem, was gut sei, unsere Moral und unsere christliche Erziehung, würden uns nur zu schwachen Menschen machen. Die Schwachen hätten es natürlich in dieser Gesellschaft gut, da sie von den Starken profitieren. Aber der Starke verliere durch die Rücksichtnahme auf die Schwachen nur an Energie und könne sich und seine Taten bzw. Werke nicht zur richtigen Vollendung bringen.
34 Ästh. Grundbegriffe, S. 829
35 ebd. , S. 827 - 830
36 Mann, S. 23
37 ebd. , S. 25
38 ebd. , S. 26
39 Ästhetische Grundbegriffe, S. 817 - 818
40 ebd. , S. 85 - 90
41 Ästh. Grundbegriffe, S. 822 - 823
42 ebd., S. 728
43 Stein, Gerd, Bohemien, Tramp, Sponti, Frankfurt/Main, 1981, S. 9.
44 Kreuzer, Helmut, Die Boheme. BeitrÄge zu ihrer Beschreibung, Stuttgart 1968, S. 44.
45 ebd., S. 45
46 Ä sthetische Grundbegriffe, S. 730 - 734
47 Kreuzer, S. 140 - 146
48 ebd., S. 146
49 ebd., S.146
50 ebd., S. 154 - 161
51 ebd., S. 161 - 169
52 ebd., S. 170 - 188
53 ebd., S. 188 - 202
54 ebd., S. 202 - 216
55 Kreuzer, S. 216 - 221
56 ebd., S. 221 - 238
57 ebd., S. 238 - 244
58 ebd., S. 244 - 253
Häufig gestellte Fragen
Was ist Dandyismus laut diesem Text?
Der Dandyismus war eine Erscheinung der Übergangsgesellschaft im 19. Jahrhundert, hauptsächlich in Frankreich und England, da das Deutsche Reich zersplittert war und Österreich-Ungarn konservativ. Der Dandy, oft bürgerlicher Herkunft mit Vermögen, stilisierte sich als Pseudo-Aristokrat, indem er sich durch Individualität und Ästhetik gegen die Industrie- und Massengesellschaft abgrenzte. Er idealisierte vergangene Epochen wie die Antike und Renaissance und lebte einen zynischen Lebensstil.
Wie wird die Boheme in diesem Text definiert?
Die Boheme, abgeleitet vom französischen Begriff für Zigeuner, war eine antibürgerliche Subkultur innerhalb des Künstlermillieus im 19. Jahrhundert. Sie entstand mit dem Aufkommen des Buchdrucks und des Marktes für literarische Produktionen. Die Boheme lehnte bürgerliche Werte ab und strebte nach künstlerischer Freiheit, wobei sie oft in Armut lebte und sich durch unkonventionelles Verhalten auszeichnete.
Welche Rolle spielte die Französische Revolution bei der Entstehung des Dandyismus?
Die Französische Revolution entmachtete den Adel und ermöglichte die bürgerliche Emanzipation. Die Kaiserzeit Napoleons führte jedoch zur teilweisen Restauration des Adels, was zu einer neuen, unsicheren Gesellschaftsschicht führte. Der Dandyismus entstand in dieser unruhigen Gesellschaft als eine Art Zwischenadel.
Wie unterscheidet sich der Dandy von der Boheme in Bezug auf die Großstadt?
Der Dandy ist auf die Großstadt angewiesen, da er dort seine Wirkung entfalten kann und von anderen bewundert wird. Die Boheme hingegen hat ein zwiespältiges Verhältnis zur Großstadt, da sie sich dort zwar unabhängig fühlt, aber auch einsam. Oftmals pendelt sie zwischen Stadt und Land oder träumt von einem besseren Leben in der Ferne.
Welche Einstellungen zur Arbeit und Geldwirtschaft haben Dandy und Boheme?
Der Dandy verachtet es, ein nützlicher Mensch zu sein, und betont seine Zweckfreiheit. Er lehnt die banale Zweckmäßigkeit der Welt ab. Die Boheme betrachtet bürgerliche Arbeit oft mit Widerwillen, als Entfremdung von der Kunst. Geld wird meist großzügig ausgegeben, um den Augenblick zu genießen, im Gegensatz zur bürgerlichen Sparsamkeit.
Was sind typische Merkmale der äußeren Erscheinung eines Dandys?
Der Dandy zeichnet sich durch eine individuelle und vorzügliche äußere Erscheinung aus. Er kleidet sich nicht einfach nach der Mode, sondern kombiniert verschiedene Stile und Epochen. Seine Kleidung ist ein Kunstwerk und Ausdruck seines aristokratischen Geistes.
Wie wohnten Bohemiens typischerweise?
Bohemiens wohnten oft in Ateliers oder möblierten Zimmern in Dachgeschossen von Großstadthäusern. Die Wohnungen befanden sich in bestimmten Vierteln der Großstadt und wurden oft gewechselt. Künstlerpensionen waren eine weitere Wohnform, in denen ausschweifende Partys stattfanden.
Welche Rolle spielten Salons, Cafés und Künstlerkneipen im Leben der Boheme?
Salons ermöglichten Begegnungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen. Öffentliche Lokale, insbesondere Cafés und Künstlerkneipen in der Nähe von Theatern und Akademien, dienten als Treffpunkte, Bühnen für Provokationen und Orte, um Gleichgesinnte zu treffen.
Inwieweit existieren Dandyismus und Boheme heute noch?
Dandyismus und Boheme existieren heute meist in ihrer postmodernen Variante. Der Dandyismus wird als Klischee kopiert, und die Boheme ist überall präsent, aber nicht mehr so konsequent verwirklicht. Ehemalige Bohemeviertel sind oft zu Touristenattraktionen geworden, und der Flair der Boheme ist populär und werbewirksam.
Was ist ein Bohemekreis?
Die meisten Bohemiens haben sich verschiedener Kreise angeschlossen. Sie trafen sich regelmäßig, kannten sich persönlich und hatten ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl als Bohemiens an lockeren Stammtischen in öffentlichen Künstlerlokalen.
- Quote paper
- Manuel Clemens (Author), 2001, Die Lebensweise des Dandyismus und der Bohéme im Paris des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100609